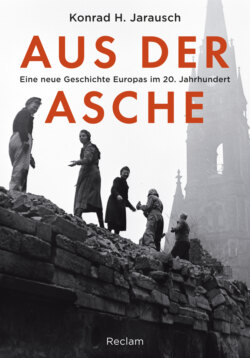Читать книгу Aus der Asche. Eine neue Geschichte Europas im 20. Jahrhundert - Konrad H. Jarausch - Страница 42
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mühen der Sieger
ОглавлениеSogar in den Bevölkerungen der Siegermächte regte sich bald Enttäuschung über die Demokratie, denn sie fanden ihren Lohn für die erbrachten Opfer unangemessen gering und den Übergang von der Nachkriegszeit zur Normalität mühsam. Das bessere Leben, das die Propaganda ihnen versprochen hatte, ließ auf sich warten, und viele Trophäen, die gewisse Geheimverträge in Aussicht gestellt hatten, blieben unerreichbar. Ferner zeigte sich, dass die Umdisponierung von der Kriegs- zur Friedenswirtschaft zeitaufwendiger, teurer und störanfälliger war als gedacht. Der Bedarf an Konsumgütern, den man während der Kämpfe hatte zurückstellen müssen und nun endlich wieder befriedigen konnte, bewirkte zwar einen kurzlebigen Nachkriegsboom. Doch die öffentlichen Kreditaufnahmen, mit denen die Kriegsausgaben finanziert worden waren, trugen zu einer kräftigen Inflation bei. Kaum waren die Ersparnisse verbraucht, brach die Kaufkraft weg, was eine Rezession zur Folge hatte, die sich noch verschärfte, als heimgekehrte Soldaten dringend zivile Arbeitsstellen suchten. Als illusionär erwies sich auch die Erwartung, man könne die Kosten ja den besiegten Feinden zuschieben, denn die Reparationszahlungen fielen niedriger aus als erwartet. Daneben hatten die Alliierten untereinander Schulden, und ein selbstgerechter US-Kongress beharrte stur auf deren Begleichung. Binnen weniger Monate wich die Siegeseuphorie der Frustration, was im Inland für Zwist sorgte und international das Aushandeln von Kompromissen blockierte.
Streitigkeiten prägten nun auch das politische Leben in der konstitutionellen Monarchie Großbritannien, weshalb deren Übergangsphase besonders strapaziös verlief. Der damalige Premierminister, der aus WalesWales stammende Liberale Lloyd GeorgeLloyd George, David, versprach während der durch den Krieg geprägten sogenannten Khaki-Wahlen 1918 den Soldaten ein Land, »in dem Helden leben können«. Seiner Koalition aus Liberalen und Konservativen gelang ein beeindruckender Sieg, und die Mehrheitsverhältnisse erlaubten ihm, einige gesellschaftliche Reformen anzuschieben. Man baute das Bildungswesen aus, förderte sozialen Wohnungsbau, erweiterte den Arbeitslosenversicherungsschutz und erhöhte die Renten. Im Oktober 1922 aber verließen die Konservativen, denen soziale Maßnahmen missfielen, das Regierungsbündnis, während die Labouristen für weitere Reformen agitierten: Dank der nächsten Wahl kurz danach konnten sie die Liberalen als stärkste Oppositionspartei ablösen. Ihr talentierter, aber politisch etwas konfus agierender Führer Ramsay MacDonaldMacDonald, Ramsay bildete 1924 die erste Labour-Regierung, doch schon bald musste er den Premiersitz für seinen Vorgänger räumen, den konservativen Hardliner Stanley BaldwinBaldwin, Stanley, der dann seinerseits die Wahl 1929 verlor. Das brachte wiederum MacDonaldMacDonald, Ramsay an die Macht, der 1931 eine Regierung der nationalen Einheit bildete.1 Während der Zwischenkriegsjahre blieb das Vereinigte Königreich in zwei große Lager gespalten: eine defensiv agierende Konservative und eine reformistische Labour-Partei. Keine der beiden war stark genug, um effizient zu regieren.
Die politischen und sozialen Spannungen spitzten sich zu im Generalstreik vom Mai 1926. Obwohl die britischen Bergwerke an Ergiebigkeit eingebüßt hatten und Kohle sich infolge der Rückkehr zum Goldstandard schlechter verkaufte, forderten die Bergarbeiter bessere Bezahlung und mehr betriebliche Sozialleistungen. Premier BaldwinBaldwin, Stanley betraute ein spezielles Expertengremium, genannt Samuel-Kommission, mit der Lösung des Problems, die empfahl, die staatlichen Subventionen für den Bergbau zu streichen und die Bergarbeiterlöhne um 13,5 Prozent zu beschneiden. Entsetzt und empört protestierten die Gewerkschaften samt ihrem Dachverband, dem Trade Union Congress (TUC). Man rang bis zum Äußersten um einen Kompromiss, und nachdem dies gescheitert war, erklärte der TUC den Generalstreik. In dessen Verlauf wurden drei Millionen Arbeiter ausgesperrt, und das Transportwesen kam zum Erliegen. Da es Anarchie befürchtete, organisierte das Kabinett sofort Noteinsatzkräfte, Streikbrecher und spezielle Milizen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. Als Gerichte den anderen Gewerkschaften verboten, in Solidaritätsstreiks zu treten, blies der TUC den Generalstreik nach neun Tagen ab und nahm grollend die Lohnkürzung hin.2 Die Konfrontation zeigte, dass die britische Gesellschaft gespalten war zwischen einer laissez-faire-orientierten Mittelklasse und einer wachsenden Arbeiterbewegung, deren radikale Mitglieder von einer sozialen Revolution träumten.
Ein weiterer Konflikt, der sich ähnlich heftig gegen Lösungen sperrte, betraf die Zukunft Irlands. Dort brodelte ein hochentzündliches Gemisch aus Nationalismus, religiösem Fanatismus und sozialer Unzufriedenheit. Ausgelöst durch konfessionelle Feindseligkeit zwischen Protestanten und Katholiken und zusätzlich befeuert durch Spannungen zwischen nicht ortsansässigen Grundbesitzern und lokalen Arbeitern, bestritt die irische Unabhängigkeitsbewegung den Briten das Recht, über die grüne Insel zu herrschen. 1914 bewilligte ihr London endlich, wofür irische Patrioten wie Charles Stewart ParnellParnell, Charles Stewart jahrzehntelang agitiert hatten: die sogenannte home rule, eine weitgehende Selbstbestimmung. Nun durfte im Weltkrieg eine eigenständige Formation irischer Freiwilliger an der Seite Englands kämpfen. Aber als die radikalen Nationalisten sich Ostern 1916 erhoben, schlugen die Briten sie mit brutaler Gewalt nieder; dadurch verhalfen sie freilich der separatistischen Partei Sinn Féin und ihrer Kampagne für vollständige Unabhängigkeit zu noch mehr Popularität. Das Kernproblem war, was aus den sechs Grafschaften der nordirischen Provinz UlsterUlster werden sollte, in denen die Protestanten dominierten. 1921 handelte Lloyd GeorgeLloyd George, David den Anglo-Irischen Vertrag aus: Die 26 katholischen Grafschaften durften sich unter der Präsidentschaft von Éamon de ValeraValera, Éamon de zum weitgehend unabhängigen »Irischen Freistaat« zusammenschließen, der den Status eines dominion erhielt. NordirlandNordirland verblieb beim Vereinigten Königreich. Dies sollte sich zwar als realitätstauglicher Kompromiss erweisen, beseitigte aber nicht den Hass, den die Protestanten und Katholiken in UlsterUlster gegeneinander hegten und der noch jahrzehntelang für fortgesetztes Blutvergießen sorgen würde.3
Frankreich wiederum fand zwar sein Prestige durch den Sieg gesteigert; doch außenpolitische Schwierigkeiten und Konfusion im Inneren blieben auch ihm nicht erspart. Ruhm und Ehre hatten ihren Preis gefordert: 1,5 Millionen Tote und 3,5 Millionen Verwundete. Der Aderlass hatte eine Bevölkerung von rund 40 Millionen getroffen – Deutschland hatte damals 62 Millionen. Dieses relative demografische Defizit empfanden nationalistische Hardliner als Sicherheitsrisiko; wirksamen Schutz gegen ein wiedererstarkendes Deutschland könne es nur geben, wenn man auf der Erfüllung der Bestimmungen des Versailler Vertrages bis zum letzten Buchstaben bestehe. Dagegen suchten führende Köpfe der Linken nach einer flexibleren Strategie und empfahlen eine Annäherung an die Weimarer Republik, schon um die Belastungen zu mildern, die hohe Verteidigungsausgaben mit sich brächten. Die verwüstete Infrastruktur und die beschädigte Ökonomie mussten restauriert, zerstörte Wohnbauten in NordfrankreichNordfrankreich wiedererrichtet werden; all dies verursachte enorme Kosten, die sich nicht gänzlich auf die niedergeworfenen Feinde abwälzen ließen. Immerhin bewirkte die steuerliche Förderung des Wiederaufbaus einen Schub bei der industriellen Modernisierung. Ironischerweise bereitete Frankreich sogar der vielgefeierte Rückgewinn Elsass-LothringensElsass-Lothringen Sorgen, denn diese teilweise deutschsprachige Region wollte eine gewisse Autonomie gegenüber der Zentralregierung behalten, besonders in religiösen Angelegenheiten.4 Das Grundproblem, vor das ParisParis sich gestellt sah, war, wie es die Früchte des Sieges bewahren konnte, ohne sich dabei zu übernehmen.
Die Dritte Republik fand keine klare Lösung, denn dazu hätte es einer Mehrheit bedurft. Doch die entscheidenden politischen Kräfte im Land – hier die nationalistische Rechte, dort die internationalistische Linke – waren ungefähr gleich stark. Witzbolde behaupten seit jeher, die Franzosen trügen ihr revolutionäres Herz links, aber ihre Brieftasche rechts. Die nationalistischen Hardliner bildeten einen aus mehreren Splitterparteien lose gefügten »nationalen Block«, während die Reformisten sich zu einem »Kartell der Linken« zusammenfanden. Das parlamentarische Karussell brachte bald einen Vertreter der Unerbittlichen, bald einen Gemäßigteren auf den Premierstuhl. Der rigorose ClemenceauClemenceau, Georges, der insistiert hatte, dass die Bestimmungen des Versailler Vertrages unbedingt Strafcharakter haben müssten, wurde 1921 durch den versöhnlichen Aristide BriandBriand, Aristide ersetzt. Offenbar ging er zu sanft mit Deutschland um, denn schon ein Jahr später drängte ihn der Bellizist Raymond PoincaréPoincaré, Raymond vom Sessel. Nachdem sich dessen Reparationspolitik als Fiasko entpuppt hatte, gelangte 1924 der moderate Linke Édouard HerriotHerriot, Édouard an die Macht, doch bereits 1926 saß wieder PoincaréPoincaré, Raymond auf dem Sitz. Da es Letzterem gelang, eine akute Finanzkrise zu beheben, indem er den Franc abwertete, ließ man ihn bis 1929 regieren.5 Dieser rasche Wechsel an der Staatsspitze führte im Inland wie international zu einem Zickzackkurs, aufgrund dessen sich kein Mittel fand, um der inneren Zerstrittenheit und der strukturellen Schwäche des Landes abzuhelfen.
Vom Kriege geschwächt, ein dynamisches Deutschland als Nachbar – Frankreich hatte sehr zu kämpfen, um seine Hegemonie über den Kontinent zu bewahren. Mit der Oktoberrevolution war ihm ein verlässlicher Verbündeter, das zaristische Russland, abhandengekommen. Den neuen Machthabern traute das bourgeoise ParisParis nicht, da es fürchtete, der bolschewistische Virus könnte sich auch unter den eigenen Arbeitern verbreiten. Ferner sah Frankreich sich allein nicht in der Lage, die Einhaltung des Friedens zu erzwingen. Dazu bedurfte es der militärischen Rückendeckung der USAVereinigte Staaten und Großbritanniens, und ob die ihnen auf Dauer sicher war, erschien den Franzosen mit der Zeit immer zweifelhafter. ParisParis schaute sich nach Ersatzpartnern um und schuf ein Netz neuer Bündnisse, das Polen, die Tschechoslowakei, Jugoslawien und Rumänien einschloss. So entstand etwas, was als »Kleine Entente« in die Geschichte einging. Dieser geopolitisch kluge Schritt erwies sich freilich in der Folge als für Frankreich ziemlich teuer, denn die vier Partner verlangten massive Subventionen von ParisParis – schließlich mussten sie ja ihre Länder wirtschaftlich auf Vordermann bringen und militärische Schlagkraft entwickeln. Frankreich agierte generell glücklos: Selbst als es versuchte, die fristgerechte Entrichtung der Reparationen zu forcieren und sich dafür beispielsweise zur Ruhrbesetzung im Januar 1923 entschloss, ging der Schuss nach hinten los. Angesichts des »passiven Widerstandes« der Deutschen musste ParisParis erkennen, dass man mit Bajonetten keine Kohlen graben kann, und das Wagnis schließlich abbrechen. So strapazierte die Aufrechterhaltung der Dominanz die französischen Ressourcen bis an die Grenze der Belastbarkeit.6
Anstatt vielfachen Profits bereitete der Triumph im Ersten Weltkrieg den Siegerländern unerwartete neue Probleme. Immerhin verstärkte der Sieg im Westen die Empfindung, dass man mit der liberalen Modernisierung auf dem rechten Pfad sei, schließlich habe am Ende die Demokratie die Autokratie geschlagen. Man freute sich auch über mehr Territorien, neue Kolonien, höhere militärische Sicherheit und weniger ökonomische Wettbewerber. Doch daheim bestätigte der Sieg nicht nur die parlamentarische Regierung, sondern auch die kapitalistische Ausbeutung und die Klassenhierarchie; die Forderungen der Kriegsveteranen nach Ausweitung des Wahlrechts, mehr sozialen Reformen und mehr Gleichheit blieben unerfüllt. Zwar entwarfen die Friedensvereinbarungen eine neue internationale Ordnung, nämlich ein Miteinander demokratischer Nationalstaaten; aber sie perpetuierten auch bestimmte Feindseligkeiten aus Kriegszeiten, denn das Eintreiben der Vertragsleistungen sorgte wiederum für Konflikte und zog sich entsprechend in die Länge.7 Die Regelungen entfachten gewaltigen Unmut bei jenen, die sich von ihnen übervorteilt fühlten und daher kaum Neigung hatten, sie als einen konstruktiven Plan für die Zukunft Europas zu akzeptieren. Hochfliegende Hoffnungen verwandelten sich dergestalt in bittere Enttäuschung – sogar bei manchen Siegerstaaten, darunter besonders Italien.