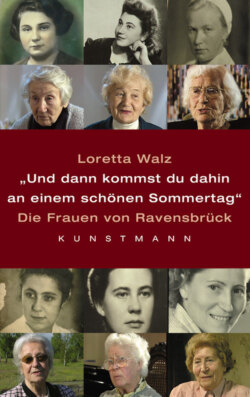Читать книгу Und dann kommst Du dahin an einem schönen Sommertag - Loretta Walz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Startpunkt Bundesrepublik
ОглавлениеDa die Sammlung in der (alten) Bundesrepublik Deutschland begann, richtete sich mein Blick anfangs auf die westdeutschen Überlebenden. Später weitete er sich nach Westeuropa aus und erst Anfang der neunziger Jahre auf die zu diesem Zeitpunkt bereits ›ehemalige‹ DDR und nach Osteuropa.
Während das Schicksal von Frauen in den KZ zunächst nur vereinzelt erforscht wurde, setzte Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre ein regelrechter Boom von Veröffentlichungen über die ›Frauengeschichte‹ der Konzentrationslager ein3. Die ersten Frauen, deren Erinnerungen an die Öffentlichkeit kamen, waren diejenigen, die in den politischen Verfolgtenverbänden (Lagergemeinschaft Ravensbrück und/oder Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – VVN) organisiert waren. Mit wenigen Ausnahmen waren auch die meisten meiner ersten – deutschen – Interviewpartnerinnen schon in ihrer Jugend Mitglied in kommunistischen Jugendorganisationen gewesen, später in der KPD und zum Zeitpunkt des Interviews in der DKP organisiert. Andere waren Mitglieder kirchlicher, sozialistischer oder sozialdemokratischer Organisationen. Ihr Engagement in der Frauen- oder Friedensbewegung brachte sie mit Journalisten und Journalistinnen, Filmemachern und Filmemacherinnen in Kontakt, die sich für die Veröffentlichung ihrer Erinnerungen einsetzten. Lehrer und Lehrerinnen begannen die Überlebenden der Konzentrationslager in Schulen und Volkshochschulen einzuladen; bei Seminaren – beispielsweise in Frauenzentren – berichteten sie von ihren Erfahrungen während des Nationalsozialismus.
Diese erste Gruppe von ›Ravensbrückerinnen‹, die in die Öffentlichkeit traten, bildeten die ehemals politischen Häftlinge, die wegen ihres Widerstands gegen den NS-Staat in Gefängnisse, Zuchthäuser und KZ eingesperrt worden waren. Sie hatten ihren Kampf ›Gegen das Vergessen‹, für ›Frieden und Freiheit‹ nie aufgegeben, doch ihrer ganz persönlichen Geschichte oftmals keine große Bedeutung beigemessen.
Doch die Nachkriegsgeneration (zu der auch ich gehöre) hatte lange genug Geschichte aus zweiter und dritter Hand vermittelt bekommen und wollte ›erlebte Geschichte‹ erfahren. Die Möglichkeit, diejenigen zu befragen, die aus eigener Erfahrung sprechen konnten, bot auch eine Chance, das Jahrzehnte währende Verschweigen der NS-Geschichte zu durchbrechen.
Als nun die Generation der Kinder und Enkel sie darum bat, aus ihrem Leben zu erzählen, sahen die Frauen in dem wachsenden Interesse an ihrer Geschichte einerseits eine Bestätigung ihres lebenslangen Kampfes. Andererseits mussten die Überlebenden vor dem Schritt in die Öffentlichkeit erst das Schuldgefühl überwinden, überlebt zu haben. Sie wollten, dass die Würdigung und auch die gesellschaftliche Anerkennung ihrer Verfolgung unbedingt einhergehen sollte mit der Würdigung derjenigen, die nicht überlebt hatten.
Entsprechend zurückhaltend und bescheiden und nur selten offensiv war der Weg der Überlebenden in die Öffentlichkeit.