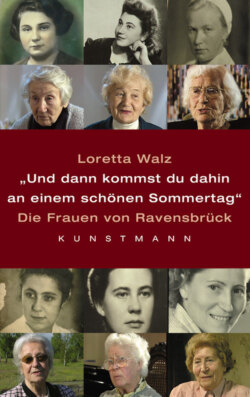Читать книгу Und dann kommst Du dahin an einem schönen Sommertag - Loretta Walz - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Frauen-Konzentrationslager
ОглавлениеBis zur Zeit der ersten Begegnungen mit Maria Zeh in den Jahren 1978/1979 hatte ich – damals 24-jährig – noch nie von der Existenz reiner Frauen-Konzentrationslager gehört. Zwar war ich in mehreren KZ-Gedenkstätten gewesen, doch hatten mich dabei weniger die Orte, sondern vielmehr die Menschen interessiert, die dort während der Nazizeit eingesperrt waren. Erst 1983 besuchte ich die Kleinstadt Moringen in der Nähe von Göttingen, wo sich von Oktober 1933 bis März 1938 das erste Frauen-KZ befand. Unfassbar war für mich die Lage des riesigen Gebäudekomplexes8 unmittelbar an der Hauptstraße der kleinen Stadt. Als Moringen – konzipiert für ca. 400 Häftlinge – nicht mehr ausreichte, um die inhaftierten Frauen aufzunehmen, wurde Ende 1937 das Frauen-KZ Lichtenburg eröffnet.
Maria Zeh, die im August 1938 in die Lichtenburg kam, gehörte zu den ersten Häftlingen in diesem neu errichteten Frauen-KZ. Ende 1938 waren dort ca. 800 Frauen eingesperrt. Das Lager verfügte anfangs über einen Lagerkommandanten, 26 Aufseherinnen, eine Ärztin, einen Arzt, eine Krankenschwester und vier Hilfsschwestern im Krankenrevier.9 »Im Revier hatten wir als Häftlinge eine große Macht. Man wusste ja gleich, wer Genossin ist, wer Verräter ist und so – da konnte man die Leute, die schwerste Arbeiten verrichten mussten, für ein paar Tage ins Krankenrevier stecken. Manche sind natürlich doch gestorben, weil sie wirklich krank und elend waren. Ich erinnere mich an eine Bibelforscherin. Der SS-Mann hat sie so gestoßen, dass sie aus der Nase geblutet hat. Da sagte sie: ›Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun.‹ Am andern Tag saßen wir bei unserem kärglichen Mahl, da kam die Oberin und sagte: ›Was Sie jetzt sehen, dürfen Sie niemandem sagen.‹ Sie hat uns ins Kellerverlies geführt, und da lag diese Bibelforscherin. Sie lag auf einem Betonbett. Das kann man nicht beschreiben, in dieser Uniform, die wir hatten, wir sahen ja gar nicht mehr wie Frauen aus. Wir mussten sie ausziehen. Sie war grün und blau am ganzen Körper, zusammengeschlagen, totgeschlagen. Da dachte ich, ich kann nicht mehr, hab gezittert und trotzdem gewusst: Das nützt niemandem, wenn ich jetzt zusammenbreche. Es muss ja weitergehen. Vor allem müssen die Kameradinnen wissen, was da unten geschieht. Obwohl die Aufseherin gedroht hatte, dass wir selbst da runter kommen, wenn wir darüber sprechen, hat man gleich den Genossinnen gesagt, was sich da unten abspielt. Das werde ich nie vergessen. Das lässt mich noch heute nachts aufwachen. Ich muss dann genau sehen, wo ich bin, weil es Dinge gibt, da kann man nicht mit Worten benennen, was da in einem vorgeht. Ich kann’s nicht. Es ist nach so vielen Jahrzehnten immer noch da, so tief sitzt das. Die Haftpsychosen haben wir einfach. Manchmal, am schönsten Tag, kann ich nicht aus dem Haus gehen, obwohl ich die Natur so liebe. Das sitzt so tief, dass ich die Wohnung nicht verlassen kann. Aber wenn man im Revier war, konnte man den Menschen helfen. Da konnten wir auch den Jüdinnen helfen. Wir haben Arznei und alles geklaut. Ich hatte den Schlüssel zur Apotheke, denn ich hatte das Vertrauen der Oberin. Sie hat mir gesagt, sie habe sich die Häftlinge anders vorgestellt. Man habe sie geworben, um den Abschaum der Menschheit zu bewachen, und nun war sie erstaunt über die ›Qualität‹ der Häftlinge.«
Maria Zeh konnte erreichen, dass andere Häftlinge, die eine medizinische Ausbildung hatten, zu ihrer Unterstützung ins Revier kamen. So auch die Ärztin Dr. Doris Maase.10 »Da hat das Leben wieder einen Sinn bekommen. Da waren wir ein Team und konnten helfen. Wir mussten mit einem Medizinkasten durch das Lager, und dabei wurden Verbindungen geknüpft. Die Jüdinnen wollten immer Alkohol und Medikamente. Ich war so jung, ich hatte noch nie Medikamente genommen, keinen Kaffee, keinen Alkohol; wir haben nicht geraucht, wir haben leicht gelebt, aber die waren das schon gewohnt.«
Erst beim Abtippen dieses Gesprächs wurde ich auf den erwähnten Alkohol aufmerksam. Ich fragte nach, und Maria Zeh erzählte, dass die Jüdinnen sich betäuben wollten, bevor sie zur Vergasung geschickt wurden. Deshalb habe sie den reinen Alkohol aus der Lagerapotheke gestohlen. Vor laufender Kamera wollte sie allerdings nicht darüber sprechen, weil sie fürchtete, dies könnte noch heute als kriminelle Handlung angesehen werden. Tausende Jüdinnen wurden vergast – und Maria Zeh hatte ein schlechtes Gewissen, geklaut zu haben? Dieser tiefgründige Ehrbegriff schien mir nahezu unverständlich. Allerdings erfuhr ich in diesem Zusammenhang auch, dass Maria Zeh im Alter schwer alkoholkrank war und ein gemäßigter Umgang mit Alkohol ihr große Disziplin abverlangte.