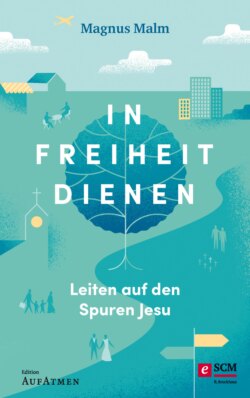Читать книгу In Freiheit dienen - Magnus Malm - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Ende der Flucht vor sich selbst
ОглавлениеBenedikt begründete im 6. Jahrhundert das westliche Klosterwesen. Als ein Ziel des klösterlichen Lebens beschrieb er, dass die Mönche sich im habitare secum, dem Wohnen bei sich selbst, üben sollten. Zur Hochzeit der großen durch die Völkerwanderung verursachten Umwälzungen in Europa bildeten die Klöster Inseln der Stabilität. So lautete auch das erste Versprechen eines jeden Mönchs: »Ich bleibe hier.«
Im Lauf der Zeit lernten die Brüder, auch innerlich anzukommen. Das gemeinsame Leben in Gebet und Arbeit verschaffte ihnen Zugang zu ihrem innersten Ich – dort, wo Gott nur darauf wartete, sie zu umarmen.
Aus ebendiesem Milieu kamen einige der wichtigsten Kirchenväter des Mittelalters. In vielen Erzählungen wird davon berichtet, wie die Mönche sich versteckten, wenn man sie zu Bischöfen machen wollte. Manchmal durften sie für eine gewisse Zeit ins Kloster zurückkehren, um sich von Machtrausch und falscher Prioritätensetzung zu erholen und zu sich selbst zurückzufinden.
Heute haben Exerzitien die gleiche Funktion für Gemeindemitarbeiter. Eine jährliche Woche der Stille, weitab von allen Aufgaben, wird für immer mehr Menschen eine unentbehrliche Gelegenheit zu Gebet und Reflexion. Dort kann man geborgen und ohne erhobenen Zeigefinger anderer einen Blick auf sich selbst und die eigenen Beziehungen werfen: zu Gott, zur Arbeit, zu anderen Menschen. Die Geborgenheit ist ausschlaggebend, damit man sich den eigenen Schwachpunkten und Verletzungen nähern kann. Mitten unter Menschen, die voller Kritik sind und einen mit ihren Anforderungen bedrängen, wird oft Verteidigung zur Überlebensstrategie: »Ich leugne und fliehe vor Problemen, die ich vielleicht ahne und auf die die Umgebung reagiert.«
In unserer Gesellschaft ist diese unentbehrliche Zurückgezogenheit von allen Seiten bedroht. Es geht hier nicht um aufgezwungene Einsamkeit und Mangel an engen Beziehungen, sondern um die Abgeschiedenheit, die notwendig ist, um überhaupt in guten Beziehungen leben zu können. Wenn Rückzug also eine Überlebensvoraussetzung für alle Menschen ist, gilt dies erst recht für diejenigen, die als Führungspersonen agieren sollen. Thomas Merton schrieb schon 1957:
Nicht alle sind zum Eremiten berufen, aber alle Menschen brauchen ausreichend Stille und Einsamkeit in ihrem Leben, damit sie wenigstens manchmal die tiefe innere Stimme ihres eigenen Ichs hören können. Wenn die innere Stimme nicht vernommen wird, wenn der Mensch nicht den geistlichen Frieden erreichen kann, den die vollständige Vereinigung mit dem inneren Selbst mit sich bringt, wird sein Leben immer unglücklich und erschöpfend sein. Niemand kann lange harmonisch leben, wenn er keinen Kontakt zu den Quellen des geistlichen Lebens am Grund der eigenen Seele hat.
Wenn der Mensch ständig aus seinem eigenen Zuhause ins Exil vertrieben wird, ausgeschlossen von seiner eigenen geistlichen Einsamkeit, hört er auf, wahrer Mensch zu sein. Er lebt nicht länger wie ein Mensch. Er ist nicht einmal ein gesundes Tier. Er wird zu einer Art Maschine ohne Freude, da er alle Spontaneität verloren hat. Er wird nicht länger von innen, sondern von außen gelenkt. Er fasst keine eigenen Beschlüsse mehr, sondern lässt für sich bestimmen. Er bewältigt nicht mehr seine Umgebung, sondern lässt sich von ihr bewältigen. Er wird von Kollisionen mit Kräften der Umgebung durchs Leben getrieben. Sein Leben ist dann kein menschliches Leben mehr, sondern wie eine Billardkugel, ein Wesen ohne Ziel und ohne tiefere sinnhafte Reaktion auf die Wirklichkeit.3
In unserer Flucht vor uns selbst ähneln wir in gewisser Weise politischen Flüchtlingen. Man spricht im Fluchtkontext von Push- und Pull-Faktoren. Push-Faktoren sind die Umstände in der Heimat, die einen Menschen zur Flucht treiben, Pull-Faktoren diejenigen, die ihn in ein anderes Land locken. Ich kann vor mir selbst fliehen, weil ich es aus irgendeinem Grund (der mir manchmal mehr, manchmal weniger bewusst ist) mit mir selbst nicht mehr aushalte. Das können zum Beispiel Schamgefühle und Verletzungen unterschiedlicher Art sein. Zu diesem inneren Chaos gesellen sich die ständigen Verlockungen der Umgebung, die mich zu Spannenderem oder Wichtigerem als der Beschäftigung mit mir selbst ziehen wollen.
So überlasse ich mein eigenes Haus dem Verfall. Vielleicht sogar im Namen Gottes: Ich wende mich von meinen eigenen Problemen ab, um stattdessen »Gott zu suchen«. Als ob ich ihn irgendwo anders finden könnte als dort, wo ich selbst bin. Augustinus sagte nach bitterer Erfahrung im Gebet: »Du warst im Inneren, und ich war draußen und suchte dich dort.«
Die Flucht vor unserem Inneren ist die Ursache für eine Reihe verschiedener Führungsprobleme. Natürlich spielen immer mehrere Gründe zusammen, aber ich wage dennoch zu behaupten: Eine tief greifende Erfahrung von Gottes Liebe würde einen großen Unterschied machen. Wenn sich ein Mensch nicht länger vor den eigenen inneren Abgründen in die Führungsetage flüchtet, dann findet eine tief greifende Heilung der ganzen Art und Weise statt, wie er andere führt. In der ältesten Biografie über Benedikt heißt es, er habe bei sich selbst wohnen können, da er »nur unter Gottes Augen lebte«.4
Vielleicht hilft es, ein paar der Probleme aufzulisten, denen wir gegenüberstehen, wenn wir vor uns selbst flüchten. Hinter vielen Problemen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, versteckt sich ein Mangel, dem in der Tiefe nur mit Quellen jenseits unserer menschlichen Ressourcen begegnet werden kann. Es kann hier um eine Führungsperson gehen, die:
• dominant ist – weil sie auf Grund ihrer Unsicherheit vorsichtshalber zu groß macht und damit alle anderen unterdrückt;
• kontrollierend ist – weil ihr die sichere Erfahrung fehlt, dass jemand anderes die Kontrolle hat, und deshalb alle Fäden selbst in der Hand hält;
• schwach und konfliktscheu ist und abweisend wird, sobald sie auf Widerstand stößt;
• ständig auf der Jagd nach Bestätigung ist, indem sie sich »interessant« macht;
• ergebnisfixiert ist und die ganze Zeit Belege darüber sammelt, dass »ich ein guter Leiter bin«;
• einsam und isoliert ist, gefangen in der Lüge, dass »ich nicht wert bin, in Gemeinschaft zu sein«;
• anhänglich und aufdringlich ist – weil sie Angst hat, mit ihrem schwarzen Loch aus Selbstverachtung allein zu sein;
• wie ein Fähnchen im Wind ist – weil sie ihren Mangel an Selbstwertgefühl mit den »richtigen« Ansichten und politisch korrekten Referenzen kompensiert;
• rigide ist – weil bei ihr das schwache Selbstwertgefühl ins Gegenteil umschlägt und in einem festen System aus Ansichten und Verhaltensmustern Schutz sucht;
• eifersüchtig ist und sich von der Stärke und dem Erfolg anderer bedroht fühlt (»Er hat alles, was mir fehlt«);
• arbeitssüchtig ist – weil sie durch ihre Arbeit ihr Selbstwertgefühl hochzuhalten versucht und es sich »nicht leisten kann«, Nein zu sagen;
• im Team und in der Führung cholerisch ist und Widerstand und Hinterfragen sofort als Angriff auf die eigene Person wertet (und damit die Sachfrage verdeckt);
• abhängig von einem Fanklub ist, Bewunderer und Ja-Sager sammelt, die sie bestätigen, während sie sich gleichzeitig von anderen distanziert;
• Kompetenzen hinterherjagt – weil sie das mangelnde Selbstwertgefühl und Vertrauen in die eigenen Erfahrungen mit der ständigen Teilnahme an neuen Kursen und Zeugnissen kompensiert;
• zu religiös ist – weil ihr brüchiger Selbstwert sich ständig nach einem Gott ausstreckt, vor dem man nie religiös genug ist;
• nicht religiös genug ist, denn jeder Schritt zu einem deutlicheren Bekenntnis würde zu viel Bestätigungsverlust von der Umwelt bedeuten;
• fordernd ist – weil das geringe Selbstwertgefühl von Gottesbildern und Theologien angezogen wird, die immer mehr fordern und damit die eigene Armseligkeit bestätigen.
Und so weiter. Der gleiche grundlegende Mangel an Liebe kann sich also in ganz gegensätzlichem Verhalten ausdrücken und in allen Biotopen der christlichen Landschaft auftauchen. Hier erweisen sich Stempel wie »konservativ« und »liberal« einmal mehr als unzureichend und irreführend. Wenn das Ich friert, zeigt sich, wie dünn das Feigenblatt ist, hinter dem wir uns als Führungspersonen so gern verstecken: die prestigevolle Ausbildung. Die Position, um die sich so viele beworben haben. Das Netzwerk mit all den »wichtigen« Führungskräften. Die neuste geistliche Bewegung. Die Statistik, die man lässig und diskret vor den Kollegen in einem Nebensatz erwähnen kann. Die richtigen Bücher, aus denen man bei passenden Situationen zitiert.