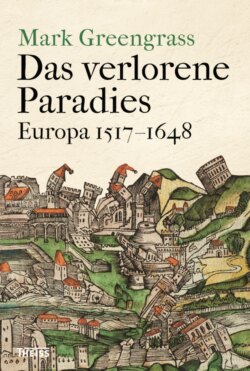Читать книгу Das verlorene Paradies - Mark Greengrass - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die christlichen Gemeinwesen im religiösen Konflikt der Nachreformationszeit
ОглавлениеDie Humanisten hatten die Idee eines „Gemeinwesens“ (res publica) populär gemacht, wobei jede Form legitimer Herrschaft ein solches Gemeinwesen sein konnte. Das war wichtig, weil es in Europa so unterschiedliche Herrschaftsformen gab. Neben dem Heiligen Römischen Reich und Erbdynastien gab es Wahlmonarchien, Stadtstaaten und Republiken. Christliche Gemeinwesen zogen ihre Legitimität aus der Beziehung zwischen Herrschern und Beherrschten, einer gegenseitigen Verpflichtung, in der der Gehorsam der Untertanen zwar natürlich und gottgewollt war, doch rechtens erst durch die Verpflichtung des christlichen Fürsten oder der Obrigkeit wurde, Gottes Geboten zu gehorchen und im Interesse des Volkes gerecht zu regieren. Ein Herrscher, der sich nicht daran hielt, war ein Tyrann. Die christliche Obrigkeit hatte die Aufgabe, die rechte Religion zu verteidigen, Recht zu sprechen und den Frieden zu fördern. Als Folge der Reformation entstand das grundlegende Problem, wie die widersprüchlichen Ziele, die sich aus dem religiösen Pluralismus für die Herrscher ergaben, in Einklang gebracht werden konnten. Wenn sie nicht die rechte Religion verteidigten, waren raison d’être und Einheit des christlichen Gemeinwesens bedroht. Taten sie es aber, riefen sie die Gefahr herauf, dass religiöse Spaltungen das Gemeinwesen zerrissen und Eintracht, Frieden und Harmonie – für seine Existenz ebenso wichtig – zerstört wurden. Die Herrscher vor allem in den mittleren Breiten Europas, wo religiöse Loyalitäten bis 1648 ein gewaltiges Problem darstellten, standen vor einem unlösbaren Rätsel. In Mitteleuropa waren die Risiken sektiererischer Gewalt am größten und wirkten sich religiös motivierte Spannungen gleich auf jeden Aspekt des öffentlichen und privaten Lebens aus. So unvorhersehbar und vielgestaltig, wie diese Spannungen waren, griffen sie auf andere, bereits bestehende Konfliktbereiche über. Sie manifestierten sich auf allen Ebenen der Gesellschaft und erwiesen sich für die Obrigkeiten in einem christlichen Gemeinwesen als besonders schwer zu handhaben. Religiöse Konflikte kompromittierten Regenten, indem sie sie zur Parteinahme für die eine oder die andere Seite zwangen. Das belastete die wechselseitige Verpflichtung (und das Vertrauen) zwischen Regent und Volk.
Die Rechtfertigung für das Christentum hatte darin bestanden, dass es ein Ensemble von Idealen und Institutionen zur Verfügung stellte, durch die der Frieden innerhalb der Glaubensgemeinschaft gefördert und verwirklicht werden konnte. In der nachreformatorischen Welt besetzte der religiöse Konflikt genau jene Stelle, wo zuvor der Brennpunkt für die Einheit des Christentums gelegen hatte. Was einst ein Mittel der Versöhnung gewesen war, wurde nun zum Instrument der Zwietracht. Die Welt wurde gefährlicher und gespaltener durch neue, erratisch verlaufende Glaubensgrenzen, die nicht, wie die einstigen Grenzen des Christentums, die Peripherie der Glaubensgemeinschaft markierten und sie von der Außenwelt absetzten, sondern deren Mitte durchzogen. Die neue Glaubensgrenze trennte diverse protestantische Denominationen im Norden vom Katholizismus im Süden und brachte damit christliche Gemeinwesen in Konfrontation zueinander. Im Bewusstsein der Menschen verschärften sich diese Trennungen in dem Maß, in dem widerstreitende religiöse Identitäten aus den gegenläufigen Prozessen der Reformation selbst entstanden.
Und es gab noch weitere Veränderungen, die die Eindämmung der religiösen Konflikte erschwerten. Zum einen veränderte sich das Wesen der Religion selbst. Die Reformation brachte eine Vielzahl von Glaubensrichtungen hervor, deren Anhänger jeweils mit voller Überzeugung argumentierten und Legitimität aufgrund einer behaupteten Kontinuität mit der Vergangenheit beanspruchten. In diesem Prozess wurde das Christentum ein umstrittenes Erbe, mit dessen Zerlegung die Humanisten bereits begonnen hatten, als sie ein von Verfall und Korruption gezeichnetes „Mittelalter“ aussonderten. In der neuen, von Vielfalt geprägten Glaubenslandschaft wurde „Religion“ (etikettiert als „rechte“, „reformierte“, „katholische“) zum Mittel, um wahre Glaubensüberzeugungen von falschen zu trennen. Religion konsolidierte sich immer weiter rund um das, was die Menschen, losgelöst von den religiösen Ritualen, die sie vollzogen, „glaubten“. Diese Loslösung zeigte sich am deutlichsten in dem zunehmend „konfessionalisierten“ Wesen von Religion in der nachreformatorischen Zeit. Die religiösen Konfessionen (Lutheraner, Calvinisten, Anglikaner) wollten definieren, was die Menschen zu glauben hatten – und wurden zum Fundament für riesige Investitionen in Bildung und Überzeugungsarbeit durch Kirche und Staat. Doch war es für beide schwieriger, Konformität für eine konfessionelle Ausprägung von Glauben durchzusetzen als zuvor für eine einheitliche Glaubensgemeinschaft, in der das Brauchtum (dessen Befolgung auch durch Nicht-Theologen leicht eingeschätzt werden konnte) die Glaubensüberzeugungen der betreffenden Individuen und Gemeinschaften widergespiegelt hatte.
Es gab in nachreformatorischer Zeit viele Orte, an denen religiöse Konformität sich nicht verwirklichen ließ. Christliche Fürsten fanden Gründe, innenpolitischen Frieden für wichtiger zu halten als religiöse Einheitlichkeit, weshalb religiöse Auseinandersetzungen mithilfe von Rechtsmitteln beigelegt werden sollten. Doch waren in den Augen ihrer konfessionellen Gegner solche Versuche, mit der religiösen Vielfalt zu leben, das deutlichste Zeichen für den endgültigen Verfall des Christentums. Derartiger Pluralismus könne nur in der Katastrophe enden. Indem sie die Probleme verwischten und ihrer Verantwortung nicht nachkamen, riskierten Herrscher, die den Pluralismus zuließen, nicht nur Gottes Zorn, sondern machten die unvermeidliche und ultimative Konfrontation umso gewalttätiger und zerstörerischer. Derlei Prophezeiungen neigten zur Selbsterfüllung. Es gab keine Lektion in religiöser Toleranz, die nicht verlernt werden konnte. Jede Generation musste von Neuem entdecken, wie gefährlich einfach es war zu glauben, die Verfügung religiöser Konformität sei der direkte Weg zur Lösung jener Probleme, die aus dem religiösen Dissens erwuchsen.
Die religiös motivierten Konflikte der nachreformatorischen Periode ließen die Einigkeit im Rahmen konfessionalisierter Glaubensüberzeugungen so wichtig erscheinen wie nie zuvor. Christliche Gemeinwesen sollten, so die Erwartung, konfessionelle Konformität als notwendige Bedingung für die politische Einheit durchsetzen und aufrechterhalten. Die mit der Reformation verbundenen kirchlichen Wandlungsprozesse (mitsamt der katholischen Reaktion darauf) veränderten die Beziehung zwischen Kirchen und Herrschern, wobei die „Geometrie“ dieser Beziehung höchst unterschiedlich ausfiel. In einigen Teilen des protestantischen Europas gab es Staatskirchen, in anderen Amtskirchen, die zum Staat eine eher lockere Beziehung unterhielten oder ganz unabhängig waren. Im katholischen Europa unterhielten Kirche und Staat eine Partnerschaft, in der es genügend Raum gab für gegenseitige Missverständnisse und Enttäuschungen. Im Allgemeinen jedoch erlangten die Staaten mehr Befugnisse über kirchliche Angelegenheiten, und damit einher ging eine größere Verantwortlichkeit für die Erhaltung der rechten Religion. Die Herrscher sahen sich nun häufiger Appellen seitens der Geistlichkeit ausgesetzt, die mit Nachdruck forderte, der Fürst solle seiner Pflicht nachkommen und den wahren Glauben fördern. Die Geistlichen verlangten vom Regenten, in umstrittenen Angelegenheiten – kirchlich-institutionelle Strukturen, Disziplin und sogar Glaubenssätze betreffend – zu entscheiden, während sie ihm zugleich den Vorwurf machten, er mische sich in Rechte und Besitztümer der Kirche ein. So geriet nicht nur die Beziehung zwischen Herrschern und Beherrschten mitsamt ihren gegenseitigen Verpflichtungen, sondern auch das Verhältnis von Kirche und weltlicher Obrigkeit unter Druck.
Solche Spannungen nahmen in dem Maß zu, in dem sich Rolle und Funktion staatlicher Macht veränderten. Das in ihrem Namen gesprochene Recht breitete sich aus und vereinnahmte auch lokale Rechtsverhältnisse. Die Herrscher erwarteten von ihren Ländereien und Untertanen höhere Steuereinnahmen. Veränderungen im Militärwesen demonstrierten der Bevölkerung die obrigkeitliche „Macht des Schwertes“ mit größerem Nachdruck. Ferner bestand ein erhöhter Bedarf an Spezialisten, um der komplexer gewordenen Aufgabe nachzukommen, das wirtschaftliche, soziale und öffentliche Leben rechtlich und administrativ zu kontrollieren. Von verschiedenen Seiten wurden Forderungen laut, das Steuersystem auf ein größeres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen auszuweiten, den Wirtschaftswettbewerb zwischen den Staaten zu fördern und soziale Disziplin wie auch moralische Konformität durch Staat und Kirche zu fördern. Zugleich wurde der Zusammenhalt in den lokalen Gemeinschaften schwächer, was die Loyalität der zuständigen Obrigkeiten beschädigte, bei denen bisher die Auffassung von einer gegenseitigen Verpflichtung zwischen Herrschern und Beherrschten am stärksten verwurzelt gewesen war.
Um 1600 waren die christlichen Gemeinwesen in Europa die politischen Überbleibsel des christlichen Ideals einer Glaubensgemeinschaft, und dabei durch die reformationsbedingten Spaltungen starkem Druck von innen wie außen ausgesetzt, verwundbar durch die explosive Mischung aus Religion und Politik. Selbst in jenen Gemeinwesen, in denen ein gewisses Maß an religiösem Pluralismus erreicht worden war, erwiesen sich die Ergebnisse als instabil, weil sie von einem ausgewogenen Kräfteverhältnis zwischen den Religionen abhingen. Das aber wurde auch durch die Argumente und Strategien all jener gefährdet, die religiöse Vielfalt grundsätzlich ablehnten. Wo die Mischung aus religiösen und politischen Zwistigkeiten zu Kriegen und Konflikten führte, wurde offenbar, wie schwach die Bande des Vertrauens zwischen den Völkern Europas und ihren Herrschern bereits geworden waren. Die ersten Zeichen demographischer und wirtschaftlicher Schwäche kündigten das nahende Ende des „silbernen Zeitalters“ an, was die Brüchigkeit des Vertrauensverhältnisses nur verstärkte.
In den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts gab es wieder ein gewisses Maß an Stabilität und damit eine momentane Erholung, was die Menschen zu der Vorstellung veranlasste, dass die grundlegenden Probleme der nachreformatorischen Politik wenn nicht gelöst, so doch wenigstens im Zaum gehalten werden konnten. Einige Herrscher waren ganz bewusst bestrebt, sich vom zentralen Wert eines christlichen Gemeinwesens – der gegenseitigen Verpflichtung von Herrschern und Untertanen, für das Gemeinwohl einzustehen – zu distanzieren. Sie beriefen sich auf die Tradition der theokratischen Monarchie, wonach der Regent nur Gott allein verantwortlich sei, und sahen sich selbst als Verkörperung der Geschicke des „Staats“ – ein konfessionell neutraler Begriff, der nun eine politische Gesamtheit bezeichnete. In dieser Hinsicht waren sie absolute Monarchen, und die Dynastie der Bourbonen, die ein nach den „Religionskriegen“ allmählich wiedervereintes französisches Königreich regierte, diente anderen Regenten als Vorbild. Ihrem eigenen Bekunden nach standen diese Herrscher über den fundamentalen Spannungen der nachreformatorischen Politik. Sie konnten Gesetze für die religiöse Uniformität erlassen oder den religiösen Pluralismus dekretieren, diplomatische Bündnisse unter oder ohne Berücksichtigung religiöser Spaltungen schließen – ganz so, wie es ihnen richtig und dem Wohl des Staates dienlich zu sein dünkte. Diese Form absoluter Herrschaft wirkte gerade in jenen Fürstentümern deplatziert, in denen die Idee eines christlichen Gemeinwesens inklusive der Vorstellung einer gegenseitigen Verpflichtung zwischen Herrscher und Untertanen noch lebendig war, beziehungsweise generell dort, wo sich die destruktivsten Kräfte der nachreformatorischen Auseinandersetzungen wenig bemerkbar gemacht hatten.