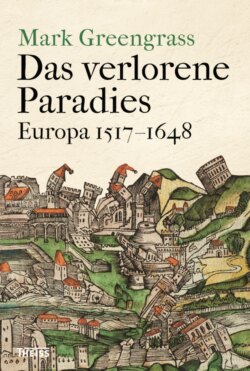Читать книгу Das verlorene Paradies - Mark Greengrass - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDer Holländer David de Vries war stolz darauf, die Welt gesehen zu haben. 1655 veröffentlichte er in seiner Muttersprache den Bericht über seine sechs Reisen, die ihn in die Welt des Mittelmeers, in den Fernen Osten, nach Neufundland, in die Karibik und nach Süd- und Nordamerika geführt hatten. De Vries war als Sohn holländischer Eltern 1593 in La Rochelle geboren worden. Er ließ sich zum Artilleriemeister ausbilden, beherrschte mehrere europäische Sprachen, war ein erfahrener Navigator, ein versierter Geschäftsmann, ein scharf beobachtender Autodidakt. Er trug keine Schuld daran, dass seine kolonialen Unternehmungen – am Delaware (damals South River; 1633), am Oyapock in Guyana (1634) und auf Staten Island (1638–1643) – sämtlich fehlschlugen. Von Sponsoren zugesagte Gelder blieben aus, der Umgang mit der indigenen Bevölkerung war schwierig, konkurrierende Unternehmen erwiesen sich als feindselig. De Vries wusste, wem er Loyalität schuldete. Seine Heimat waren die Niederlande, die Stadt Hoorn seine patria. Wäre es ihm gelungen, in Nieuw Nederland, das er häufig erwähnte, eine koloniale patroonschap – Herrschaft über Landeigentum – zu errichten, hätte er sie nach dem Modell der Güter des holländischen Landadels gestaltet. Er war ein Calvinist, der sich am Bau der ersten protestantischen Kirche auf Staten Island beteiligt hatte. De Vries begriff Europa als Teil der großen weiten Welt. Auf der Fahrt nach St. John’s in Neufundland bewunderte er die riesigen Eisberge, und nach der Ankunft im Jahr 1620 berichtete er von den Seglern aus Holland, dem Baskenland, Portugal und England, die in den Gewässern dort Fischfang und Handel trieben. Da er seinen Blick bereits vorab durch die Lektüre anderer Reiseberichte geschärft hatte, konnte er sich den Bräuchen der in Neufundland lebenden Indigenen anbequemen. Als er 1640 den Gouverneur der neuen englischen Kolonien am James River besuchte, wurde er mit einem Glas venezianischen Weins empfangen und nahm Platz neben einem englischen Kolonisten, der ebenfalls Ende der 1620er-Jahre die Ostindischen Inseln befahren hatte. De Vries berichtet von der angenehmen Unterhaltung mit dem Engländer, der bemerkte, Berge könnten einander nicht begegnen, wohl aber Männer, die auszögen, die Welt zu sehen.
Wie an ihrer Kleidung, ihren Essgewohnheiten und ihrem Betragen kenntlich, waren es Europäer, die sich der Tatsache, auf einem anderen Kontinent zu sein, bewusst waren, da sie (so de Vries) „die vier Ecken der Welt angesteuert hatten“. An der Laufbahn des Holländers zeigten sich die weiter gewordenen Horizonte seiner Generation, die dadurch sich bietenden Möglichkeiten und Herausforderungen, wurde eine außergewöhnliche Vielfalt von Kontakten und Kommunikationswegen sichtbar, die alte Loyalitäten und Zugehörigkeitsgefühle infrage stellte. Diese neue Auffassung von Europa als einer im Rahmen der weiteren Welt zu begreifenden geographischen Einheit wäre ein Jahrhundert zuvor noch nicht möglich gewesen. Im 16. und frühen 17. Jahrhundert verlor die ältere Vorstellung an Strahlkraft, die unter „Europa“ die „Christenheit“ verstand. Dieser Niedergang und die mit ihm einhergehenden tief greifenden Wandlungsprozesse sind Gegenstand dieses Buches.
„Christenheit“ beschwört, wie die Sage von Camelot, eine imaginierte Vergangenheit herauf. Im Mittelalter umriss der lateinische Ausdruck für „Christenheit“ – christianitas oder corpus Christianorum – etwas anderes, nämlich eine imaginierte Gegenwart und Zukunft für eine Welt, die durch die christlichen Glaubensinhalte und Bestrebungen vereint war. Diese Glaubensgemeinschaft trat hervor, während das Römische Reich im Westen seinem Untergang entgegenstrebte. Das Christentum, das in dessen Überresten Wurzeln schlug, befand sich anfänglich am westlichen Rand einer viel größeren christlichen Welt, deren Kerngebiet weiter östlich lag, dort, wo der Vordere Orient an das weiterhin aktive Oströmische (Byzantinische) Reich grenzte. Allmählich jedoch, und begünstigt durch wechselseitige Entfremdungsprozesse, trennten sich die Wege des westlichen und des östlichen Christentums, bis 1054 der Papst in Rom und der Patriarch in Konstantinopel einander gegenseitig exkommunizierten. Seit diesem tiefen Einschnitt bildeten die römischen Christen die westliche Christenheit, während sich in Griechenland, auf dem Balkan und in Russland das orthodoxe Christentum ausbreitete.
Im ersten Jahrtausend der Existenz einer westlichen Christenheit entwickelte sich das Christentum ohne genaue Auffassung davon, wo sein Zentrum lag, weshalb es auch keine Vorstellung von seiner Peripherie besaß. Es existierte (um die Ausdrucksweise eines ausgezeichneten Mediävisten zu benutzen) als eine Reihe von „Mikro-Christentümern“, die in ihrer Gesamtheit eine Art „geodätischer Kuppel“ aus in sich geschlossenen Segmenten bildeten. Der Handel mit „symbolischen Gütern“ (Reliquien, aber auch Menschen wie etwa Missionaren und Heiligen) trug das Charisma heiliger Macht von Ort zu Ort – und zugleich damit die Werte und Bestrebungen der Glaubensgemeinschaft von einem Segment zum nächsten. Im Hochmittelalter dann, nach dem Bruch mit dem Osten, entwickelte das westliche Christentum ein genaueres Gespür für das Verhältnis von Zentrum und Peripherie, indem sich zwei geographische und ideologische Einheiten deutlich herauskristallisierten: das Papsttum und das Heilige Römische Reich. Zuversichtlich baute man auf den Universalismus, während die jeweiligen Ansprüche im Wettstreit zwischen Theologen, Rechtsgelehrten, politischen Theoretikern und Intellektuellen formuliert wurden. Unterstützt wurde dieses Ideal durch die wirtschaftlichen Wandlungsprozesse jener Epoche: das beeindruckende Wachstum der Märkte und den interregionalen wie internationalen Handel, sowie durch die Heiratspolitik und die diplomatischen Bündnisse der Aristokratie. „Christentum“ war die Art und Weise, in der die gebildeten Zeitgenossen im 12. und 13. Jahrhundert die Welt der römischen Christen im westlichen Europa verstanden.
Für diese Glaubensgemeinschaft war die römisch-katholische Kirche die tragende Säule. Die geistigen Eliten des westlichen Christentums hatten sich um eine internationale Sprache (das Lateinische im Gegensatz zum Griechischen), ein gemeinsames Curriculum (das sich in Sachen Philosophie und Logik an den Werken des Aristoteles orientierte) und eine bestimmte Art des Lehrens und Lernens (die Scholastik) gebildet. Wie Macht in theokratischer und bürokratischer Hinsicht zu begründen, auszuüben und zu legitimieren sei, war päpstlichen Gesandten und Ratgebern von Fürsten gleichermaßen vertraut. Die Kreuzzüge wurden zum ehrgeizigsten Projekt des westlichen Christentums. Vor allem aber fand die lateinische Christenheit ihren Ausdruck in tradierten und regelmäßig praktizierten Glaubensriten, die sich jener bereits existierenden vieldimensionalen, geheiligten Landschaft aus Reliquienschreinen, Pilgerstätten, Heiligenkulten und Festlichkeiten einschrieben. Die Taufe war ein universeller Initiationsritus. Die nicht christlich Getauften – Juden und Moslems – lebten im Hochmittelalter in beträchtlicher Anzahl an den Rändern des westlichen Christentums und wurden genau deshalb toleriert, weil sie nicht der Glaubensgemeinschaft angehörten. Doch als christliche Königreiche die Grenzen des Christentums in Spanien und Süditalien weiter nach Süden ausdehnten, wurden sie zunehmend als bedrohliche Vertreter jener Mächte angesehen, die nicht zum Christentum gehörten.
Das Christentum fühlte sich schnell bedroht, doch waren seine gefährlichsten Feinde keineswegs die Nichtchristen. Wer an den Schalthebeln der Macht saß, hatte vor allem von ganz anderer und sehr heterogener Seite Unbill zu erwarten, nämlich seitens all derjenigen, die besondere, lokale Loyalitäten hegten, weswegen sie mit den übergreifenden Bestrebungen des Christentums wenig oder nichts anfangen konnten. Das westliche Europa war übersät mit Tausenden von Dörfern und Kirchspielen, deren Einwohner häufig genug ihren adligen Herren auf eine Weise verpflichtet waren, die sie zu Leibeigenen machte. Den universellen Ordnungsprinzipien von Kirche und Heiligem Römischem Reich (jenem mitteleuropäischen Herrschaftsgebilde, dessen Name seinen Anspruch ausdrückte, Nachfolger des Römischen Reichs und zugleich die zeitgemäße Form universeller Herrschaft zu sein) standen solche Bindungen entgegen. Neben den Landgemeinden gab es Städte, die vom Wirtschaftswandel des Hochmittelalters profitierten. Allerorten wurden Bürokratie und kosmopolitischer Ehrgeiz der international agierenden Ordnungsmächte mit Misstrauen betrachtet. Je stärker das Bewusstsein von Zentrum und Peripherie im Christentum wuchs, desto mehr Menschen ärgerten sich über die Zeit, die sie benötigten, um von höheren Stellen Genehmigungen für dieses oder jenes einzuholen. Viele waren es leid, die universelle Kirche durch Abgaben finanzieren zu müssen, und misstrauten dem aufgeblähten, übernationalen Projekt namens Kreuzzug. Ab dem 12. Jahrhundert wuchsen sich diese Gefühle zu Streitsucht oder gar Ketzertum aus, wobei Letzteres durch sein epidemisches Auftreten ein gravierendes Problem darstellte. Dies wurde gerade von denen, die sich den christlichen Idealen am stärksten verpflichtet fühlten, als Bedrohung empfunden.
Das Vertrauen in diese Ideale schwand dahin, als die europäische Wirtschaft infolge der Pest in die Krise geriet. Leibeigenschaft und Pflichten gegenüber den Herren wurden von den Abhängigen unter Verweis auf das, was sie ihr gutes, altes Recht nannten, infrage gestellt. Zwar bestanden die christlichen Glaubensformen und -praktiken fort, und die heiligen Wege und Stätten erblühten stärker als je zuvor, doch nahm die lokale Glaubwürdigkeit des Christentums in dem Maß ab, in dem es zum Gegenstand konkurrierender Ansprüche darauf wurde, die traditionelle Gesellschaftsordnung zu repräsentieren. Auch das „Abendländische Schisma“ (1378–1417) war der Idee universeller Loyalität abträglich. Da es nun zwei Päpste gab, teilten sich die Christen in solche, die Rom die Treue hielten, und andere, die das Avignoneser Papsttum unterstützten, wobei der Papst in Südfrankreich von seinen Feinden als Marionette an den Fäden einer spalterischen französischen Monarchie hingestellt wurde. Der Streit endete mit einem Kompromiss, doch war die moralische Autorität des Papsttums dauerhaft beschädigt. Nunmehr traten auch die Gefahren eines Bündnisses zwischen unzufriedenen lokalen Kräften und den Vertretern einer neuen säkularen, jedoch nicht ans Reich gebundenen Macht zutage, denn der Kompromiss war mittels der Autorität eines ökumenischen Konzils zustande gekommen. Ein Konzil nährte die – für Theokraten und Bürokraten besorgniserregende – Auffassung, eine solche Versammlung stehe über dem Papst. Dergleichen war schon zwei Jahrhunderte früher erörtert worden, wurde jetzt aber mit größerem Nachdruck vorgetragen. Die Idee war ihrem Wesen nach radikal, obschon die meisten „Konziliaristen“ gemäßigt waren und das Konzil nur als Möglichkeit sahen, auf angenehme Weise aus einer Zwangslage herauszukommen. Keineswegs begriffen sie es als Mechanismus zur Zerstörung der päpstlichen Universalmonarchie und schon gar nicht als Möglichkeit, auf unorthodoxe Weise Lehrautorität zu erlangen. Genau das aber erreichte die Reformation als implizite Erbin der Konzilsbewegung.
Somit lautete die zentrale Frage in der europäischen Geschichte des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, was mit dem Christentum geschehen würde – mit den Institutionen, die sein Gravitationszentrum bildeten und, mehr noch, mit der Glaubensgemeinschaft, die sein Fundament darstellte. Was sollte, wurde das Christentum zerstört, an seine Stelle treten? Es setzte ein Prozess ein, in dem das Christentum zunehmend hinter Europa (hier verstanden als geographischer Begriff in einem Verhältnis der Distanz zu anderen Weltteilen) verschwand. „Christentum“ und „Europa“ unterschieden sich grundlegend: Ersteres erhob Anspruch auf die Treue all derer, die mit der Taufe Angehörige der Glaubensgemeinschaft geworden waren und ihr Verhältnis zur äußeren Welt dementsprechend gestalteten. Europa dagegen beanspruchte keine Einheit, die über die von ihm repräsentierte geographische Landmasse und ein zunehmendes Bewusstsein moralischer und zivilisatorischer Überlegenheit der hier beheimateten Staaten und Völker hinausgegangen wäre. Das westliche Christentum war ein großes Projekt, das auf die europäische Einheit zielte und ein Jahrtausend brauchte, um zur Reife zu gelangen – während seine Zerstörung sich ebenso schnell wie vollständig vollzog. Nach kaum mehr als einem Jahrhundert war von diesem Projekt nur noch der Traum übrig geblieben. Gewaltige Kräfte vollendeten das Zerstörungswerk und veränderten Europa von Grund auf. Ihr Zusammenspiel steht im Mittelpunkt des ersten Kapitels.