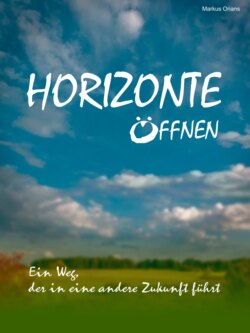Читать книгу HORIZONTE ÖFFNEN - Markus Orians - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.1 Macht der Konzerne
ОглавлениеNach dem Zusammenbruch der kommunistischen Systeme weltweit, stand der Markt, vor allem der spekulative Finanzmarkt über den legitimierten demokra-tischen Systemen. Die Märkte versprachen durch ihre Globalisierung: Wohlstand, Wohlfahrt, bessere Lebensqualität, neue Arbeitsplätze und die demo-kratisch legitimierten Politiker unterstützten sie, wo immer sie konnten. Was ist aus diesen Sprüchen geworden? Stattdessen leben wir in einer immer mehr ver-unsicherten und gespaltenen Gesellschaft. Millionen können sich ihres Arbeits-platzes nicht mehr sicher sein. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Seit 2008 stecken wir in einer Krise, deren Ende nicht zu erkennen ist. Sie begann als Immobilien und Finanzmarktkrise. Es folgten die Bankenkrise, die Konjunkturkrise, die Schuldenkrise und jetzt wieder die Ban-kenkrise. Ganz nebenbei hat sie ganze Länder ergriffen, die vor dem Bankrott stehen: Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, Belgien, selbst Frankreich wackelt.
Die traditionellen Wirtschaftswissenschaften haben nicht zu dem allgemeinen Wohlstand geführt, den uns die Herren Locke und Smith versprochen haben. Weder haben sich die Armut und der Hunger in der Welt entscheidend verringert, noch ist die Verteilungsungerechtigkeit beseitigt worden. Aber es gelingt den wirtschaftlich Mächtigen uns immer wieder einzureden, dass das Paradies für alle auf Erden durch diese Art der Ökonomie noch kommen wird. Wir bräuchten nur Geduld...
Aristoteles von dem der Begriff „oikonomia“ stammt, verurteilte noch das Streben nach Reichtum und Profit, da es dem Glück des Menschen im Wege steht. Die oikonomia sollte eine dienende Rolle haben und dem Staat und dem Gemeinwesen dienen. Auch Thomas von Aquin hat im 13. Jahrhundert die Ökonomie eng mit Moral, Tugend und Gerechtigkeit verbunden, weil sie sonst den Frieden in der Gemeinschaft stört. Adam Smith forderte dagegen im 18. Jahrhundert ein Wirtschaftssystem, das sich vollkommen frei von staatlichen Eingriffen entwickeln soll. Der Mensch soll nach seinem Eigennutz leben und nach Profit und Wohlstand streben. Er glaubte, dass aus diesem Egoismus alle Menschen profitieren würden. Seither leben wir nach dem Menschenbild der klassischen Ökonomie, dem „homo oeconomicus.“ Es ist der Mensch mit den unbegrenzten Bedürfnissen. Er denkt nur an sich und deshalb ist diese Ent-scheidung nicht nur für den Markt sondern auch für die Allgemeinheit optimal. Die Tauschakte des Marktes führen immer zum Optimum für alle Partner, weil alle Partner gleichberechtigt sind und streng rational entscheiden. Hieraus entstand die Konsumentensouveränität. Das heißt kein Staat darf in diese Souveränität eingreifen. Der Markt besteht aus lauter Einzelinteressen. Jenseits dieser Einzelinteressen gibt es keine Gesellschaft. Adam Smith hat diese Normen aufgestellt und die Bürger haben mit Freuden diese Vorstellungen umgesetzt. Für neoliberale Ökonomen oder Denker gilt dies mit Abstrichen bis heute. Hier begann der Siegeszug des Individuums, das Selbstinteresse und der Niedergang des Gemeinschaftssinns. Smith war auch Moralphilosoph, hatte auch ethische Vorstellungen und stellte den Gemeinsinn und den Wohlstand für alle über das Einzelinteresse. Einerseits werden diese Ideen von Smith wie Fahnen von den Großkonzernen vorhergetragen, aber die Moral oder der Gemeinschaftssinn ist dabei verloren gegangen. Soziale, gemeinschaftliche, demokratische Werte werden von einigen mächtigen Konzernen und ihrer starken Lobby gemindert oder bekämpft. Raubtierkapitalismus, das heißt eine Marktwirtschaft, die fern von einer allgemeinen Moral, fern von Ethik ist, ist spätestens seit der Globa-lisierung, etwa mit dem Untergang des östlichen Kommunismus, entstanden. Man könnte es auch umdrehen und sagen, es gibt schon eine Moral, nämlich die des Raubtiers. Selbst dieser Vergleich hinkt. Wenn ein Raubtier satt ist, jagt es nicht. Konzerne sind nie satt, ihnen reicht es nie. Sie sind immer auf der Jagd. Demokratie und Raubtierkapitalismus gehen immer weniger zusammen. Der Kapitalismus treibt die Demokratie durch die Macht der Reichen und Techno-kraten immer mehr aus unserem Gesellschaftssystem hinaus. Nicht umsonst ist das Wachstum des Marktes in China am höchsten. Wir kommen immer schneller an einen Punkt, der zeigen wird, was uns wichtiger ist: Diese Art von Konsum, von Ökonomie, von Finanzwirtwirtschaft oder eine demokratische und nachhal-tige Entwicklung, die auch an das Wohl kommender Generationen denkt.
Im 19. Jahrhundert gab es Kaufleute von Ehre z. B: die Buddenbrooks, schreibt Joachim Röhrig in „Kleine Weltgeschichte.“ Man musste auch knallhart kal-kulieren und abwägen, aber Vertrauen war damals noch die Basis für Geschäfte. Manager wechseln heute alle paar Jahre den Konzern. Verantwortung kann da nicht aufkommen. Der Vorstand will möglichst schnell hohe Gewinne erzielen. Die Gewinne werden an die Aktionäre weitergeleitet und nicht für eine bessere Situation der Lohnarbeiter oder ein nachhaltige Produktionsweise verwendet. Die Arbeiter werden wie Dinge, wie Schachfiguren behandelt. Wenn man sie nicht mehr braucht, dann kann man sie opfern. Hohe Gewinne heißt, wenn es hohe Gewinne geben kann, dann kann es sicher noch höhere Gewinne geben und das heißt fast immer Entlassungen und für die Menschen Arbeitslosigkeit mit all ihren Konsequenzen. Wie bei Nokia. Nokia bekam von der EU und der Bundesregierung mehr als 80 Millionen Euro damit Arbeitsplätze entstehen. Wenige Jahre später 2008 zog Nokia nach Rumänien, trotz guter Auslastung und Gewinne. 2300 Festangestellte und 1000 Leiharbeiter waren betroffen. Grund: Die Lohnkosten seien zehnmal höher als in Rumänien. Es gab Protestaktionen, Demonstrationen, Menschenketten ums Werk, alles blieb erfolglos. Jetzt 2011, knapp drei Jahre später wird auch das Werk in Rumänien geschlossen. Nokia zieht nach Asien, weil dort die Menschen für noch weniger Geld arbeiten. Staaten, ja selbst die EU ist machtlos gegen diese Art Rücksichtslosigkeit, Gewalt und Ignoranz gegenüber der Gemeinschaft. Im Gegenteil, dies sind „Werte“, die dieses System tragen, sie sind immanent und gehören zum System, zu unserem „demokratischen“ System. Die Konzerne ziehen dorthin, wo die Menschen die geringsten Löhne fordern und am längsten arbeiten. Der globale Konzern Zirkus zieht dorthin, wo sich die Menschen am meisten ausbeuten lassen. Der Mensch als Ware. Der Arbeiter wird nicht als soziales Wesen behandelt. Für Nokia und ähnliche Kon-zerne sind Menschen, Ware, Dinge ohne Gesichter, Herz und Gefühl. Das Lebendige, Gefühle werden einfach reduziert. Sie, die Manager haben einen Auftrag, nämlich Gewinne zu machen und was das für die Menschen heißt, wird einfach verdrängt. Dieses emotionslose Verhalten erinnert mich stark an Adolf Eichmann im National-sozialismus, der nur einen Befehl ausgeführt hat und deshalb, so meinte er, dafür auch keine Verantwortung zu übernehmen bräuchte. Wenn durch die Erfüllung des Auftrags dann Millionen Juden sterben müssen dafür kann er nichts. Ein Manager kann auch nichts dafür, dass er einige tausend Menschen auf die Straße schickt, so sind nun einmal die kapitalistischen Gesetze, jeder ist sich selbst der Nächste. Gefühle, ein soziales Gewissen, moralisches Denken ist wie Hannah Arendt bei Eichmann feststellte mit dem „Weltverlust“ verschwunden. Die „Banalität des Bösen“, die Nichtverantwortung ist natürlich nicht vergleichbar, aber das grundsätzliche, emotionslose, inhumanistische, fast maschinenartige Verhalten solcher Menschen erinnert mich an Adolf Eichmann, wie er fast teilnahmslos jede Verantwortung von sich schob und das macht Angst. Die Haltung, dass der Mensch nach den Marktgesetzen nur eine Ware ist, ist systemimmanent. Wenn man genau hinschaut ist der Manager, der die Men-schen entlässt genauso eine Ware, nur mit einem anderen Gehalt ausgestattet. Der Kapitalismus „züchtet“ Menschen das soziale Gewissen weg. Moral, Ethik, Verantwortung für andere, denen man dadurch schadet, haben in der Welt des Kapitals im 21. Jahrhundert keinen Platz.
Lächerlich würde Andre´ Sponville wahrscheinlich hierzu sagen. Für ihn ist der Kapitalismus weder moralisch noch unmoralisch. Er ist amoralisch, das heißt weder noch. Der Sinn des Kapitalismus ist der Gewinn. Hier wird nicht nach Moral gefragt. Ein Unternehmer, ein Manager hat dafür zu sorgen, dass die Aktionäre, also die Besitzer einen größtmöglichen Gewinn bekommen. Ich kann dazu nur sagen: Er hat recht, ich aber auch.“ Legal, illegal, egal, die Hauptsache Gewinn. Im November 2011 gibt Siemens einen Rekordgewinn bekannt, mit der Mitteilung, dass man die Belegschaft verkleinern muss. Die paar hundert Aktionäre, die in ihrer Gier einfach noch mehr Gewinne möchten, bestimmen dieses Handeln. Und wir, die Occupy- Bewegung spricht von den 99 %, lassen es uns noch gefallen. Wir haben uns längst an diesen Raubtierkapitalismus gewöhnt.
In den letzten 60 Jahren haben sich Gesellschaft und Wirtschaft im Sinne von Konzernlenkern entwickelt. Die Wirtschaft ist mittlerweile in fast allen Kulturen die stärkste und mächtigste Kraft im Staat geworden. Die weltläufigen Ver-flechtungen der Konzerne treiben die Politik vor sich her. Die Politik ist für die Großkonzerne dazu da, um für die Wirtschaft günstige Bedingungen zum Wachstum zu schaffen. In diesem globalen Spannungsfeld entstehen auch gigantische Migrationsströme mit immer größer werdenden sozialen Konflikten.
Viele Lenker in der globalen Wirtschaft glauben, dass dies so weiter gehen kann. Warum sollten sie denn ein anderes Denken und Verhalten zeigen, wenn es ihnen doch damit so richtig gut geht und sie auch in ihrem jetzigen Denken so tatkräftig von der Politik unterstützt werden? Der mangelnde Veränderungswille, dieser blinde Glaube, alle Probleme würden sich schon irgendwie durch „die helfende Hand“ (Smith) lösen lassen, wird von den meisten Politikern, trotz besseren Wissens noch mitgetragen. Dieser Glaube herrscht aber auch bei vielen Konsumenten vor.
2011 werden große Teile der Weltwirtschaft von 147 Konzernen kontrolliert. Besonders dominant sind auch hier die Unternehmen aus dem Finanzbereich, also Banken und Rentenfonds. Die Britische Barclays Bank ist am ein-flussreichsten. Die Deutsche Bank liegt an der 12. Stelle. Bei einer Untersuchung 2007 wurden insgesamt 43 000 Unternehmen untersucht.1318 von ihnen waren an mindestens zwei weiteren Unternehmen beteiligt. Im Durchschnitt waren diese Firmen mit 20 anderen Unternehmungen verbunden. Diese Unternehmen erzielen auf Grund ihrer gegenseitigen Anteilshabe 4/5 der Umsätze von diesen internationalen Konzernen. Die 147 Konzerne bilden ein in sich geschlossenes System und kontrollieren sich über ein ungemein kompliziertes System selbst. Diese 147 Konzerne machen weniger als 0,4 % dieser 43 000 Firmen aus, kontrollieren aber von den 43 000 Firmen über 40 %. Der Kreis der allermäch-tigsten Unternehmen wird dann noch einmal von 50 Unternehmen angeführt: Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen. 37 dieser Super-Einheit sind Finanzfirmen. Die Politik kann in dieses Netzwerk kaum eingreifen, weil die Konzerne international vernetzt sind und die Länder gegeneinander ausspielen. Regulierungen und Kontrolle gibt es auch deswegen so gut wie nicht. (Daniel Baumann, Berliner Zeitung, 25.Okt. 2011). Da kann man sich nur fragen, von wem werden wir tatsächlich regiert? Wer blickt bei dieser Machtvernetzung überhaupt noch durch.
Ein Beispiel über die bisherige Machtlosigkeit der Politik, Interpol und der UN. Am 24. September 2011 lief in 3sat unter dem bezeichnenden Titel „Blutsauger der Dritten Welt“ ein Dokumentarfilm. In der Schweiz tragen Rohstoffhändler genau-so viel zum Bruttoinlandprodukt (BIP) bei, wie der gesamte Maschinenbau. Hauptsächlich sind es 4 Firmen: Glencare, Trafigura, Xstrata und Mercuria. Glen-care ist die umsatzgrößte Firma in der Schweiz. Glencare hat sich unter anderen afrikanischen Staaten auch in Sambia eingekauft. Von den Gewinnen bleiben „5 %“ in dem Land. 95 % kassieren hauptsächlich diese 4 Firmen aus dem Aus-land. Hauptsächlich kassieren diese ärmlichen 5 % dann noch korrupte Re-gierungsbeamte und nicht das arbeitende Volk. Die Gewinne der Firma werden aber weder in Sambia noch in der Schweiz, sondern in Steuerparadiesen ver-steuert. Im Gegensatz dazu Norwegen. Wenn in Norwegen eine Firma Rohstoffe fördert, bleiben über „70 %“ der Gewinne im Land.
Noch ein anderes Beispiel, wohin die Globalisierung führen kann. Unter „Schmutziger Schokolade“ habe ich online einen Dokumentarfilm herunter-geladen, der am 6. Oktober 2010 im 1. Programm lief. Bis zum Jahre 2001 war es selbstverständlich, dass in Kakao Plantagen Kindersklaven arbeiteten. Die UN schritt ein und arbeitete mit den großen Firmen: Saf-Cacao, Nestle und anderen einen Vertrag aus, der diese Sklaverei verbieten sollte. Den Firmen gelang es den Vollzug des Vertrages bis 2008, also sieben Jahre hinauszuzögern. 2010 war ein Reporter an der Elfenbeinküste, wo 42 % aller Kakaobohnen geerntet wer-den. Er stellte fest, dass überall in den Plantagen Kindersklaverei selbstver-ständlich ist. Die Kinder werden aus Mali, Bukino-Faso, Niger, Togo und Benin zum Teil gekidnappt und zum Teil dadurch gelockt, dass man ihnen verspricht, dass sie Geld für ihre armen Familien verdienen können. Es gibt es riesiges Netz von Kinderhändlern, denn die Kinder werden von den Kidnappern an Busfahrer weiterverkauft. Diese verkaufen sie dann an „Sklavenhändler“ weiter, die sie über die Grenze schmuggeln, bis sie endlich für ca. 230 Euro dann an die Farmer verkauft werden. Die Kinder sind in der Regel zwischen 11 und 12 Jahren alt, bekommen keinen Lohn, werden geschlagen und viele werden durch die üppigen Pestizide krank. Interpol hat kaum eine Chance hier einzugreifen, weil Re-gierungsbeamte und die Polizei genauso wie viele andere Menschen in diesen Sklavenhandel verwickelt sind. Zynisch könnte man sagen, der Sklavenhandel hat viele Menschen aus der Arbeitslosigkeit herausgeführt.
Doch der noch größere Skandal sind die Firmen vor allem Nestle, eine Weltfirma, die seit über 50 Jahren Geschäfte mit der Elfenbeinküste macht und dabei einen Umsatz von 70 Milliarden Euro im Jahr hat. Der Farmer bekommt für 1kg Kakaobohnen, aus denen dann 40 Schokoladentafeln hergestellt werden, einen Euro. Und Nestle und die anderen Firmen dulden den Sklavenhandel noch immer.
So mancher wird sich schon gewundert haben, wie billig bei uns T-Shirts oder Kleider z.B. aus Indien sind. Die Antwort ist für alle schmerzhaft, die noch ein soziales Gewissen haben. In Südindien gibt es mehrere Städte, die hauptsächlich aus Textilfabriken bestehen. Tyrapur ist eine solche Stadt mit etwa 500 000 Einwohnern. Zu den Fabriken gehört eine Art Lager, Haus an Haus. In jedem Raum sind zumeist 7 Mädchen eingesperrt. Sie schlafen auf dem nackten Boden und bekommen ungenügend zu essen. Auch dürfen sie das Fabrikgelände nur mit männlichen Aufpassern verlassen und mit niemandem außerhalb dem Fabrikge-lände sprechen. Die Mädchen sind in der Regel jünger als 18 Jahre. Das Verbot mit der Kinderarbeit wird mit ärzlichem Attest umgangen. Die Eltern der Mädchen haben einen sogenannten „Sumangali Vertrag unterschrieben. Dieser Vertrag besagt, dass das Mädchen zwischen drei und vier Jahren in der Fabrik arbeiten muss. Pro Tag bekommt es 65 Cent und einmal im Monat ein Taschengeld für ein Euro. Am Ende dieser drei Jahre soll das Mädchen dann 1300 Euro bekommen. Wird es krank, muss es trotzdem arbeiten. Ein Arzt gibt es nicht. Zwischen 12- 16 Stunden 6X die Woche. Wenn ein Mädchen das tägliche Soll nicht schafft, wird es geschlagen und beschimpft. Alles durch Männer. Kann es nicht mehr arbeiten, was oft vorkommt, weil die Arbeitsumstände katastrophal sind, wird es einfach ohne Geld auf die Straße gesetzt. Das dortige Krankenhaus bestätigte, dass im Schnitt jeden Tag ein Mädchen, meistens mit Gift oder auch mit Selbstanzünden einen Selbstmordversuch unternimmt. Im Jahre 2011 hat es 800 Selbstmorde gegeben. Ein Kamerateam des ZDF versuchte in das Lager zu kommen. Fast alle Filmaufnahmen wurden mit ver-steckter Kamera gemacht. Sie durften mit keinem der Mädchen, die hinter einem dreifachen Stacheldraht eingesperrt sind, sprechen. Es gibt kaum ein Mode-Label, das aus Südindien keine Textilien bezieht. Ob H&M oder C&A, Tom Taylor oder die spanische Firma Zara. Sie wissen alle um diese kaum zu beschreiben-den Zustände, dass Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren als Sklavinnen auf Zeit arbeiten. Es sollen etwa 120 000 Mädchen sein. Alle Firmen sagen, dass sie soziale Standards mit diesen Textilfirmen vereinbart hätten. (ZDF Zoom, online, 29. März 2012). Wer trägt für diese Verbrechen die Verantwortung? Die indischen Textilfirmen, die indische Regierung, die europäischen oder amerika-nischen Firmen, an die der Stoff und die Kleider verkauft werden, oder wir die Verbraucher, die so billig wie möglich einkaufen wollen?? Wer könnte dieses Leid beenden? Warum tut es bisher niemand? Terres de Hommes kennt diese Zustän-de schon lange und hat spätestens 2007 die Mode Labels informiert.
Diese Dokumentationen zeigen eine der schlimmsten Auswirkungen des Kapita-lismus, der Globalisierung. Die andere Seite der Freiheit. Die Freiheit des Neo-Liberalismus. Eine Freiheit, die zur Sklaverei auch in sogenannten Demokratien führen kann!
Die Auswirkungen der Globalisierung zeigen sich gerade bei den Lebensmitteln. 30 Supermarktketten kontrollieren ein Drittel des gesamten Lebensmittelhandels. 350 Menschen besitzen die Hälfte des gesamten Reichtums auf der Welt, während ein Großteil der Menschen mit 2 Euro am Tag auskommen müssen. 1960 verdiente ein Unternehmenschef das 40fache seiner Angestellten, heute hat er durchschnittlich 531 Mal so viel. Die 100 größten Volkswirtschaften sind nicht die 100 größten Länder, sondern nur 48 Länder befinden sich darunter. 52 davon sind Großkonzerne. Von 65 000 internationalen Konzernen mit ihren 850 000 Tochterfirmen nehmen zwischen 2000 3000 Firmen an selbstverpflichtenden sozialökonomischen „Mindeststandards“ teil. Das ist zwischen 3 und 4 Prozent. Seit der Globalisierung haben sich 2 Agrogiganten so entwickelt, dass sie 65 % des Saatgutes vertreiben. Aus 3000 Reissorten früher sind heute noch 30 Sorten übrig geblieben. Bauern in Indien müssen das Saatgut, was zwar von ihren Äckern stammt, ihnen aber nicht mehr gehört, bei diesen Giganten für teures Geld einkaufen.
Konzerne haben mehr Geld zur Verfügung als Staaten. Weil der Staat immer weniger Geld zur Verfügung hat, auch weil es keine Vermögenssteuer mehr gibt und die Erbschaftssteuer mit die niedrigste ist, die es überhaupt gibt, hat der Staat nicht nur Schulden gemacht, sondern auch nach und nach sein Tafelsilber verscherbelt. Dabei wurde durch die Privatisierungen der Post, des Stroms, der Wasserversorgung, des Mülls versprochen, dass alles billiger wird. Alles, aber wirklich alles ist nicht nur teurer sondern weniger verlässlich, reduzierter und vor allem unübersichtlicher geworden. Bedenklicher ist aber noch, dass 10tausende prekäre Arbeitsplätze hieraus entstanden sind. Arbeitsplätze, wo Menschen 40 Stunden arbeiten, davon aber nicht leben können. Mittlerweile gibt es nahezu 2 Millionen Menschen, die 5 Euro oder sogar weniger in der Stunde verdienen. Dazu kommen noch etwa 5 Millionen Arbeitskräfte, die trotz Fulltimejob weniger als 1000 Euro im Monat verdienen. Es sind mehr als 20 % der Arbeitskräfte in Deutschland, die weniger als 1000 Euro im Monat verdienen Diese Zahl wächst zurzeit monatlich. 20 Staaten in der EU haben Mindestlöhne eingeführt. Das reichste Land, das christliche Deutschland hat eine christliche Regierung und lehnt bisher einen Mindestlohn ab. Wahrlich eine teuflische Sache.
Kindergärten, Schulen, Sozialversicherungen, Krankenhäuser, öffentlicher Nah und Fernverkehr war mal in der öffentlichen Hand. Die Funktion bestand darin keine Gewinne zu erzielen. Mittlerweile ist dieser Teil der Grundversorgung zum Spielball privater Interessen geworden. Auch die EU spielt bei dieser Privati-sierung eine sehr große Rolle.
Unterstützt wird die neoliberale Ökonomie und diese Wertehierarchie zumeist von der 4. Macht den Medien, die nur allmählich und dann meistens auf der 3. oder 4. Seite der Zeitung oder im Fernsehen nachts, wenn alle Katzen grau sind, kritischere Töne zu diesem Schlamassel anschlagen. Allen voran die Boulevard-Zeitungen, die hier nur scheinbar die Interessen der „kleinen Leute“ unterstüt-zen. Je komplizierter das Thema und die Umweltproblematik sind, umso flacher ist die Berichterstattung in der Boulevard- Presse. Die Berichterstattung in „gu-ten“ Tageszeitungen und den öffentlichen Fernsehprogrammen verändert sich hierzu allmählich. Aber mit großen Widersprüchen. Da gibt es eine Sendung z.B. über die wachsende Rohstoffknappheit, kritisch und sachlich, dann kommen die Nachrichten, und dort wird dann wieder gejammert, wie die armen Autofahrer abgezockt werden, oder der „Dax“ heute einfach nicht klettern will.
Viele der Zahlen und Inhalte in diesen folgenden Kapiteln habe ich von Holger Rogall aus seinem Buch „ Nachhaltige Ökonomie.“ Wie sieht eine Ökonomie mit diesen „Werten“ aus? Wir nehmen es einfach hin, dass Bilanzen manipuliert werden, Falschmeldungen herausgegeben werden, nur um die Aktien positiv zu beeinflussen. Korruption, Aufhebung der Marktgesetze durch Absprachen, regen niemanden mehr auf. Es ist alles systemimmanent. Nichts Besonderes. Kriminelle Machenschaften, Lüge und Betrug sind zu „Werten,“ hingenommenen Wettbe-werbsvorteilen für Konzerne in der Globalisierungswelt herangewachsen.