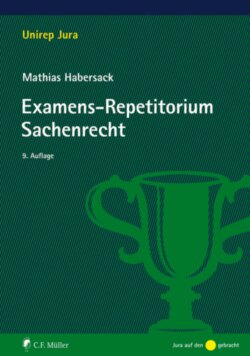Читать книгу Examens-Repetitorium Sachenrecht - Mathias Habersack - Страница 69
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Unmöglichkeit und Verzug
Оглавление72
Die Frage der ergänzenden Heranziehung schuldrechtlicher Vorschriften (Rn. 37 f.) stellt sich für dingliche Ansprüche in besonderem Maße, handelt es sich bei ihnen doch um relative Rechte, die gewisse Eigenarten aufweisen (Rn. 70 f.). Schon § 990 Abs. 2 zeigt, dass die Heranziehung schuldrechtlicher Vorschriften auch insoweit durchaus in Betracht kommt. Danach nämlich hat der unberechtigte Besitzer nach den Regeln des Schuldnerverzugs für den Schaden einzustehen, der dem Eigentümer infolge der verspäteten Herausgabe der Sache erwachsen ist[62]. Entsprechendes gilt für den Grundbuchberichtigungsanspruch aus § 894[63]. Für die Hypothek findet sich eine Regelung in § 1146[64]. Der auf Erteilung der Eintragungsbewilligung gerichtete Anspruch aus § 888, der allerdings kein dinglicher Anspruch ist (Rn. 59, 64), soll dagegen nach hM nicht den Regeln über den Schuldnerverzug unterliegen (Rn. 340).
73
Gegenstand lebhafter Diskussion ist vor allem die Frage, ob die Vorschriften über die Unmöglichkeit auf den Herausgabeanspruch aus § 985[65] Anwendung finden. Im Einzelnen ist zu unterscheiden[66]. Was zunächst die Vorschrift des § 275 Abs. 1 betrifft, so bedarf es ihrer Anwendung schon deshalb nicht, weil mit dem Verlust des Besitzes eine der Anspruchsvoraussetzungen des § 985 entfällt[67]. Der Eigentümer erlangt in diesem Fall allerdings einen Anspruch gegen den neuen Besitzer (Rn. 70). Zudem ist der frühere Besitzer unter den Voraussetzungen der §§ 989, 990 zum Schadensersatz verpflichtet; diese Vorschriften wiederum verdrängen innerhalb ihres Anwendungs- und Regelungsbereichs die §§ 280 Abs. 1, 283[68]. Ist die Sache noch existent, so kann der frühere Besitzer nach § 255 die Leistung von Schadensersatz von der Übereignung der Sache abhängig machen.
74
Aus dem Umstand, dass der Eigentümer nach § 985 vom jeweiligen Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen kann, ergibt sich des Weiteren die Unanwendbarkeit des § 285[69]. Die Frage stellt sich etwa bei unwirksamer Veräußerung der Sache durch den Besitzer. Wollte man in diesem Fall dem Eigentümer neben dem gegen den vermeintlichen Erwerber gerichteten Herausgabeanspruch aus § 985 einen Anspruch auf den vom Veräußerer erzielten Erlös zusprechen, so würde dies der Wertung des § 816 Abs. 1 S. 1 zuwiderlaufen. Denn danach tritt der Erlös an die Stelle des durch wirksame Verfügung eines Nichtberechtigten verlorenen Eigentums, nicht dagegen an die Stelle des – vom Veräußerer zunächst geschuldeten – Besitzes. Umgekehrt sähe sich der Veräußerer der Gefahr einer doppelten Inanspruchnahme ausgesetzt, unterliegt er doch im Verhältnis zum Erwerber der Haftung nach § 437. Die Anwendung des § 285 würde demnach die „Opfergrenze“ des § 985 überschreiten.
75
Die vor In-Kraft-Treten der Schuldrechtsreform intensiv erörterte, von der hM im Grundsatz bejahte[70] Frage nach der Anwendbarkeit des § 283 a.F. stellt sich unter Geltung der §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 nicht mehr in voller Schärfe. Nach § 283 Abs. 1 S. 1 a.F. konnte der Gläubiger dem rechtskräftig verurteilten Schuldner zur Bewirkung der Leistung eine Frist mit der Erklärung bestimmen, dass er nach Fristablauf die Leistung ablehne; der fruchtlose Ablauf der Frist hatte nach § 283 Abs. 1 S. 2, 3 zur Folge, dass der Gläubiger nicht mehr Erfüllung, wohl aber Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen konnte, sofern nicht die Leistung infolge eines vom Schuldner nicht zu vertretenden Umstands unmöglich geworden ist. Hintergrund der seinerzeit intensiv diskutierten Problematik war und ist vor allem, dass nach durchaus zutreffender hM der mittelbare Besitzer nicht nur zur Abtretung seines aus dem Besitzmittlungsverhältnis folgenden Herausgabeanspruchs gegen den unmittelbaren Besitzer, sondern auch zur Herausgabe der Sache verpflichtet ist[71]. Dafür spricht in der Tat, dass der Eigentümer mitunter den unmittelbaren Besitzer gar nicht kennt. Zudem sieht sich die Gegenansicht, der zufolge der mittelbare Besitzer lediglich Abtretung seines Herausgabeanspruchs schuldet, gezwungen, dem Eigentümer, nachdem der mittelbare Besitzer den unmittelbaren Besitz zurückerhalten hat, eine neue, diesmal auf Herausgabe des unmittelbaren Besitzes gerichtete Klage zuzumuten. Auf der Grundlage der hM kann der Eigentümer in diesem Fall dagegen nach §§ 883, 885 ZPO die Herausgabevollstreckung betreiben; bei fortbestehendem Besitzmittlungsverhältnis hat er nach § 886 ZPO die Möglichkeit, sich den Herausgabeanspruch des mittelbaren Besitzers überweisen zu lassen und sodann selbst gegen den unmittelbaren Besitzer vorzugehen[72]. Die unter Geltung des § 283 a.F. von der hM gesehene Gefahr, dass der auf „Herausgabe“ verurteilte mittelbare Besitzer einer Schadensersatzverpflichtung unterliegt, die im Widerspruch zu den (den redlichen Besitzer privilegierenden) Vorschriften der §§ 989 ff. (Rn. 99 ff.) steht, hat sich indes spätestens dadurch erledigt, dass § 281 Abs. 1 S. 1 – anders als § 283 Abs. 1 S. 3 a.F. – dem Besitzer den Einwand, er habe die Nichtleistung nicht zu vertreten, auch insoweit gestattet, als es um Umstände vor Rechtskraft des Herausgabeurteils geht.[73] Vor diesem Hintergrund kann daran festgehalten werden, dass der Eigentümer nach §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1, 2 unter Aufgabe seines Herausgabeanspruchs Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann, sofern der Besitzer bösgläubig oder verklagt und damit ein Wertungswiderspruch zu §§ 989, 990 ausgeschlossen ist[74]. Geht der Eigentümer in diesem Sinne vor, ist dem Besitzer in analoger Anwendung der § 281 Abs. 5, § 255 ein Anspruch auf Übereignung der Sache zuzubilligen[75].