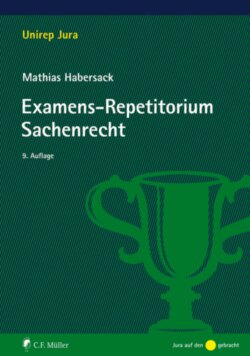Читать книгу Examens-Repetitorium Sachenrecht - Mathias Habersack - Страница 81
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Drittwirkungen obligatorischer Besitzrechte
Оглавление89
Nach § 986 Abs. 2 kann der Besitzer einer beweglichen Sache, die nach §§ 929, 931 durch Einigung und Abtretung des Herausgabeanspruchs veräußert worden ist, dem neuen Eigentümer die Einwendungen entgegensetzen, welche ihm gegen den abgetretenen Anspruch zustehen. Die Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass derjenige, der Eigentum an einer Sache erwirbt, die sich nicht in unmittelbarem Besitz des Veräußerers befindet, damit rechnen muss, dass ein Dritter dem Veräußerer gegenüber ein Recht zum Besitz hat; dieses Recht zum Besitz muss sich auch der Erwerber entgegenhalten lassen. Die Vorschrift des § 986 Abs. 2 versteht sich zwar als Ausnahme von dem Grundsatz der Relativität des Schuldverhältnisses. Sie hat aber keine „Verdinglichung“ des relativen Besitzrechts zur Folge. Insbesondere begründet sie keinen Herausgabeanspruch des Dritten, wenn der Erwerber irgendwie in den Besitz der Sache gelangt ist.
90
Was das Verhältnis des § 986 Abs. 2 zu § 404 betrifft, so ist zunächst von Bedeutung, dass der Vindikationsanspruch nicht vom Eigentum getrennt und selbständig abgetreten werden kann (Rn. 70). Durch § 986 Abs. 2 wird der Besitzer deshalb so gestellt, wie er bei isolierter Abtretung des Anspruchs aus § 985 stünde[22]; dann nämlich könnte er sich nach § 404 dem neuen Eigentümer gegenüber auf sein Recht zum Besitz berufen. Allerdings gelangt in den Fällen des § 931 die Vorschrift des § 404 insoweit zur Anwendung, als es um Einwendungen gegenüber dem Gegenstand der Abtretung, nämlich dem aus dem Besitzmittlungsverhältnis folgenden Anspruch auf Herausgabe geht. Die Funktion des § 986 Abs. 2 besteht demnach in einer Ergänzung des § 404.
91
Das Zusammenspiel der beiden Ansprüche zueinander sei anhand von Fall 3 verdeutlicht: E vermietet dem M sein Kraftfahrzeug für ein Jahr. Vor Ablauf der Mietzeit überträgt er das Eigentum nach §§ 929, 931 an K, der daraufhin von M Herausgabe des Fahrzeugs verlangt. Mit Recht?
Hier kommt zunächst ein Anspruch des K aus § 546 Abs. 1 in Betracht. Zwar wurde der Mietvertrag zwischen E und M geschlossen, so dass ein Anspruch aus § 546 an sich nur dem E zusteht. E und K sind jedoch nach § 931 vorgegangen und haben das nach § 929 S. 1 bestehende Erfordernis der Übergabe des Fahrzeugs durch die Abtretung des Herausgabeanspruchs aus § 546 ersetzt. K ist somit Inhaber des Herausgabeanspruchs geworden. Allerdings muss er sich nach § 404 entgegenhalten lassen, dass M erst nach Ablauf der Mietzeit zur Herausgabe verpflichtet ist.
In Betracht kommt ferner ein Anspruch aus § 985. Die Voraussetzungen dieser Vorschrift liegen zwar unzweifelhaft vor. M könnte jedoch zum Besitz des Fahrzeugs berechtigt sein. Zwar begründet der Mietvertrag mit E nur ein relatives Besitzrecht, das an sich dem neuen Eigentümer gegenüber nicht wirkt. Eine Ausnahme von dem Grundsatz der Relativität des Schuldverhältnisses ist aber in § 986 Abs. 2 vorgesehen. Danach kann M die Einwendungen, die ihm gegen den abgetretenen Anspruch aus § 546 zustehen, dem neuen Eigentümer auch insoweit entgegensetzen, als dieser den Anspruch aus § 985 geltend macht. Dazu gehört insbesondere der Einwand der fehlenden Fälligkeit.
92
Die Vorschrift des § 986 Abs. 2 ist analoger Anwendung zugänglich. In Betracht kommt die Analogie vor allem[23] bei Veräußerung nach § 930.
Dies sei am Beispiel des – BGHZ 111, 142 nachgebildeten – Falles 4 erläutert: W verkauft dem A am 10.4. einen aus Frankreich stammenden Bus, den er ihm gegen Aushändigung eines Wechsels sogleich übergibt; die dingliche Einigung unterbleibt allerdings. Deutsche Zulassungspapiere waren für diesen Bus noch nicht ausgestellt. Am 25.4. überreicht A dem W eine Bankeinlösungsgarantie für diesen Wechsel; daraufhin erklären beide die dingliche Einigung. Bereits am 17.4. hatte W allerdings unter Übergabe des mittlerweile ausgestellten Kfz-Briefs den Bus an die Sparkasse S zur Sicherheit übereignet; die Übergabe des Busses wurde durch Vereinbarung eines Besitzkonstituts ersetzt. Am 2.10. überträgt S ihre Rechte aus der Sicherungsübereignung auf K. A hat seinerseits den Bus am 15.7. an B veräußert. K verlangt von B Herausgabe des Busses nach § 985.
B ist unzweifelhaft Besitzer. Eigentümer war ursprünglich W. Das Eigentum hat W zwar nicht durch Übereignung an A nach § 929 S. 1 verloren. Doch wurde S nach §§ 929 S. 1, 930 am 17.4. Eigentümer des Busses; W war nämlich noch Berechtigter. Für § 930 genügt mittelbarer Besitz des Veräußerers[24], so dass mehrstufiger Besitz i.S.v. § 871 begründet wurde. W war auch mittelbarer Besitzer (§ 868), da dem A vor dem 25.4. kein Eigenbesitz (§ 872) unterstellt werden kann. S hat das Eigentum auch nicht am 25.4. an A verloren, da dieser angesichts der Nichtvorlage des Kfz-Briefs als bösgläubig (§ 932 Abs. 2) anzusehen ist (Rn. 158 f.). Aus dem gleichen Grund konnte schließlich auch B am 15.7. das Eigentum nicht von dem Nichtberechtigten A erwerben. Nach allem hat K das Eigentum von S nach §§ 929 S. 1, 931 erworben, nämlich durch Einigung und Abtretung des aus der Sicherungsabrede folgenden Herausgabeanspruchs[25].
Fraglich ist jedoch, ob dem B ein Recht zum Besitz gegenüber K zusteht. Ein solches hatte A zunächst aufgrund des mit W geschlossenen Kaufvertrags. Entsprechend § 986 Abs. 2 konnte A dieses Recht zum Besitz auch dem S entgegenhalten. Zwar ist die Übereignung zwischen W und S nicht nach §§ 929, 931 erfolgt; doch muss § 986 Abs. 2 angesichts seines auf den Schutz des unmittelbaren Besitzers gerichteten Zwecks auch bei der hier vorliegenden Übereignung nach §§ 929, 930 eingreifen. Das Besitzrecht des A könnte sodann analog § 986 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 auf B übergegangen sein. Dem Wortlaut nach ist diese Norm nicht anwendbar, da sie eine Besitzkette B–A–W und damit ein Besitzmittlungsverhältnis zwischen B und A voraussetzen würde, während B Eigenbesitzer wird und A aus der Besitzkette ausscheidet. Entscheidend für die analoge Anwendung spricht aber, dass der jetzige Besitzer B den Besitz von einem dem Eigentümer gegenüber zum Besitz Berechtigten ableitet[26]. Zu einer weiteren – diesmal direkten – Anwendung des § 986 Abs. 2 kommt es schließlich im Verhältnis B–K nach der Übereignung S–K.
93
Die Vorschrift des § 986 Abs. 2 knüpft an eine Veräußerung nach §§ 929, 931 an und schützt deshalb nur den Besitzer einer beweglichen Sache. Der Besitzer eines Grundstücks ist dagegen nur unter den Voraussetzungen der §§ 566, 578, 581 Abs. 2 geschützt[27]. Danach tritt bei einer Veräußerung des vermieteten oder verpachteten Grundstücks der Erwerber in die Rechtsstellung des Veräußerers als Partei des Miet- oder Pachtvertrags ein. Vorbehaltlich einer analogen Anwendung des § 883 Abs. 2 (Rn. 341) ist demnach der Mieter oder Pächter auch dem neuen Eigentümer gegenüber zum Besitz des Grundstücks berechtigt. Außerhalb des Anwendungsbereichs der §§ 566, 578, 581 Abs. 2 kann dagegen der neue Eigentümer das Grundstück herausverlangen (Rn. 87); der Besitzer kann allenfalls den Veräußerer wegen zu vertretender Unmöglichkeit der Gebrauchsüberlassung auf Schadensersatz in Anspruch nehmen.