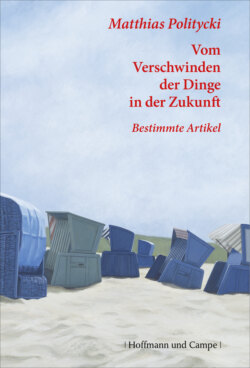Читать книгу Vom Verschwinden der Dinge in der Zukunft - Matthias Politycki - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Jungs, nehmt den Finger aus’m Arsch, es gibt Arbeit«
ОглавлениеNeulich, während einer halbverträumten U-Bahn-Fahrt, fiel mein Blick auf ein Plakat, und wie ich während des kurzen Halts halbautomatisch zu lesen begann, wurde ich Zeile für Zeile wacher: Welch eine lächerliche Werbung, fuhr ich am Ende fast vom Sitz, vollkommen unverständlich! Im Anfahren glitt mir der Blick dorthin, wo der Name des beworbenen Produkts zu erwarten gewesen wäre und wo statt dessen zu lesen stand: »Poesie in die Stadt«. Ach so. Ja dann. Kurzer Anflug von Ärger, daß hier Lyriksimulation an gutgläubigen U-Bahn-Probanden betrieben wurde – wer hatte diesen Käse denn ausgewählt und damit die ganze Aktion verschenkt? –, an der nächsten Station aber schon achselzuckendes Ist-doch-egal. War ja nicht das erste Mal, daß Verschwurbelt-Krautiges als Geniestreich angepriesen wurde, in Feuilletonkritiken, bei Preisverleihungen, meinetwegen auch an U-Bahn-Stationen; mehr, als dagegen mit den Achseln anzuzucken, lohnte nicht.
Wirklich nicht? In jenen Sekunden aufblitzender Empörung samt sofort sich anschließender Resignation war mein Lebensgefühl der letzten Jahre in nuce enthalten: Zähneknirschend hatte ich mich daran gewöhnt, daß es nicht nur in der Lyrik, nicht nur in der Literatur insgesamt und den Künsten, sondern auch im Fußball, in den Medien, der Wirtschaft und last not least natürlich der Politik mit Volldampf Richtung Mittelmaß ging, angeführt von einem Kanzlerdarsteller mit geschröderten Haaren und einer Opposition, die bislang bloß bei der Sixt-Werbung die bessere Frisur zeigte –[51] abhaken, weiter, eine andre Wahl hatte man ohnehin nicht.
Wirklich nicht? Deutschland wird zur Zeit in allen Disziplinen gedemütigt, als Insasse Deutschlands lebt man halbgeduckt voran, in der Gewißheit, daß es selbst nach der nächsten Wahl nicht besser werden wird. Gibt es eigentlich noch irgend etwas, das mich herausreißen könnte aus dieser grundsätzlichen Untergangsstimmung, gibt es irgend etwas in unserem Land oder wenigstens unserem Literaturbetrieb, das zur Hoffnung zwingt?[52] Bitte jetzt bloß keine Buchempfehlung! Sobald ich mich im Ausland befinde, vermisse ich die selbstreferenziellen Aufgeregtheiten unsres Feuilletonbetriebs am allerwenigsten: Aus der Distanz erscheint das meiste verdammt egal, was in Deutschland gedacht oder vielmehr nicht gedacht, was dort diskutiert, politisch korrekt verwässert, zum Kompromiß zerredet, auf die lange Bank geschoben wird, nicht mal mehr in den unmittelbaren Nachbarländern interessiert man sich noch dafür.
Und gar die deutsche Gegenwartsliteratur, für was sollte man sich denn da noch begeistern?[53] Außerhalb Deutschlands hat man das meiste, an dem sich unsre Autoren beharrlich abarbeiten, mittlerweile zu den Akten gelegt, weil man – gewiß: irrtümlich – glaubt, daß es daran gar nichts mehr zu bewältigen gibt. Nur bei den Deutschen ist man mit Vergangenheitsbewältigung immer auf der sicheren Seite, wir bewältigen einfach zu gern.[54] Ausgerechnet in dieser selbstgerechten Konzentration auf den Dreischritt unsrer jüngeren Nationalgeschichte – NS-Zeit, Teilung, Wiedervereinigung – frönen wir auf indirekte, immer gleich betroffene Weise unserem Nationalismus.
Wie langweilig! Wie irrelevant! Jedenfalls für 99,9 Prozent der Weltbevölkerung. Noch bleiben von der deutschen Gegenwart, natürlich, einzelne Personen, einzelne Autoren, Kritiker. Aber so ganz grundsätzlich gesprochen? Suche ich derzeit eher im Ausland nach neuen Impulsen, obgleich manchmal einem Wutausbruch nahe, wenn ich die Vitalität sehe, mit der dort an der Zukunft gebaut wird, wenn ich die Verachtung spüre, mit der man mir als politisch korrektem Schlappschwanzeuropäer entgegentritt. »Wir leben nicht unter den letzten Atemzügen einer ersterbenden Epoche, wir stehen am Morgen einer kerngesunden Zeit, es ist eine Lust zu leben!« So liest man es um 1900 in der Zeitschrift Jugend,[55] die Rede war von Deutschland.
Während an den Demarkationslinien der Kulturen die Kontur unsrer alten europäischen Welt gefährlich bröckelt, vom Niedergang der USA mal ganz zu schweigen, verhandeln deutsche Intellektuelle weiterhin mit Vorliebe Deutsches bzw. Deutsch-Deutsches aus »dunkler« oder zumindest »schwerer« Zeit, man könnte meinen, um sich vor dem Blick in eine Zukunft zu drücken, die weiß Gott nicht unbedingt leichter werden dürfte: Mayer-Vorfelder übernimmt die SPD, Ex-Mannesmann-Chef Esser wird als Bundeskanzler vereidigt, Schlingensief inszeniert das Drama der Rechtschreibreform, Deutsche Elf unter Waldemar Hartmann im 8–2-0-System von Österreich vermöbelt … Ein ganzes Land als Valentin-Musäum, da bleibt tatsächlich nur noch Novalis: Nach innen geht der geheimnisvolle Weg …[56]
Wirklich? Daß ich mit meiner achselzuckenden Verärgerung nicht allein stehe, bewies mir das jüngste Elmauer Treffen: Seit einigen Jahren kommen dort Autoren, Lektoren und Kritiker der Nach-68er-Generationen zusammen, um eine Art Theorie-Slam mit anschließender Rundum-Diskussion zu veranstalten.[57] Was, ganz ohne thematische Vorgaben, als überraschend präzises Stimmungsbarometer funktioniert, sozusagen als spielerische Analyse bundesrepublikanischer Befindlichkeiten. Heftig beklagte man diesmal[58] die Opakheit der Gesellschaft, sehnte sich nach neuen Standpunkten und positiven Utopien, zumindest nach neuen Spielgestaltern und Rädelsführern, um am Ende, zunehmend verärgert über die eigne sich im Kreis drehende Jammerei, zumindest begriffen zu haben, daß es so nicht weitergehen konnte: daß man zumindest schon mal im eignen Bereich anfangen mußte, selber anfangen mußte, nach neuen ästhetischen und womöglich moralischen Kriterien Ausschau zu halten – wer hätte das gedacht, nach all dem selbstreferenziellen Schlingern, ein zukunftsweisender Mehrheitsbeschluß, der Beginn einer ästhetischen Debatte, das Ende der Beliebigkeit![59]
Was freilich noch lange keine tatsächliche Veränderung garantiert, mit dem Handeln tun wir uns – die 78er und nachfolgende Generationen – weiterhin schwer, die mittlerweile größte Bevölkerungsgruppe beschränkt sich in der Regel aufs Beobachten. Mentalitätssache? Wie anders im Ausland, vorzugsweise im afrikanischen, karibischen, lateinamerikanischen, wo sich jeder in alles ungebeten einmischt und es auch gleich besser weiß! Auf Kuba wohnte ich während der letzten Jahre[60] neben einer, gelinde gesagt, kleinkriminellen Bande, die sich zur Mittagszeit mit Vorliebe zum Kiffen im Hof zusammenrottete. Wehe aber, es fuhr die Chefin unter sie, vielleicht die Mutter des Anführers, jedenfalls schwer und schwarz und wuchtig, mit Lockenwicklern im Haar: »Jungs, nehmt den Finger aus’m Arsch, es gibt Arbeit!« Manchmal wollte ich mich nach einer solchen Lockenwicklerin sehnen, die mit derbem Befehl die allgemeine Apathie auch in unserm Land beende.[61]
Was freilich, selbstredend, das Letzte wäre, was wir angesichts all unsrer eignen lautstark krakeelenden Lockenwickler, Schönfärber und juristisch abgesicherten Nichtschönfärber hier noch gebrauchen könnten, im Gegenteil: Niemand andrer als die Bedenkenträger par excellence, die Schriftsteller, sind meiner Meinung nach nun gefordert, sich ins große Ganze zurückzubegeben, raus aus ihren egomanischen Biotopen, rein ins Offne des gesellschaftlichen Gesprächs. Ja, ich habe ein altmodisches Bild vom Schriftsteller als Intellektuellem, der sich nicht allein als Schreibtischtäter begreift; ein Autor ist für mich, diesseits wie jenseits seiner Bücher, vor allem durch seinen Standpunkt definiert, das Recht auf ein radikal individualistisches Leben bedingt auch die Pflicht zur Anteilnahme am Allgemeinen.
Und das gilt nicht nur für die Vertreter der Flakhelfer- oder der 68er-Generation, sondern auch und gerade für die ewigen Verweigerer unter ihren skeptisch-distanzierten Nachfahren, das gilt auch für meine eigene Generation. Nicht daß ich mir eine Handvoll neuer »Großintellektueller« wünsche, die bei näherem Hinsehen allenfalls als Scheinriesen Respekt erheischen! Was unsre niedergehende Gesellschaft bräuchte, wäre eine Vielzahl an Autoren mittlerer Jahre, die nicht an der Verlängerung ihrer Pubertät bis ins Rentenalter arbeiten, sondern mit dem bewußten Abschied von ihrer Dauerjugendlichkeit bereit sind, ihr reales Alter und damit die Pflichten eines Erwachsenen anzunehmen: soziale Verantwortung jenseits der eignen Werkabfolge. Politisch engagierte Literatur, das wäre mir ein Greuel; politisch engagierte Autoren hingegen, ein Netzwerk freier Radikaler, die unbestechlich und ungebeten überall dort ihre Meinung einbringen, wo man das Wort Integrität nicht mal mehr fehlerfrei buchstabieren kann – welches demokratisch verfaßte Gemeinwesen könnte auf Dauer darauf verzichten?
Phantasie an die Macht, hieß das früher. Phantasie an die Ohnmacht, wird es jetzt erst mal heißen, denn das ist der schlimmste Aspekt unsrer jahrzehntelangen Untätigkeit: daß wir in geradezu idiosynkratischer Abstinenz von aller Macht versäumt haben, Schlüsselpositionen zu besetzen, und daß dies Vakuum andre dazu eingeladen hat, es unter Vorspiegelung ethischer Positionen (»Der mündige Bürger kann alleine entscheiden«) zu tun: Quote ersetzte Diktum, Prominenz ersetzte Substanz, Meinung ersetzte Vision – die zur Elite Prädestinierten haben sich dagegen fast vollständig ins Unverbindliche zurückgezogen. So leben wir, bitter zu denken, nicht nur in der Endphase des Kapitalismus, sondern gleichermaßen in der Endphase der Demokratie, zumindest in ihrer fragwürdig gewordnen Form als Parteiendemokratie.[62] Denn wenn die Besten einer Gesellschaft (und die Rede ist längst nicht mehr nur von Schriftstellern) Besseres zu tun haben, als von ihren Führungspositionen aus mit sanft undemokratischen Mitteln den Rest der Gesellschaft anzuleiten, dann tun dies eben die Zweit-, schließlich auch die Zehntbesten, dann ist der gesamtdeutsche Küblböck obenauf:[63] Medienrummeldemokratie als kaum verkappte Diktatur der Gaußschen Glockenkurve, vulgo: des Proletariats.
Wer in seinem Herzen Demokrat ist, der muß nun schleunigst undemokratisch denken,[64] nicht von der Mitte, sondern vom Rand der Gesellschaft her, der muß Minderheiten zurück an die Macht bringen,[65] zum Wohle dessen, was dann vielleicht sogar mal wieder in eine echte Demokratie übergehen könnte. Mittlerweile nämlich sind wir auch im größer gewordnen Deutschland fällig, und als überzeugtem 78er gefällt mir die Niederschrift dieses Wortes überhaupt nicht, fällig für eine neue gesellschaftliche Revolution. Diesmal allerdings für eine elitäre, jenseits des alten Lagerdenkens und angezettelt nicht etwa bloß von einer Task Force im Beckenbauer-Format, sondern im Sinne von Platons Konzept einer Herrschaft der Besten;[66] andernfalls unsre, die Schuld der »Nachgeborenen«, nicht mehr wiedergutzumachen sein wird.
(2004)