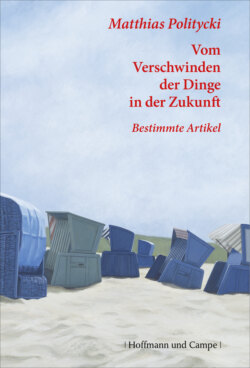Читать книгу Vom Verschwinden der Dinge in der Zukunft - Matthias Politycki - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Alt werden, ohne jung zu bleiben
ОглавлениеSeit dem 28. Februar 1992 führe ich mit meinem Freund Christoph Bartmann[1] das immerwährende »Prager Protokoll«: Begonnen anläßlich eines Besuchs im dort gerade neugegründeten Goethe-Institut und noch ganz im Zeichen privater Irrungen und Wirrungen stehend, widmete es sich im Zuge der Zeit – auch wenn wir uns andernorts trafen, hielten wir am Namen unsrer Gesprächsnotate fest – zunehmend den allgemeinen Weltläuften, festgehalten in holzschnittartigen Kurzzusammenfassungen unsrer Weitschweifigkeiten: Es steht nicht gut um die deutsche Kultur, wenn man vom Ausland auf sie blickt, so eines unsrer von Jahr zu Jahr verzagter intonierten Leitmotive, welch grassierendes Desinteresse an der deutschen Sprache, welch rasanter Verlust an Strahlkraft dessen, was jenseits von Mercedesstern, Adidasstreifen und Niveadose unterm Label »deutsch« firmiert![2] Mit den kläglichen Darbietungen der Nationalelf fing es an,[3] mit der Flucht von Spitzensteuerzahlern und -wissenschaftlern ins Ausland, dem konstanten Anwachsen von Staatsschuld, Arbeitslosenzahl und allgemeiner Politikverdrossenheit hörte es noch lang nicht auf.
Soweit das Holzschnittartige. Selbstredend hätten all die angeschnittnen Themen differenzierter angegangen werden müssen; ihre schiere Benennung schien uns jedoch als Hintergrundsrauschen auszureichen, vor dessen anschwellender Intensität das Prager Protokollieren erst so richtig in Fahrt kam: »Es muß sich was ändern, die Frage ist nur: was wo wie wann.«[4] Fürs übrige Mitteleuropa sah es unsrer Meinung nach im Verlauf der späten 90er ebenfalls zunehmend düster aus, für die Gründerstaaten der EWG, deren wichtigste Vertreter denn auch nach der Jahrtausendwende als »Altes Europa« explizit auf einen weltpolitischen Abstiegsplatz verwiesen wurden.[5] Und in Bälde wahrscheinlich auch auf einen weltwirtschaftlichen, wohingegen die jungen Industrienationen Asiens immer häufiger für Schlagzeilen sorgten, und zwar längst nicht mehr in Sachen Verlagerung von Produktionsstätten in Billiglohnländer, oh nein! Sondern indem sie mit ihrer rasant wachsenden Wirtschaftskraft altehrwürdige Industriestaaten wie Frankreich auf die Plätze verwiesen[6] oder sich im Handstreich riesige europäische Großkonzerne einverleibten,[7] indem sie sich also dem wachsenden Druck der Globalisierung weit besser anzupassen wußten als der Rest der Welt und damit für Verwerfungen sorgten, die man als erste Vorboten einer völlig neuen Wirtschaftsordnung lesen konnte: Ob wir von einem »Kleinen Tiger« wie Taiwan auf Mitteleuropa blickten oder von einem der dynamisch aufstrebenden Staaten des ehemaligen Ostblocks – und beide taten (und tun) wir das als überzeugte »Alte Europäer«, keine Frage –, vermeinten wir, Symptome des drohenden Abstiegs aus der »Ersten Welt« zu entdecken, zumindest schon mal die entsprechende Lähmung, Verkrustung, diffus muffige Untergangsstimmung. Zugegeben, auch wir frönten beim Prager Protokollieren der allgemeinen Verdrießlichkeit, wie sie hierzulande über Jahre zum guten schlechten Ton gehörte. Waren wir auf diese Weise etwa zu »Konservativen« geworden? Oder lediglich kritischer im Umgang mit Illusionen, sprich: leidenschaftsloser, kälter, älter?
Älterwerden erlebten wir während der 90er, in unsrer Eigenschaft als Bürger eines Gemeinwesens, auch als Verlusterfahrung, mit dem Zusammenbruch des Ostblocks war ja nicht nur die sozialistische Utopie an ein real existierendes Ende gekommen, sondern auch die des »freien Westens«, in der soziale Marktwirtschaft so berauschend schlicht mit Demokratie und Glück gleichgesetzt werden konnte: Erst ging mit Pauken und Trompeten die DDR unter, dann, sang- und klanglos bis zum heutigen Tage, die alte BRD. Gegen unsern Willen gerieten wir östlich wie westlich der alten Demarkationslinie Into the Great Wide Open, in eine rundum offene Gesellschaft, in der nichts mehr tabu, unhinterfragbar, heilig, hingegen alles möglich und paradoxerweise trotzdem ohne echte Zukunftsperspektive war. Schon bald schien unsre Idee von Freiheit auf den Sachverhalt zusammenzuschnurren, daß wir zwischen den diversen Stromversorgern, Netzbetreibern, Spaßlieferanten wählen und uns ansonsten als »Ich-AG« würden durchschlagen dürfen; an der Abschaffung unsres klassischen Kulturbegriffs hatten wir selber maßgeblich mitgewirkt, an derjenigen des oft geschmähten (und in der jetzigen Eventkultur arg vermißten) Bildungsbürgertums bereits die Generationen vor uns;[8] von idealistischen Gesellschaftskonzepten kündeten schließlich nur noch diejenigen, die wir als »Verlierer der Einheit« gern zu Wort kommen ließen, weil wir ihnen dann nicht auch noch Gehör schenken mußten. Das Ende der inneren Nachkriegsordnung gestaltete sich zwar als ein längst überfälliges Großreinemachen im Feld der alten, verbrauchten Werte, Logoi und Diskurshoheiten, auf das wir selber einst voll Hoffnung hingearbeitet hatten, lief dann aber, da die verschlissenen ästhetischen Hierarchien und utopischen Konzepte zwar verworfen, aber keine neuen postuliert wurden, vor allem auf eines hinaus: auf eine sehr grundsätzliche Orientierungslosigkeit, und mit ihr: auf das schleichende Ende sämtlicher Visionen. Glück schien im Zeichen der neuen Unübersichtlichkeit nurmehr als Privatbiotop zu erlangen und dann durch flächendeckenden Zynismus zu verteidigen; unter Berufung auf »Toleranz« und »Ironie«[9] ließ sich ungehemmt der eignen Ignoranz frönen, es war schlichtweg zum … Oder waren wir, die gealterten Prager Protokollanten, im Lauf der Jahre lediglich erfahrener geworden im Umgang mit Etikettenschwindlern und Phrasendreschmaschinen, sprich: leidenschaftlicher, dünnhäutiger, älter?
Nun ist das Älterwerden seit dem Siegeszug von Pop und Rock zu unser aller Kardinalproblem geworden, in dem weltanschauliche Aspekte – »Trau keinem über dreißig!« – mit latent sexistischen zusammenfließen: In einer dem Körperkult ergebenen Gesellschaft kann man’s sich im Grunde nicht leisten, älter zu werden, und wenn doch, dann nur, wenn man dabei trotzdem Forever Young bleibt. Man betrachte in die Jahre gekommene Berufsjugendliche, wie sie Szenekneipen bevölkern und dort auf ihren siebzehnten, womöglich bauchnabelgepiercten Frühling warten; wie sie sich lässig ihr Hemd aus der Hose gezogen oder ein Baseballkäppi schräg aufgesetzt haben, um Lebensart, Selbstironie, Frauenverstehertum vorzutäuschen, »erfahrne Rock ’n’ Roller«, die nach Sympathy for the Devil gieren. Freilich kommt anstelle des Keith-Richard-mäßigen dabei zumeist nur das Roberto-Blanco-hafte an ihnen heraus.
Alter Schwede! Spätestens mit dem Ende der Nachkriegsordnung ist die einstmals revolutionäre Jugendkultur zur reaktionären Spaßkultur verkommen, und jeder blamiert sich, so gut er eben kann. Würdevoll altern ist out, statt dessen huldigt man einer neuen Schamlosigkeit, notfalls als Narr, die mit aller Gewalt den Eindruck erzeugen will, man fröne zumindest noch einem pharmazeutisch geregelten Geschlechtsleben. Als ob geistige Potenz kein ausreichender Virilitätsnachweis wäre! Als ob Älterwerden schon dasselbe wie Altsein wäre! Und nicht vielmehr der ewige Lebemann auf eine Weise vergreist und erstarrt, wie es dem bewußt Alternden bereits die fortwährende Dynamik des Vorgangs versagt! Wer bis zum finalen Akt nichts als jung bleiben will, versäumt in aller Regel die Hälfte des Lebens – warum sollte man das, was man in seiner Jugend erträumt, erlitten, erlacht hat, auf immergleiche Weise bis zum letzten Atemzug erleben, allenfalls ergänzt um das Wissen über sämtliche toskanischen Olivenöle einschließlich ihrer Falschpressungen? Ein Schisser ist man mit dieser anhaltenden Selbstbetrügerei obendrein.
Hingegen alt werden, ohne jung zu bleiben![10] Ein permanenter Prozeß, in dem jedes neue Lebensjahr, jedes neue Lebensjahrzehnt zum intellektuellen Abenteuer gerät, zum Ausgangspunkt neuer Ansichten, die sich mit bisherigen Ansichten sukzessive zu Einsichten verbinden, freilich auch im Handumdrehen alles bisher Postulierte als liebgewonnenen Lebensirrtum decouvrieren könnten: Man denke an das jähe Wiedererstarken des Nationalismus in Europa, nicht nur in den Ländern des ehemaligen Ostblocks, wie man ihn längst überwunden glaubte. Einsicht in die Relativität aller Wahrheit, gerade auch der festreden- und leitartikelsubventionierten, bei gleichzeitig ungebrochnem Idealismus, sie wenigstens in ihrer flüchtigen Erscheinungsform immer wieder neu zu erhaschen oder gar für sie zu kämpfen – welch eine Herausforderung! Und so wenige, die sich ihr in angemessener Weise stellen; schließlich fällt es viel einfacher, in der Unverbindlichkeit einer perpetuierten Jugendlichkeit zu verharren, keinem andern verpflichtet als sich selbst.
Es ist nicht nur eine Frage des Stils, den klassischen Erwachsenenstatus vorzuziehen und mit ihm die klassischen Tugenden des Alters. Ein wohlstrukturiertes Zusammenleben, sprich: die bewußte gesellschaftliche Einbindung aller Bevölkerungsgruppen und -schichten ins große Ganze, Gemeinsame, beginnt bekanntlich erst dort, wo Erfahrung ins Spiel kommt, wo sich der Blick auf die Zukunft übers unmittelbar Zukünftige hinweghebt. Und stehen wir Älteren nicht überdies unterm erhöhten Druck der laufenden Ereignisse; ist die Bedrohung des Westens (als einer spätaufgeklärten Wertegemeinschaft jenseits von Himmelsrichtungen) nicht de facto fundamentaler, weil irrationaler, dezentraler, fraktaler geworden als in den Jahrzehnten des weltpolitischen Stellungskrieges bis zum Mauerfall? Und sind wir folglich, sofern wir noch einen Rest an Verantwortung fürs Allgemeine in uns verspüren, sind wir nicht sogar gezwungen, vieles neu zu überdenken, was sich während zweier lax vergroovter und vergeigter Jahrzehnte verbraucht oder, angesichts brennender Vorstädte,[11] sogar als gefährliche Illusion enttarnt hat? Alt werden, ohne jung zu bleiben, das heißt auch, wieder und genauer dorthin zu blicken, wo man gar keine neuen An- und Einsichten mehr erwartet hätte, heißt vor allem, den Mut zur Revision einstiger Gewißheiten zu finden, heißt am Ende, unangenehme neue Erkenntnisse zu einer neuen Form von Gesamternüchterung zu bündeln (aus der sich dann womöglich auch wieder eine neue Form von Hoffnung schöpfen ließe) und sie mit klaren Worten gegen die politisch korrekte Verbrämungskultur des Zeitgeists in Position zu bringen. Selbst wenn sie, die Gesamternüchterung, im Verhältnis zur liberalen Utopie des eignen Knabenmorgenblütentraums schwer zu ertragen, bestenfalls noch als linkskonservativ zu verbrämen wäre.
Linkskonservativ? Ich habe lange über ein Wort nachgedacht, das den Spagat auf den Begriff bringt, den zu vollziehen sich der ehemals »linke« Teil unsrer Gesellschaft gerade mittels erster Lockerungsübungen und unter schwersten Gewissensbissen anschickt, ein Wort, das sich jeder »rechten« Lesart explizit verweigert und in dem auch sonst keinerlei unausgelüftete Ideologien mitschwingen, ein Wort, in dem die einstige Leidenschaft utopischen Denkens noch aufgehoben und das also bereits durch seinen leicht angestaubten Unpragmatismus klar abgesetzt ist von sämtlichen kursierenden Begriffen des Konservativen.[12] Schwierig! Nichts wäre in diesem Zusammenhang fataler als Beifall aus der falschen Ecke; und nur als einer, der sich nicht im lamentierenden Rückbesinnen auf vergangne Werte erschöpft, sondern darin allenfalls den Ausgangspunkt neuer Visionen sieht, nur als einer, der auch beim kritischen Blick in die Zukunft das utopische Potential seiner Jugend nicht verrät, will ich mich versuchsweise als linkskonservativ bezeichnen.
Denn die Blauäugigkeit der einstigen Linken ungebrochen weiterzupropagieren, ohne konterkarierende Ergänzung zum Oxymoron, dafür ist die Zeit lange abgelaufen. Zutage getreten ist hingegen die weltanschauliche Herausforderung unsrer Generation – der neu angebrochne Kampf der Kulturen wird ja selbst durch eine Lösung des Palästinaproblems nicht so schnell zu beenden sein. Allerorten entstehen derzeit neue Frontlinien nicht so sehr zwischen islamischen und nichtislamischen, sondern zwischen fundamentalistisch religiösen und laizistischen Gesellschaften. Auch innerhalb der »Festung Europa«, wie sie einige Hardliner schon eifrig fordern, man wird sich in der Auseinandersetzung mit beiden Seiten noch warm anziehen müssen.[13]
Alt werden, ohne jung zu bleiben, das heißt also nicht nur (im Hinblick aufs Einzelschicksal), Anmut gegen Würde einzutauschen, sondern auch (im sozialen Miteinander), vorrangig Pflicht statt Neigung zu empfinden; alt werden, ohne jung zu bleiben, ist gleichermaßen Menschenrecht wie -pflicht. Die in letzter lästiger Konsequenz darauf hinausläuft, eine weltanschauliche Position beziehen zu müssen, deren Resonanzboden nicht unter den fetten Bässen der Gegenwart vibriert, sondern im fernen Taktschlag des Kommenden erzittert. Eine Art Aufsichtspflicht, der man sich gerade auch als Schriftsteller, meine ich, nicht entziehen darf, sofern man Schreiben nicht als bloßen Broterwerb, sondern als existenzielle Aufgabe begreift, die über serielle Produktion von Texten hinausgeht: Ein Schriftsteller ist mehr als die Summe seiner Bücher,[14] er hat einen Standpunkt, der sich in der Wahl seiner Adjektive ebenso ausdrückt wie in der Wahl seines Lieblingstürken.[15] Für diesen Standpunkt, der wiederum mehr ist als die Summe seiner Meinungen, ist er persönlich haftbar, weit mehr als für jede einzelne seiner kontextabhängig gewonnenen Thesen. Denn im Gegensatz zum bloßen Autor, der als Plotist seriell Texte erstellt, kann der Schriftsteller seine Werke nur mit eigner Lebenserfahrung beglaubigen; will er seinem Leser mehr als das reine Lesevergnügen bereiten, muß er zusätzlich zu allen Qualen einer relevanten literarischen Gestaltung das Wagnis auf sich nehmen, Zeitgenosse zu sein. Muß sich als Teil des regionalen, nationalen, globalen Zusammenlebens begreifen, wie es aus der Warte eines Elfenbeinturmbewohners nie in all seiner Komplexität wahrzunehmen und entsprechend detailreich zu schildern gelänge.
Gehört man mit dieser Selbstverpflichtung zu teilhabender Neugier, zu neugieriger Teilhabe am Allgemein-Menschlichen bereits zur altbacknen Art des politischen Schriftstellers, wie er sich in Gestalt einiger bundesrepublikanischer Vorzeige-Mahner und -Warner gerade selbst überlebt? Erste reflexhafte Antwort: allerhöchstens immer mal wieder, vor allem wider Willen. Hastige Ergänzung: und auf keinen Fall im früheren, enggefaßten Verständnis desselben.[16] Ein politischer Schriftsteller, wie ich ihn verstehe, ist kein Debattenschwein vom Dienst, kein permanent auf stand-by geschaltetes Kontrollgremium des Kleingedruckten; das kann er getrost den politischen Autoren überlassen. Der politische Schriftsteller hingegen verkörpert die ästhetische Variante einer außerparlamentarischen Opposition; sein Nachdenken kann angesichts des derzeitigen Vakuums an Utopien nur ein verkappt philosophisches sein, und zwar ein freigeistiges, diesseits wie jenseits herrschender Meinungen, Parteien, Systeme, unter wechselnden Perspektiven und Prämissen, mit wechselnden Gesprächspartnern und Antipoden.
Dieser neue Typus des politischen Schriftstellers läuft in seiner emphatischen Weltzugewandtheit möglicherweise sogar aufs Gegenteil dessen hinaus, was frühere Vertreter des Genres in bemühtem Rollenspiel darzustellen suchten – den personifizierten Ernst des Lebens. Das Lamento dessen, der in der Gegenwart vorrangig Verfall einer besser strukturierten Vergangenheit sieht, versucht er so selten wie möglich anzustimmen; vielmehr huldigt er einer prinzipiellen Leidenschaft, die jenseits abgegriffner Schubladisierungen an allem lustvoll Anteil nimmt, was unser kulturelles, politisches, gesellschaftliches Umfeld ausmacht: Die Verse eines entlegnen karibischen Lyrikers sind ihm a priori genauso »hoch« oder »niedrig« wie die neuesten Trends der gesamtdeutschen Schamhaarfrisur. Seine Intellektualität ist wesentlich ungebundener, sein Begriff von Bildung ist wesentlich offener als derjenige früherer politischer Schriftsteller; und doch weiß er sich mit ihnen in einem wesentlichen Punkt überein: dem Wunsch, dieses schrecklich schöne Leben noch ein Stückchen schrecklich schöner zu machen.
Ist politische Schriftstellerei in diesem umfassenden Verständnis vielleicht selbst nur eine Utopie? Mit Sicherheit eine undankbare Aufgabe! Die Gefahr der Verbitterung über ubiquitär grassierende Mediokrität steigt durch anhaltende Beschäftigung mit derselben erheblich; dazu die Entsetzensschreie flüchtig rezipierender Leser, nicht selten als Häme notdürftig getarnt, sofern einer ihrer wunden Punkte berührt wurde. Selbst wenn man nicht beständig mit erhobnem Zeigefinger auftritt, wird man als politischer Schriftsteller vorrangig allein sein, sofern man sein Amt (mit all dem gebotnen Unernst) ernst nimmt – allzu breite Zustimmung wäre für einen, der sich jedem Lagerdenken verweigert, ja auch verdächtig.
Und das alles auch noch in postmodern entfesselten Zeiten, die unterm Alarmismus der medialen Katastrophen- und Feuermelder gerade zur Aftermoderne depravieren! Staunend registrieren wir die weltweite Renaissance unaufgeklärten Denkens – und hätten statt dessen im Wettlauf der Weltanschauungen längst Gegenvisionen zu entwickeln, die sogkräftiger, zukunftsträchtiger sind als die saturiert säkularen unsrer décadence. Komplizierte Zeiten, weit komplizierter als unter den dialektischen Herausforderungen der Nachkriegsära! Angemessen ausgewogene Antworten für das Chaos unsrer Gegenwart zu finden, kann da die Aufgabe des Schriftstellers als eines Fachmanns fürs Allgemeine nicht sein; es ist schon viel, wenn ihm die eine oder andere Frage gelingt, die den festgefügten Horizont unsrer Alltäglichkeiten für all die Experten aufreißt, die’s dann ja sogleich besser wissen. Ein Schriftsteller wird keine schlüsselfertigen Lösungen anbieten, schließlich beglaubigt er seine wechselnden Ansichten mit nichts als den eignen – im Lauf des Älterwerdens wechselnden – Lebenserfahrungen. Wenn er damit aus der herrschenden Konsensessayistik ausschert, ja mit seinen spekulativen Thesen bewußt übers Ziel hinausschießt, um wenigstens mit rhetorischen Mitteln an der Verbesserung von Mitteleuropa mitzuwirken, so mag man das bitte noch lange nicht als seinen endgültigen Standpunkt mißverstehen. Je älter man wird, desto ferner gerät der Konsens, aber je älter man wird, desto größer wird auch die Sehnsucht, irgendwo zustimmen zu können![17]
Aus dieser Grundüberzeugung, als Schriftsteller jenseits des selbstreferenziellen Egotrips von Buch zu Buch auch eine gesellschaftliche Bringschuld zu haben,[18] ist vorliegende Textauswahl zusammengestellt, als vorläufige Quersumme dessen, was sich im Abarbeiten am »Politischen« der großen Welt- wie der kleinen Alltagsgeschichte während der letzten Jahre als mein Standpunkt herauskristallisiert hat. Manches davon – das Selbstverständnis als europäischer Patriot, als Parteigänger einer kosmopolitischen Weltordnung – zieht sich seit je durch mein Denken; manch andres – Zweifel am spätdemokratischen Glücksversprechen der Aufklärung, Respekt für religiöse Welterklärungsmodelle – ist mir als dem bekennenden Nietzscheaner, der ich natürlich immer noch und vor allem anderen bin, erst in jüngster Zeit virulent geworden, da die grundsätzliche Krise des Westens auch die Orangenhaut ans Tageslicht brachte, die unsre von den noch Älteren ererbte Weltsicht mittlerweile bekommen hat.[19]
Wer von uns hätte noch vor zehn Jahren ernsthaft in Erwägung gezogen, daß ein ästhetisches Engagement auf moralische Lösungen hinauslaufen könnte? Daß Relevanz der Themenstellung wichtiger sein könnte als ihre artistische Gestaltung? Ja, auch in meiner Liebe zum Formalen bin ich älter geworden, ohne jung zu bleiben, und ich bin dabei mit mir im Reinen. Diese Textsammlung kann das bestenfalls »im Prinzip« belegen, schließlich bleibt jedes Buch hinter der Vision seines Verfassers zurück. Aber es wird ja wohl hoffentlich nicht mein letztes sein; und wenn ich im Verlauf weiteren Älterwerdens dem Ideal einer freigeistigen Zeitgenossenschaft noch ein Stückchen nähergekommen sein sollte, so gewiß nicht ohne Prager Protokoll bzw. die Gespräche, die es begleiten. Denn alles, was es im Leben zu erreichen gilt, erreicht man nur mit Hilfe seiner Freunde – oder gar nicht.