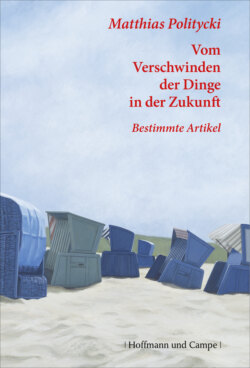Читать книгу Vom Verschwinden der Dinge in der Zukunft - Matthias Politycki - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление»Jungs, nehmt den Finger aus’m Arsch, es gibt Arbeit« – revisited
Rückkehr der Eliten
Die Elite, deren Rückkehr ins Zentrum des gesellschaftlichen Gesprächs gegen Ende des vorangegangenen Aufsatzes angemahnt wird – welch ein Schindluder ist mit diesem Begriff getrieben worden! Schon der Klang des Wortes läßt jeden Altlinken erschauern – ein jahrzehntelang nicht hinterfragter Pawlowscher Reflex –, wittert er doch in jeder Elite eine faschistische Keimzelle. Zumindest einen arg rechtslastigen Geheimbund, Stichwort George-Kreis.
In unserer postmodernen Gesellschaft wirkt das egalitäre Mißtrauen gegenüber der intellektuellen Elite unhinterfragt fort, vor allem unter den Intellektuellen selbst, sogar auf den Begriff des Intellektuellen färbt es bis zu einem gewissen Grad ab: Die Intellektuellen mißtrauen einander auf eine ganz grundsätzliche Weise, am allermeisten dann, wenn sie sich als virtuelle Gemeinschaft imaginieren – keiner will so recht zugeben (außer neuerdings Universitätsrektoren), daß er Eliten befürwortet, nicht mal diejenigen, die ihr fraglos angehören würden.
Die »Elite«, ein von der Linken nachhaltig pejorativ besetzter Begriff, wahrscheinlich müßte man – nach dem Muster der Striptease-Schuppen, die man mit der Umetikettierung zu Tabledance-Bars über Nacht wieder salonfähig machte –, wahrscheinlich müßte man nur ein neues, unbelastetes Wort für sie finden, um auch die Sache wieder in neuem Licht erstrahlen zu lassen: am besten durch Übernahme eines fremdsprachigen Terminus, den wir nicht wirklich verstehen, dessen Klang jedoch eine heitere Selbstgenügsamkeit fern aller Machtgelüste suggeriert. Oder zumindest durch ausschließliche Verwendung der Pluralform, um durch die Vielheit verschiedener Eliten eine Art parlamentarisch parzelliertes Debattenforum zu suggerieren, in dem sich die einzelnen Vertreter desselben hoffentlich gegenseitig in Schach halten.
Wie auch immer wir sie nennen wollen, um die Sache selbst kommt auch ein demokratisch strukturiertes Gemeinwesen nicht herum, will es auf Dauer nicht nachhaltig Schaden nehmen. Im Gegenteil, je lebhafter all die verschiednen Funktions- bzw. Kompetenzeliten einer Gesellschaft an deren politischem Leben teilnehmen, desto systemstabilisierender wirken sie, trotz all der systemkritischen Denkansätze, die sie in die öffentlichen Debatten einspeisen; und zwar schlicht durch die Tatsache, daß sie auf eine unüberschaubar heterogene Weise da sind und sich angesichts ihrer Wachsamkeit nichts unter der Hand oder im Alleingang beschließen, gar umsetzen läßt. Weswegen sonst all die Säuberungsaktionen totalitärer Herrscher, ob Hitler, Stalin, Mao, ob Rote Khmer oder lateinamerikanische Caudillos? Vernichtung bzw. Vertreibung intellektueller »Ratten und Schmeißfliegen« (Franz Josef Strauß) ist geradezu notwendige Voraussetzung, um die verbliebene »Masse Mensch« auf die Rolle passiver Mitläuferschaft hinzutrimmen.
Denn jede Elite ist vor allem: ein extrem flexibles, beständig sein Kräftefeld veränderndes Sammelsurium an schwer kontrollierbaren, tendenziell aufmüpfigen Selbstdenkern. Habituell mißtrauisch gegenüber den Gelüsten einzelner oder einzelner Interessengruppen, übernimmt diese Sub- bzw. Supragesellschaft aus schierem Eigeninteresse eine nicht zu unterschätzende Verantwortung fürs Gemeinwohl, sichert durch ihr beständig kontrovers geführtes Gespräch die fortwährende Verteidigung der gemeinsamen humanistischen Grundlagen. Womit sie, die stellvertretende Stimmenvielfalt der »schweigenden Mehrheit«, den Raum des Bürgertums überhaupt erst definiert und, nicht zuletzt, darin einen gewissen Standard der Diskussion aufrechterhält (die ansonsten bald vollkommen in die Weblogs abwandern würde), bei der das technokratische Auflisten von Zahlenkolonnen nicht von vornherein als Beweismittel gilt, und schon gar nicht als Haltung.
Nur im Idealfall, ich weiß! Ebenjenen jedoch wünschte ich mir in den Schlußpassagen meines – wohlgemerkt: zu einer Zeit tiefster Politikmüdigkeit verfaßten – Zustandsberichts zum Sommer 2004 herbei. Denn die Demokratie wird nicht nur von Machtgelüsten einzelner bedroht, sondern auch von der Gleichgültigkeit aller; und wenn die Welt plötzlich nur noch von Expertengutachten und Sachzwängen regiert wird, als seien diese mysteriös schicksalhafte Naturgewalten, wäre es allein die Elite einer Gesellschaft – die Summe derer, die auch jenseits ihres kleinen, bescheidnen Expertentums am Gespräch der Gesamtheit teilzunehmen wagen –, die durch ihren (lediglich durch ethische Richtlinienkompetenz legitimierten) Dilettantismus den Standpunkt einer allgemeinen Menschlichkeit in die fachkompetenten Spezialdebatten zurückzubringen in der Lage ist. Bei allem Respekt, der Trainer einer Fußballnationalmannschaft allein kann das nicht.
Wo aber, so fragt man sich, ist diese Elite heute? Nämlich in Deutschland, nicht in Frankreich, wo man sich bekanntlich schon zur Elite rechnet, sobald man einen herumstotternden Touristen über den falschen Gebrauch des Subjonctifs belehrt hat. An einzelnen Intellektuellen ist kein Mangel, auch nicht unter den 78ern, den 89ern und allen sonstigen Generationen »Nachgeborener«, wie sich an der Repolitisierung der Literatur ab dem Wahlkampfsommer des Jahres 2005 ablesen läßt: Gesellschaftsabgewandtheit gilt nicht mehr a priori als schick; die in den Feuilletons vergossenen Krokodilstränen, nach dem endgültigen Abtreten unsrer bundesrepublikanischen Überväter rücke niemand nach, der sich »kümmere«, sind vor allem Zeichen beginnender Vergangenheitsverklärung. Aber eine Elite, gar eine engagierte (um eine weitere Vokabel zu bemühen, die durch den inflationären Gebrauch der 68er zum Reizwort geworden ist), vielleicht sogar eine, die sich aus linksliberalen Wurzeln speist und den neokonservativen Kreisen die Stirn bietet? Also ein wechselndes Konsortium all derer, die das politische Geschick und vor allem auch das politische Ungeschick unsres Landes in schöpferischer Leidenschaftlichkeit begleiten und durch ihre versammelte Kompetenz vielleicht sogar mitbestimmen? Mitbestimmen! Ich spreche hier bewußt nicht von »Gestalten«, aber natürlich denke ich diesen Aspekt in visionslosen Zeiten klammheimlich mit.
Nun, wo ist sie, unsre Elite? Gewiß, die Rolle der Medien hat sich grundsätzlich geändert, Eventjournalismus und marktschreierische Zuspitzung sämtlicher Wortmeldungen auf ihren Knalleffekt (auf daß durch solche »Hingucker« das eigne Organ ein Profil bekomme) sorgen nicht gerade für die seriöse Grundstimmung, die eine subtile Diskussionskultur überhaupt erst ermöglicht. Überdies ist der öffentliche Raum bis hinein in seine Nischen überbesetzt, es gibt ganz einfach zu viele Fernsehkanäle, zu viele Zeitungen, aber auch zu viele Journalisten, zu viele Schriftsteller, summa summarum: Es gibt zu viele Stimmen im öffentlichen Gespräch, so daß man sich manchmal vor lauter Lärm am liebsten die Ohren zuhielte und weit, weit weg wünschte. Wie sollte man aus dem allgemeinen Krakeel noch dasjenige heraushören können, was jenseits des auf Häppchenformat Zurechtgestutzten Relevanz hätte; und wem, der eigentlich etwas zu sagen hätte, wäre es zu verargen, wenn er sich angesichts des anhaltenden Getöns lieber wieder dorthin zurückzieht, wo er vielleicht noch gehört und sogar verstanden wird – ins Private?
Doch daran liegt es selbstverständlich nicht. Es liegt an der individualistischen Grundverfaßtheit der 78er, daß eine neue Elite, eine auf neue Weise heterogene Gemeinschaft höchst unterschiedlicher Intellektueller, noch immer nicht im deutschen Kulturleben absehbar ist und zu unseren Lebzeiten vielleicht auch niemals in Erscheinung treten wird. Alsdann, so müssen wir es, nach Habermas, Walser, Grass, Enzensberger & Co., weiterhin jeder für sich anpacken, sofern uns das Gewissen treibt, und darauf hoffen, daß wir mangelnde Synergien der Vernetzung mit persönlicher Leidenschaft wettmachen. Denn eine in ihre Sub- und Parallelgesellschaften zerfallene Interessengemeinschaft der Vorteilsnutzer und Bescheidwisser, deren gemeinsame Werte nur noch in den Depots der großen Fondsgesellschaften zu finden sind – und auf nichts anderes läuft ein postideologisch pragmatisches Staatswesen ohne jedes metaphysische Korsett ja hinaus –, können wir auch als überzeugte Einzelgänger nicht mit einem bloßen Achselzucken quittieren.