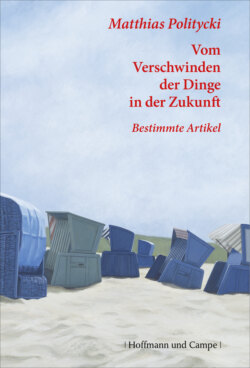Читать книгу Vom Verschwinden der Dinge in der Zukunft - Matthias Politycki - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWeißer Mann – was nun? – revisited
Unser Recht auf Ungläubigkeit
Ist Deutschland ein Übernahmekandidat? Man bedenke, daß der voangehende Essay im Spätsommer ’05 geschrieben wurde, zu einem Zeitpunkt, da Karikaturenstreit, Aufstand der Migranten in den Pariser Vorstädten, Foltermorde an Juden (ebenfalls in Frankreich), Wahlsieg der radikalpalästinensischen Hamas, ein weiterer Krieg zwischen Israel und seinen Nachbarn in weiter Ferne lagen – und mit ihm der ganze Themenbereich »Kampf der Religionen« bzw. eigentlich: der Weltanschauungen. Daher wurde er mit folgender Einleitung versehen:
Nun ist es plötzlich vorbei mit Abwarten-und-Jammern, die allgemeine Verzagtheit in Deutschland weicht zusehends einer unerwartet betriebsamen Aufbruchsstimmung. Eifrig werden Leitartikel geschrieben und Manifeste verfaßt, ja vor allem auch ersehnt, verlangt, mitunter gewaltsam herbeigezwungen, als ob man auf diese Weise wenigstens anderen schon mal die Entschlossenheit unterschieben könnte, die man selber noch nicht hat: Der schleichende Niedergang der Parteiendemokratie [Vgl. dazu »Jungs, nehmt den Finger aus’m Arsch, es gibt Arbeit«, S. 42ff] und »Weniger Demokratie wagen«, S. 55ff., wie wir ihn als Telekratie seit Jahren miterleben müssen – als Simulationsterror der Meinungsbarometer und Talkshows, die mit ihren Standardmoralkeulen fast jedes authentische Sprechen unmöglich machen –, hat ein gefährliches Machtuakuum bewirkt, das nicht etwa nur von »Frustrierten«, sondern vor allem von der intellektuellen Mitte unsrer Gesellschaft wieder neu gefüllt werden will.
Doch selbst wenn das gelänge (und nebenbei das Kunststück, aus einem hochverschuldeten Sanierungsfall ein florierendes Restart-up-Unternehmen BRD-II herauszulösen), stünde dahinter nach wie vor als weit größeres, zentraleuropäisches Problem: der drohende Abstieg des ehemaligen »Westens« als eines seit Generationen gepflegten Lebens- und Kulturprinzips, vergleichbar demjenigen der habsburgischen k.u.k. Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg. Mit der Postmoderne und ihrem zersetzenden »Anything goes« haben wir das Ende der Aufklärung erreicht, ist die Skepsis der Freigeisterei so weit fortgeschritten, daß sie anstelle ernsthafter Visionen nurmehr eine müde Generalironie entwickelt, ein achselzuckendes Laissezfaire, Tarnvokabel »Toleranz«, gegenüber allem und jedem: Das entsprechende Erstarken inter- wie intranationaler »Ränder« wird uns eine Unzahl an Sub- und Parallelwelten bescheren, wird am Ende auf eine radikale Parzellierung der Gesellschaft hinauslaufen – nicht zuletzt aufgrund passiver Eliten, die dem Zerfall des Ganzen zur bloßen Summe seiner Teile nichts entgegenzusetzen haben und dies auch längst nicht mehr wollen.
Jenem uneuphorischen Auftakt zum Trotz: Hier schreibt kein resignierter Ex-Rot-Grüner, am allerwenigsten ein verkappter Rechter, der mit seiner These vom »Untergang des Weißen Mannes« erst sämtliche Frauen- und Multikultibeauftragten hinwegbeleidigen und anschließend eine krawattengeschnürt neokonservative Revolution ausrufen möchte. Im Gegenteil, das ist ja bereits Teil des Problems, die meisten, mit denen ich in letzter Zeit gesprochen habe, gehören – obwohl allesamt überzeugte Demokraten – einer viel zu lang schon schweigenden Mehrheit an, die unter ihren politischen Repräsentanten kaum noch einen ausmacht, uon dem sie sich angemessen repräsentiert fühlt: Deshalb kommt ja nun endlich, wo diese parteipolitisch entwurzelte, gefährlich hin und her schwankende Mitte zu einer neuen Sprache finden muß, eine Diskussion in Schwung, die ein verschärftes Aufmucken freischwebender Intellektueller jenseits des überkommenen Links-Rechts-Denkschemas erkennen läßt.
Damals, nach dem Scheitern von Rot-Grün und dem Vorziehen der nächsten Bundestagswahl auf den 18. September, standen Pro und Contra eines grundsätzlichen Kurswechsels deutscher Innenpolitik auf der intellektuellen Agenda; daß es in weiten Teilen der Welt gerade spürbar ungemütlicher wurde und man das nicht beliebig lange als atavistisches Getöse von Globalisierungsverlierern würde marginalisieren können, ließ sich im allgemeinen Aufbruchstaumel leicht als störende Panikmache beiseite schieben. Heute, ein ernüchterndes Jahr später, spricht jeder von der Rückkehr der Religionen, die man im Zeitalter der Digitalisierung gar nicht mehr, und schon gar nicht so heftig, erwartet hätte. Tut dies freilich auf solch kennerhaft selbstverständliche Weise, als hätte man’s insgeheim trotzdem schon immer gewußt, daß – ja, was denn? Daß wir uns seit dem 11. September 2001 im weltweiten Kampf der Kulturen befinden, einer geostrategischen Neuaufteilung der globalen Landkarte wie zu Zeiten des Kalten Krieges? Nur daß es jetzt ein Heiliger Krieg ist und also zukünftig auch kein Eiserner Vorhang, sondern ein Eiserner Schleier sein wird, der die Demarkationslinie zwischen »gläubigen« und »ungläubigen« Gebieten markiert? Wer könnte mittlerweile noch so tun, als sei dem nicht so; wer könnte’s noch wagen, die alte Zauberformel vom »Dialog der Kulturen« herunterzubeten, wenn die al-Quaida in der ihr eignen markigen Diktion »die ganze Welt als offenes Schlachtfeld« deklariert und »Muslime überall [auffordert], zu kämpfen und Märtyrer im Krieg gegen die Zionisten und die Kreuzfahrer zu werden« (Videobotschaft, zit. nach: SZ, 28. 7. 2006)?
Denn natürlich meint das nicht nur Israelis und Amerikaner, das meint – und spätestens mit den Fernsehbildern von brennenden deutschen Fahnen (anläßlich einer im Grunde pazifistischen Äußerung des Papstes im September 2006) müßte das sogar hartgesottnen Multikultiträumern klargeworden sein –,[42] das meint auch uns, meint uns alle. Ein Großteil der islamischen Welt sucht die Konfrontation, und daß dieser Kampf der Weltanschauungen von einigen Feuilletonisten alter Schule stereotyp als »dumpf« etikettiert wird, trägt wenig zur Erhellung des komplexen Problems bei. Im Spätsommer ’05 jedoch schien das Thema in seiner ungeschminkt entsetzlichen Konsequenz – Ermordung des islamkritischen Filmemachers Theo van Gogh am 2. 11. 2004 incl. Bekennerschreiben, dem Sterbenden mit einem Messer in den Bauch gerammt – erst in den Niederlanden angekommen und also noch weit weg zu sein; entsprechend hoch schlugen die Wogen nach Veröffentlichung von »Weißer Mann – was nun?«. Daß sich die entzauberte Welt unsres spätkapitalistischen Turbo-Individualismus auf die Herausforderungen ganzheitlicher Lebensformen einzustellen habe (wie sie jede religiös strukturierte Gesellschaft anbietet), ging damals noch ans Eingemachte, rührte an ein Tabu, wie es in Zeiten transzendentaler Obdachlosigkeit anscheinend als ausgemacht gilt: »Alles Spirituelle ist suspekt«, so die stillschweigende Überzeugung unsrer mehrheitlich atheistischen Avantgarde, »und wer sich nicht zumindest ironisch damit auseinandersetzt, der ist es ebenfalls«. Typisch postmodern? Für die Unmengen an zustimmenden bis euphorischen Leserbriefschreibern – meist Menschen, die länger im Ausland gelebt hatten – war die Postmoderne zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht angebrochen oder schon wieder beendet.
So oder so, ein jahrzehntelang kaum ernsthaft hinterfragter Common sense der bundesrepublikanischen Gesellschaft war an einer empfindlichen Stelle getroffen; die Stellungnahmen, die man in Folge auf Diskussionspodien und in Rundfunksendungen von mir erwartete, waren entsprechend einseitig. Aber wie wären diese Erwartungen zu erfüllen gewesen? Wer Religion predigt, hat sie in der Regel verloren, das weiß man doch nicht erst seit gestern, ansonsten würde er sie schließlich praktizieren. Hat sie unwiederbringlich verloren; auch wenn ich mich als hartgesottener Atheist auf Kuba immerhin an die Vorstellung gewöhnen mußte, daß Gläubige mitnichten »simpler gestrickt« waren als Glaubenslose, daß sie sich durch ihre Ausrichtung auf ein Jenseits keinen Deut »unfreier« im Diesseits fühlten, daß sie sich trotz ihrer Offenheit gegenüber dem Mysterium keineswegs als »irrationale«, »unaufgeklärte« Vertreter einer niedrigeren Zivilisationsstufe abtun ließen. Und das, obwohl ich es nicht mit irgendeiner diffus gefühligen fernöstlichen Schweige- oder indianischen Schwitzhüttenreligiosität zu tun bekommen hatte, sondern mit ziemlich deftigem Hardcore, der hierzulande selbst in seiner Voodoo-Klischeeform ein unwohles Gruseln erzeugt.
Mit wie vielen Ausrufezeichen hatte ich mich in diese afrokubanischen Kulte hineinbegeben, in der Haltung des hochmütig-ethnologischen Beobachters, der alles, was er sehen und erleben würde, schon im vorhinein als Mumpitz rubriziert hatte; und mit wie vielen Fragezeichen war ich zurückgekehrt nach Deutschland, in die vertraute und doch mit einemmal merkwürdig öde Geheimnislosigkeit einer säkularen, im Grunde gottlos-hedonistischen Gesellschaft. Noch heute habe ich eher Fragezeichen als Ausrufezeichen zu diesem ganzen Themenkomplex anzubieten, betone aber gern auch an dieser Stelle, daß ich mich nach wie vor im Zweifelsfall, ohne eine Sekunde zu zögern, auf die Seite des Individualismus und des Rechts auf Ungläubigkeit schlagen würde. Gerade deshalb, weil ich ganz genau weiß, wo ich stehe, habe ich an den Fragen, wie ich sie im Jahre 2005 gestellt habe, auch jetzt kein einziges Wort zurückzunehmen.
Und gar im anstehenden Weltkonflikt! Der hat in seiner fundamentalistischen Grundierung nichts, aber auch gar nichts mit den Mysterien gemein, wie man sie in den polytheistischen Ritualen der Karibik erleben kann; gegen einen militanten Monotheismus (nicht etwa nur den islamischen) gibt es nur ein einziges Mittel: das robuste Mandat, wie es in meinem Essay ja benannt ist. Zunächst allerdings ist endlich zu begreifen, daß wir der transzendentalen Herausforderung nicht mit altgewohnter Blasiertheit Herr werden können:
Da verschickt ein 61jähriger aus dem Ruhrgebiet – und zwar mitten im Karikaturenstreit, überall auf der Welt brennen dänische (und verwechslungshalber auch Schweizer) Flaggen, gibt es Tote bei moslemischen Massenaufmärschen, werden von Fanatikern sogar vereinzelt Priester ermordet –, da verschickt einer Toilettenpapier mit dem Aufdruck »Der Heilige Koran« an Fernsehanstalten und islamische Einrichtungen, im Begleitschreiben bezeichnet er den Koran als »Kochbuch für Terroristen«. Selbstverständlich protestiert die iranische Regierung beim Auswärtigen Amt, gibt es Morddrohungen, muß der Mann untertauchen. (SZ, 24. 2. 2006) Hallo, Titanic? Leider nein. Ein bißchen mehr Achtung vor den Wahrheiten und Werten einer Weltreligion stünde uns als den möglichen Verlierern der globalen Kräfteverschiebungen gut an.