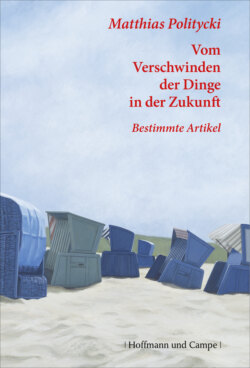Читать книгу Vom Verschwinden der Dinge in der Zukunft - Matthias Politycki - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weniger Demokratie wagen
ОглавлениеZwei Essays kurz vor bzw. nach Beginn der Ära Schröder, ein Thema: Krise der Parteien (zu derjenigen der Grünen s. »Sitzpinkler«, S. 61ff.), Krise des demokratischen Systems. Wie sieht das heute, nach dem Amtsantritt von Frau Merkel und ihrer Großen Koalition, aus? Kurz gesagt: kein bißchen weniger besorgniserregend als damals.
Die Umfragewerte der großen Volksparteien sind seit Monaten im Keller, der Grund dafür ist in beiden Fällen derselbe: Man weiß schlichtweg nicht mehr, wofür sie eigentlich stehen. »Die SPD hat ihren Markenkern in der Sozialpolitik und als Friedenspartei verloren«, konstatiert der Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner (Die Welt, 16. 8. 2006); sein Kollege Manfred Güllner sieht sie deshalb bereits in einer »existentiellen Krise«: »Sie geht in die Auflösung, wenn sie das weiter ignoriert.« (ebd.) Nicht besser steht es um die CDU: »Viele klassische Unionswähler sehen das Christdemokratische in der Regierung nicht«, moniert die CSU an ihrer Schwesterpartei (SZ, 8. 8. 2006); auch in den eigenen Reihen regt sich Protest über den Kurs von Angela Merkel: »Wir verlieren offensichtlich bisherige Stammwähler, ohne neue Wählerschichten zu erschließen«, mahnt Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm: »Es sei nicht erkennbar, ob die Partei einer Linie folgt, und wenn ja, welcher.« (Zit. nach: SZ, 7. 8. 2006)
»Programmatisches Aquaplaning« (Edmund Stoiber, zit. nach: SZ, 4. 9. 2006) hier wie dort – nur folgerichtig, daß sowohl CDU wie SPD während des Sommers 2006 mit Standortsuche beschäftigt waren, daß sie Grundsatzdebatten führten und Richtungsweisendes erwogen. Selbstverständlich war dabei wieder viel von der »Mitte der Gesellschaft« die Rede, der neue SPD-Vorsitzende Kurt Beck rückte sie ins Zentrum eines runderneuerten Selbstverständnisses seiner Partei: Lösungen politischer Fragestellungen solle man nicht mehr quasi automatisch vom unteren, sondern vom mittleren Drittel der Bevölkerung andenken. Gut, aber wurde das von der Sozialdemokratie nicht schon immer so oder ähnlich gesagt, getan? Und war Anbiederung an den Mainstream nicht das Problem aller größeren Parteien während der letzten Legislaturperioden, die Angleichung der zur Wahl stehenden Produkte bei gleichzeitigem Versuch, sie durch rhetorische Aufladung mit Lebensgefühl als Marke kenntlich zu halten, als Label? Die herrschende Praxis der mehr oder weniger stillschweigenden Anverwandlung ursprünglich parteifremder Themen bzw. Thesen ging bereits damals so weit, daß es selbst für Profis schwer war, tatsächliche Unterschiede zwischen den Positionen zu benennen: Unter www.wahl-o-mat.de konnte sich derjenige, der trotzdem an der Bundestagswahl 2005 teilnehmen wollte, nach Beantwortung von 27 Fragen seine eigene Parteipräferenz ausrechnen lassen. Vom Ergebnis dieses Tests wurde ich übrigens nicht wenig überrascht, war ich bis dato doch fest entschlossen gewesen, meine Stimme einer ganz anderen Partei zu geben.
Der ich sie dessen ungeachtet dann auch gab; insofern wählte ich die Etikette anstelle des Inhalts – nicht gerade eine demokratische Hochleistung. Gleichwohl ein Beitrag zu einer entscheidenden Richtungs-, ja Schicksalswahl, zu der sie damals von allen Seiten hochstilisiert wurde und bei nächster Gelegenheit wieder hochstilisiert werden wird. Welches Schicksal? ist da allerdings zu fragen. Als ob sich unter einer wie auch immer zusammengestellten »schwarzen« oder »roten« Bundesregierung irgend etwas Grundsätzliches ändern würde! Wer muß denn heute noch Angst vor einer CDU/CSU haben, in der kein einziger Franz Josef Strauß herumpoltert, wer vor einer SPD, in der kein einziger Herbert Wehner den Proleten gibt?
Derart widerständige Charaktere haben die Volksparteien nicht mehr vorzuweisen, obendrein werden ihre theoretischen Profilierungsversuche von den eignen Mitgliedern nach Kräften konterkariert: Ausgerechnet Roland Koch, nicht gerade für sein soziales Engagement bekannt, gibt sich als warmherziger Laudator bei einer Jubiläumsfeier der hessischen Gewerkschaft (SZ, 31. 8. 2006); Franz Müntefering, noch als Heuschreckenjäger in Erinnerung, bemüht sich im Rahmen der Großen Koalition oft händeringend, originäre CDU-Konzepte gegen den Willen der eignen Basis durchzupauken; und selbstverständlich kommt es auch auf Landesebene zu den abenteuerlichsten Cross-over-Projekten, vorläufiger Höhepunkt: Zur Cottbuser Bürgermeisterwahl am 22. 10. 2006 tritt ein CDU-Mann an, der bereits vorab eine Koalition mit FDP, Unabhängigen, Frauenliste und Linkspartei/PDS geschmiedet hat (SZ, 30. 8. 2006).
Nun mutete schon seinerzeit einer wie Otto Schily nicht selten wie die Personifikation der konservativen Assimilation an, und das als ehemaliger Grüner. Aber unter der alles ausgleichenden Regie von Angela Merkel sind die jahrzehntelang verteidigten Lager in Deutschland wirklich aufgebrochen, endgültig aufgebrochen, hat sich politisches Handeln zur undogmatischen Bewältigung anstehender Fragen reduziert. Was aus der Sicht eines Nach-68ers ein Segen ist, für den die pragmatische Lösung von Problemen schon immer wichtiger war als die Frage, ob man sich dabei als »rechts« oder als »links« verstand, ist für die beiden Volksparteien freilich ein Fluch:
Nachdem der Abschied von einer bipolar strukturierten Nachkriegsgesellschaft auch auf der Ebene der Tagespolitik vollzogen ist, zeigt sich, daß in unsrer Öffentlichkeit ganz andre Gegensätze aufbrechen, als sie die großen Volksparteien bis eben noch zu repräsentieren schienen.[83] Wir leben im Zeitalter der Hyperindividualisierung; die neuerdings so gern beschworene Drei-Drittel-Gesellschaft ist de facto in zahlreiche Parallelgesellschaften und diese wiederum in allerkleinste Grüppchen zersplittert. Kein Wunder, daß die Zeit der bürgerlichen Parteien abläuft, wenn für uns auch im engsten Umfeld nur noch der einzelne von Relevanz ist. Möglich, daß an ihre Stelle demnächst eine Vielzahl spezialisierter Kleinstparteien tritt, sozusagen Stände- und Spartenvertretungen mbH (etwa für alleinerziehende Mütter, arbeitslose Akademiker); und wie sich allein durch ihre Existenz das gesamte politische System verändern wird, hat die Schill-Partei bei der Hamburger Senatswahl 2001 angedeutet (19,4 Prozent der Stimmen!), auf Bundesebene 2005 auch das Bündnis Linkspartei/PDS. Leider ist nicht wirklich zu hoffen, daß es auch in Zukunft nur bei einmaligen Protestwahlen bleibt, daß sich unser politisches Klima durch den schlagartigen Auf- wie Abstieg radikaler Splitterparteien nicht nachhaltig erhitzt.
Was bleibt der bürgerlichen »Mitte«, um die sich CDU/CSU und SPD derzeit im Glauben bemühen, es gäbe sie noch, was bleibt ihren versprengten Vertretern angesichts der grundsätzlichen Deregulierung des Gesellschaftlichen? Keine Parteien, keine Programme. Aber doch wohl einzelne Personen, die nicht erst demokratisch gewählt werden müssen, sondern qua Amt (am besten: als Papst) oder Stimme (am besten: als »Kaiser«) legitimiert sind, sich im Sinne dieser nurmehr gefühlten Mitte mit ihrer Stimme zu artikulieren. Unabhängige Bürger aus dem Wissenschafts- und Kulturleben; weit eher jedenfalls als Parteipolitiker, deren beständig auf maximale Zustimmung berechnete Vertuschungsrhetorik mittlerweile einen Grad an Unverbindlichkeit erreicht hat, der sie für viele so glatt und austauschbar erscheinen läßt wie Fußballspieler, wenn sie sich zum eben beendeten Spiel äußern. Nicht nur Politiker haben auf diese Weise ihre emotionale Strahlkraft verloren, der gesamte Prozeß des öffentlichen Gesprächs ist über Jahre hinweg zunehmend medial überformt und damit sukzessive ausgehöhlt worden: Die fernsehgerechte Inszenierung sämtlicher demokratischen Rituale wird von einer bestürzenden Zahl von Bürgern mittlerweile als »Theater« empfunden, bei dem sie nicht mehr mitspielen wollen; eine »ehrliche Politik«, wie sie in schöner Regelmäßigkeit von den Parlamentariern versprochen wird (zuletzt von Jürgen Rüttgers, der damit prompt beim CDU-Parteitag in die Schranken gewiesen wurde), scheint ihnen ein Widerspruch in sich.
Mediendemokratie, ist sie wirklich nichts andres als die geschickte Manipulation von Meinungen mittels medial erzeugter Affekte; ist für den Erfolg eines Politikers heutzutage tatsächlich seine Medienkompetenz ausschlaggebend, nicht seine Sachkompetenz? Man erinnere sich der beiden Kanzlerkandidaten und ihrer Fernsehduelle im Sommer 2001: Was nützten Stoibers Zeterzahlen, wo ein Schrödersches Lächeln bereits für Abhilfe sorgte? Und wäre selbst das mittlerweile egal, weil sich das Kräfteverhältnis zwischen Politik und Ökonomie sowieso massiv zugunsten letzterer verschoben hat? So daß die gewählten Volksvertreter, ob medienkompatibel oder nicht, vollauf mit Moderation, Beschwichtigung und Austarieren der diversen wirtschaftlichen Interessen beschäftigt wären? Immer häufiger hört man, die konkrete Regierungsarbeit sei durch die Macht der Lobbyisten bereits arg beschränkt, ihrem gewachsenen Einfluß sei es zuzuschreiben, daß manche Gesetze vom Visionären scheibchenweise aufs angeblich Gerade-noch-Machbare zurechtgekürzt – oder sogar, in juristisch komplexen Fällen, von den Rechtsabteilungen der entsprechenden Verbände bis in die Gesetzesformulierungen hinein erarbeitet und in den Fachausschüssen dann nurmehr abgenickt – werden.[84]
Professionelle Anpassung an die Naturgesetze der Globalisierung, die derzeit aktuelle Form des Darwinismus? Fraglos ist, daß wir gegenwärtig einen gewaltigen Paradigmenwechsel erleben, die angebliche Eigendynamik eines weltweiten Umbruchs, der mit dem stereotypen Hinweis auf ökonomische Sachzwänge unser aller Handlungsspielraum einengt, auch denjenigen von Parlamentariern.[85] »Höhere Gewalt«! Längst haben wichtige Konzerne und Verbände in unmittelbarer Nähe der Regierungsgebäude Niederlassungen eröffnet, von denen aus zeitnah operiert werden kann; übernationale Global Players diktieren den Regierungen ganz offen, welche Autobahnen man zu ihrem Werk bauen und wie lange man ihnen die Steuern erlassen müsse, auf daß sie das angeblich unrentable Wirtschaften in diesem Lande nicht auf der Stelle einstellen und ostwärts ziehen: Die tatsächliche Macht ist von den Politikern – und nicht nur in Deutschland – auf Wirtschaftsbosse und Verbandspräsidenten übergegangen, ist damit sehr viel diskreter geworden, undurchschaubarer, mit einem Wort: undemokratischer. Was wir an demokratischer Willensbildung via Medien miterleben, ist oft nurmehr Simulation demokratischer Prozesse, ohne tatsächliche Folgen gewärtigen zu müssen – man erinnere sich der Debatte um die Rechtschreibreform und die dahinterstehenden wirtschaftlichen Interessen –, unsre traditionellen Repräsentationsstrukturen sind ornamental geworden.
Ein neoliberal dereguliertes Staatswesen verschiebt die Macht mit jeder Liberalisierungsentscheidung eines nationalen oder europäischen Parlaments bzw. Gerichtshofs ein kleines Stückchen weiter Richtung Shareholder’s value. Während die offizielle Politik diesen Machtverlust als »schlanken Staat« zu bemänteln sucht, erhebt sich in der Öffentlichkeit immer häufiger der Ruf nach »mehr Demokratie«, die Zahl der Volksbegehren und Bürgerentscheide ist während der letzten Jahre kontinuierlich angewachsen, manch einer wünscht sich blauäugig die ganze Berufspolitik zum Teufel und an ihrer Statt einen ständig tagenden Bürgerkonvent. Direktdemokratie! Und wie die entsprechenden Schlagworte alle heißen; übersehen wird dabei die grundsätzliche Politikmüdigkeit, die uns in Form einer habituellen Resignation mittlerweile alle mehr oder weniger ergriffen und unsre politische Mündigkeit arg reduziert hat. Schon an der Uni schlug derjenige, der eine langwierige Entscheidungsfindung der Lächerlichkeit preisgeben wollte, im aufgeregten Ton älterer Tugendwächter vor, man möge doch bitte darüber abstimmen: Die demokratische Urgeste als symbolhaftes Eingestehen von Entschluß- und Handlungsunfähigkeit.
Und mittlerweile? Die Anzahl der Wahlverweigerer stellt seit langem unsre größte »Volkspartei« dar, und ein Ende des unheilvollen Trends ist nicht in Sicht: »Die Zahl der Politikverweigerer wächst und wächst«, konstatierte Stephan Lebert schon vor der Bundestagswahl 1998: »Heute kann man wohl schon eine weitverbreitete Abkehr von der Demokratie beklagen« (SZ, 27. 7. 1998). Dabei lag die fiktive Partei der Nichtwähler zum Beispiel bei den damaligen Wahlen zum Berliner Senat erst bei 32 Prozent, also bei Volksparteienstärke; mittlerweile verweigern mitunter schon weit über die Hälfte der Wahlberechtigten den Gang zur Urne, wie man dem Online-Portal der Bundeszentrale zur politischen Bildung anläßlich der Landtagswahlen 2006 entnehmen kann: »Sachsen-Anhalt stellte einen Negativrekord auf: Lediglich 44,4 Prozent der etwa 2,1 Millionen Wahlberechtigten fanden den Weg zur Urne. Das ist die bundesweit geringste Wahlbeteiligung, die es je bei einer Landtagswahl gegeben hat. Auch in Baden-Württemberg fiel die Wahlbeteiligung mit 53,4 Prozent auf einen historischen Tiefstand …« (Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de)
Zum Vergleich: »Bei einer Auslastung von unter 80 Prozent würde jeder Theaterintendant vom zuständigen Kulturausschuß geschaßt werden.« (Adrienne Goehler, 8. 9. 2006, mdl. Mitteil.) Traurig, aber unvermeidbar, sich zu fragen, ob man angesichts eines derartigen Repräsentationsvakuums überhaupt noch von einer demokratisch gewählten Volksvertretung sprechen kann. Noch trauriger, sich einzugestehen, daß es sich bei jenen Wahlverweigerern keineswegs nur um gesellschaftliche Verlierer oder rechte Dumpfbacken handelt, im Gegenteil, gerade diejenigen, die sich früher besonders engagierten, kehren dem Staat enttäuscht den Rücken. Mehr Demokratie? Wenn es unser politisches System nicht schafft, sich auf seinen Wesenskern zu besinnen, sprich, sich an den Rändern von überflüssigem Blendwerk zu trennen, wird das Macht- und Repräsentationsvakuum, das sich in unserer Gesellschaft derzeit bildet, womöglich bald auf unschön derbe Weise gefüllt werden. Und das kann kein wahrer Demokrat wollen.
Weniger Demokratie wagen – welch ein Tabubruch! Und wo sollte man da überhaupt anfangen? Mit der Abschaffung jedweder Umfrage-Betriebsamkeit zum politischen Klima, mit PISA-Tests für Wahlberechtigte, mit Modifikationen des Wahlrechts zugunsten parteiunabhängiger Einzelpersonen, mit dessen Beschränkung auf die Über-Vierzigjährigen wie im alten Rom? Vielleicht erst einmal: mit dem Abhalten aller Landtagswahlen an einem einzigen Datum, am besten in der Mitte der Bundestags-Legislaturperiode, um aus der Tretmühle eines fortgesetzt auf Quoten schielenden Politpopulismus herauszukommen; mit Verkürzung von Wahlkampf- und Verlängerung von Wahlperioden, auf daß substanzielle Reformen ohne ständige Angst vor Politbarometern durchgeführt werden könnten; auch: mit Entschleunigung der Berichterstattung, Verringerung des Mediendrucks, mit freiwilliger Selbstbeschneidung medialer Empörungskultur, auf daß politisch nicht ganz korrekt formulierte Ideenimpulse nicht immer gleich unter der Moralkeule von Tugendwächtern enden – was weiß denn ich. Und schließlich – schließlich! – wäre zu bedenken, ob in einem demokratischen Staat wirklich alles und jedes demokratisch entschieden werden muß oder ob sich hinter diesem weitverbreiteten Lippenbekenntnis nicht nur eine andre Form von Totalitarismus verbirgt.
Die schiere Mehrheit ist in vielen Fällen der schlechteste Ratgeber; was aber wäre die Alternative? Ökodiktatur des Rats der Weisen? Offne Übernahme der Macht durch den Bundesverband der deutschen Industrie? Oder doch lieber wieder ein König? Stärkung aller nichtdemokratisch legitimierten Institutionenals Qualitätskontrollegegenüber den Fehlentscheidungen der Quotenpolitik? »Deutschland ist strukturell verharzt«, schreibt Stefan Kornelius in einem Leitartikel der Süddeutschen Zeitung (26. 9. 2005), es stehe »am Rande einer Staatskrise«, weil es »sich verhakt hat in einem sich selbst kontrollierenden und strangulierenden System«. Auch unser Land könne einen Jimmy Carter gebrauchen, der sich als pensionierter US-Präsident entschlossen habe, die Kommission zur Reform des Wahlrechts zu leiten, weil »zu viele US-Bürger kein Vertrauen mehr haben in den Wahlprozeß« (O-Ton Carter). Stefan Kornelius kommt im Hinblick auf Deutschland zum Schluß: »Vielleicht bedürfte es einer Kommission, nicht zur Reform des Wahlrechts, sondern zur Belebung des Systems.« Darin müßte sich freilich dann auch jemand finden, der den gordischen Knoten des Systems ganz, ganz vorsichtig aufschneidet. Nicht die demokratischen Institutionen gälte es dabei zu schützen, sondern das demokratische Prinzip.