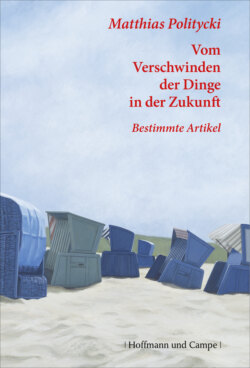Читать книгу Vom Verschwinden der Dinge in der Zukunft - Matthias Politycki - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weißer Mann – was nun?
ОглавлениеEin Nachruf zu Lebzeiten
Wer sich ein bißchen außerhalb Europas herumgetrieben hat, weniger als Tourist denn als Reisender, und dabei manchmal, wie ich, gerade noch mit dem Schrecken davongekommen ist, wird vielleicht schon ahnen, was ich im folgenden schlaglichtartig zu beleuchten suche, wenn ich vom »Untergang des Weißen Mannes« spreche. Ich gebrauche den Begriff ausdrücklich nur in polemischer Absicht – als Kürzel für das, was ich unter der kerneuropäischen, nach wie vor der Aufklärung verpflichteten Spielart westlicher Kultur verstehe; mit der Hautfarbe im engeren Wortsinn hat er lediglich metaphorisch zu tun. Daß die gewählte Metapher zu einigen Karl-May-haften Assoziationen reizt, darf nicht davon abhalten, sie für komplexere Gedankengänge zu funktionalisieren; die Wirklichkeit läßt sich nun mal am besten demaskieren, wenn man sie erst einmal auf ihr Klischee reduziert.
Für die Recherchen zu meinem Roman »Herr der Hörner« lebte ich einige Monate auf Kuba, im schwarzen Süden der Insel, und zwar nach Möglichkeit nicht wie ein Dollar-Tourist, sondern auf Peso-Basis: eine unvergeßliche Zeit, in deren Verlauf ich sämtliche Positionen, für die ich früher fraglos einstand, zu überdenken hatte. Eine Zeit auch, in der ich mitunter den Tränen nahe war, so hart empfand ich sie, körperlich wie seelisch. Die Brutalität des alltäglichen Lebens, keinerlei Rücksicht auf die moralischen oder gar ästhetischen Standards eines Alten Europäers nehmend, häufig noch nicht mal die allermindesten Höflichkeitsformen beachtend, diese ungebremste Wildheit des Willens, die sich nicht selten in schierer Gewaltanwendung Bahn brach – durfte ich sie als Mangel an Kultur verachten? Oder hatte ich sie als Überschuß an Vitalität zu bewundern, angesichts dessen ich von vornherein den kürzeren zog? Daß man sich, nach ein, zwei Stunden Schlangestehen für ein Brot, schließlich um den Einlaß in die Bäckerei prügelte, konnte ich noch verstehen; daß man das auch um einen Sitzplatz im Bus tat, schien auf mehr zu deuten als den puren Kampf ums Überleben, auf einen Kraftüberschuß zumindest, von dem man sich im saturierten Europa keine Vorstellung macht. Wohlgemerkt, es ging nicht um die Lust randalierender Banden, sich an Schwächeren auszutoben, sondern um spontane Energieentladung einzelner, bei denen sich ganz offensichtlich so viel angestaut hatte, daß sie’s bei erstbester Gelegenheit ablassen mußten.
Wohingegen ich? zunächst stirnrunzelnd danebenzustehen suchte, wenn sich die archaische Grobheit des Alltags mal wieder Bahn brach, auf Dauer aber so nicht weiterkam. Was tun? Mitunter war ich so restlos beschämt von diesen Eruptionen physischer Macht – und sie spiegelte sich für mich noch in der machohaften Heftigkeit gewisser Begrüßungscodes –, daß ich mir einzureden suchte, in meiner weißen Haut die epochale Erschöpfung der gesamten Alten Welt zu spüren; es half mir gar nichts, die schiere Schwäche angesichts des Faktischen als Überlegenheit einer verfeinerten Vernunft zu camouflieren. Im Gegenteil, bald spürte ich die Kraft dieser Menschen auch dann, wenn sie nur herumlungerten und mich vom Straßenrand beobachteten, da lag mitunter ein Lauern in der Luft, daß man sich als Europäer jedenfalls arg zusammenreißen mußte, um erhobnen Hauptes seiner Wege zu gehen.
Die größte Massenschlägerei habe ich freilich gar nicht in Kuba, sondern im schwarzen Südzipfel von Indien erlebt, auch hier in der Rolle des (einzigen) Weißen, der seine körperliche Unterlegenheit mit der Überlegenheit dezenter Zurückhaltung zu kaschieren suchte: in Trivandrum, einem tristen Millionendorf, dessen Sehenswürdigkeiten selbst von Gutwilligen innerhalb eines halben Tages abgehakt sind. Bleibt ein Besuch im Zoo, warum nicht, und erstaunlicherweise wartet man vor dem Eingang nicht allein, zusehends gesellen sich Paare und Passanten dazu, und als das Kassenhäuschen dann endlich öffnet: herrscht im Handumdrehen eine solch ernsthafte Schlägerei um die Plätze, jeder will der erste sein – nicht in einer Bäckerei, deren Angebot aller Voraussicht nach nicht ausreichen wird, nein!, sondern in einer Freizeitanlage, bei deren Besuch man zwischen traurig dahinsiechenden Tieren eine Art Freizeitdepression erleiden wird. Zuvor aber, ich übertreibe nicht, mußte die Polizei anrücken, um mit wahllos ausgeteilten Schlagstockhieben wenigstens vorübergehend eine Ordnung wiederherzustellen: Klaglos nahmen die potenziellen Zoobesucher die Prügel hin, duckten sich Richtung Kassenhäuschen, denn von ihrem Ziel ließen sie nicht ab, um wenig später, wenn man ihnen drinnen wieder begegnete, den müßigen Flaneur zu geben.[21]
Was ist da eigentlich eben passiert? fragt man sich, während man das vereiterte Knie eines Lamas betrachtet: Welch ein gewaltiger Wille steckt in jedem einzelnen dieser ausgemergelten Kerle, daß sie allesamt vor dem bräsig abwartenden Europäer Einlaß fanden? Und wieso ist man in derartigen Szenarien stets der einzige, der sich zur Pauschalironie dessen flüchtet, der’s angeblich besser weiß? Während alle andern auf ganz unbeirrbare Weise ihr konkretes Ziel verfolgen, dafür einen Preis in Kauf nehmend, der bei unsereinem allenfalls die Frage aufwirft, ob man davon bleibende Schäden davontragen, ob man sie dann wenigstens bei irgendeiner Versicherung geltend machen könnte.
Und die bedrohlichste Erfahrung des Belauertwerdens? Nach wie vor wird mir unwohl, wenn ich an eine Situation in Burundi denke, die sich nur auf den ersten Blick als friedliche Straßenszene darstellte: Während einer der Pausen im damaligen Bürgerkrieg zwischen Tutsi und Hutu, der bereits zu nächtlichen Abschlachtereien unvorstellbaren Ausmaßes geführt hatte, fuhren wir auf einem umgerüsteten Lkw in die Hauptstadt des Landes ein, Bujumbura, und ich spüre noch heute dies intensive Lauern, das uns vom Straßenrand entgegenkam, aus jedem Hauseingang. Geradezu körperlich zu registrieren, selbst von instinktgeschwächten Weißen, daß es hier jeden Moment vorbei sein konnte mit der trügerischen Ruhe, daß sich etwas Bahn brechen konnte, bei dem höchstwahrscheinlich auch wir und unser Lkw auf der Strecke bleiben würden.
Wünschten wir uns in dieser Situation wenigstens Waffen? Nicht mal das wagten wir, anerkannte Kriegsdienstverweigerer oder jedenfalls überzeugte Humanisten, die wir waren, hatten im übrigen ausreichend zu tun, unsre schlimmsten Befürchtungen voreinander zu verbergen: Um Gottes willen, die würden doch nicht? die waren doch wohl denselben ethischen Werten verpflichtet wie wir? die konnten doch nicht einfach, aus heiterem Himmel? Oh, die würden sehr wohl, die waren überhaupt nicht, die konnten.[22]
An dieser Stelle fällt mir die Geschichte eines Farmers aus Zimbabwe ein, die durch die Presse ging: Zu Zeiten grassierender Zusammenrottungen schwarzer Landarbeiter, bei denen es, von Staats wegen stillschweigend gebilligt, zunehmend zu Exekutionen weißer Großgrundbesitzer kam, fragte der besorgte Farmer seine eignen Arbeiter, ob sie ihm etwa Ähnliches anzutun gedächten, schließlich sei er ihnen doch jahrzehntelang ein guter Dienstherr gewesen. Bewahre! dementierte man: Jeder der ihren gehe ausschließlich zu benachbarten Farmen, sei der Weg auch noch so lang.
Wie beruhigend![23] Und daher skizziere ich jene Erlebnisse ja: Nicht einer heimlichen Sehnsucht nach Gewalt zollen sie Tribut, sondern der schieren Angst, wie man sie in dieser Form in Mitteleuropa gar nicht mehr kennt – am deutlichsten in Schwarzafrika, heftig noch in den karibischen Slumgegenden, in homöopathischer Dosis selbst in einem Land wie Indien zu spüren, sofern man die touristischen Hochburgen verläßt und sich einem Leben konfrontiert sieht, dem man in seiner archaischen Härte erst einmal nichts entgegenzusetzen weiß, nichts.
Denn selbstredend kann es nicht angehen, unsre kulturelle Entwicklung hin zu einer relativ friedliebenden und gesittet miteinander kommunizierenden Spezies rückgängig zu machen, das wäre die reinste Bankrotterklärung. Überdies ist das Problem kein rein physisches; im Fernen Osten erfahren wir unsre Kraftlosigkeit eher auf intellektueller Ebene, als Versagensangst angesichts eines wirtschaftlichen Expansionsstrebens, dessen ungebremste Energie uns weniger mit spezifischen ethischen Bedenken als mit einem grundsätzlichen Gefühl der Ohnmacht erfüllt, gerade auch in Alltagssituationen. Wer sich je in solch kapitalen Megametropolen wie Seoul, Tokio oder neuerdings Shanghai seinen Weg bahnen mußte, der kennt den kleinen Schrecken, wenn die Fußgängerampel auf Grün springt und sich Hunderte phalanxartig aufeinander zu bewegen, in offensichtlicher Weise zielstrebiger und entschlossener als man selber; kennt den großen Schrecken, wenn der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen mit 300 Stundenkilometern am Bahnsteig vorbeischießt wie eine Langstreckenrakete. Sekunden später wird alles wieder von einer trügerischen Höflichkeit unkenntlich gemacht, bald weiß man nicht mehr, in welchem Film man gerade ist.
Immer nur lächeln? Die Aggressivität, die den Turbo-Kapitalismus in Fernost so erfolgreich und für uns so bedrohlich macht, läßt nur unter Alkoholeinfluß kurz die Maske sinken: »Natürlich wollen wir die Welt beherrschen!« hört man dann von betrunknen japanischen Managern, ihr ökonomischer Größenwahn sattelt auf einem bestürzend ungebrochnen nationalen Sendungsbewußtsein, einem ungeschmälerten Stolz auf die eigne »überlegene« Kultur. Die europäischen Märkte seien im Grunde sogar leichter zu erobern als das neuerdings erwachte China, erfährt man an solch denkwürdigen Abenden; und in der Tat, auch von Maos Erben wird mit beänstigender Energie an der Zukunft gebaut. Daß dabei ohne Skrupel abgerissen, umgesiedelt, Vergangenheit geflutet wird, daß dabei komplette Großstädte auf dem Reißbrett entstehen, sind nur die überdeutlich sichtbaren Indikatoren einer weit tiefergreifenden Entwicklung, hin zu einer neuen Unfreiheit des einzelnen zugunsten des florierenden Gesamtsystems – war Kapitalismus zu Zeiten des Kalten Krieges nicht mal so was wie der kleine Bruder der Freiheit gewesen?
Schön ist das alles nicht. Aber in einer verwirrend faszinierenden Weise massiv da. Und effizient. Selbst der deutsche Transrapid darf in Shanghai längst fahren, ohne jede Diskussion mit etwelchen grünen Bedenkenträgern; und mit dem langen Atem eines unbeirrbar starken Willens – Kraft äußert sich in dieser Weltregion weniger als eruptiver Impuls denn als ausdauernde Beharrlichkeit – ist man drauf und dran, die Schlüsselindustrien zu erobern: Spitzentechnologie ist keine Domäne des Westens mehr, die globale Arbeitsteilung ist schon heute in Frage gestellt. Angeblich können die USA ihre wirtschaftliche Führungsrolle derzeit nur deshalb noch halten, weil 40 Prozent ihres High-Tech-Sektors von asiatischen Einwanderern betrieben werden; die PC-Produktion von IBM ist de facto bereits von der chinesischen Lenovo übernommen, die Fernsehsparte der Firmen Schneider und Thomson von TCL:[24] Vor wenigen Jahren hätte man derartige Meldungen als Aprilscherz abgetan.
Die Weltwirtschaftsordnung ist aus den Fugen geraten, die kulturelle wird es als nächstes tun, Stichwort chinesische Regisseure, chinesische Modemacher, chinesische Starlets, chinesische Bestsellerautor(inn)en. Während die deutschen Goethe-Institute weltweit auf dem Rückzug sind und in den vorhandenen bald keiner mehr eine Sprache lernen will, die sich in ihrer rasant betriebnen Selbstauflösung überflüssig gemacht hat, sind die chinesischen Konfuzius-Institute auf dem Vormarsch, das nächste seiner Art soll in Berlin entstehen.[25] Denn die fernöstliche Innovationsbegeisterung ist niemals abgekoppelt von einem kulturellen Sendungsbewußtsein zu denken: Im weltweiten Globalisierungswettlauf ist man nur deshalb so erfolgreich, weil man die Riesenschritte in die Zukunft aus einem intakten historischen Selbstverständnis heraus tut.[26] Ein lebendiges Erbe ist ja nicht zuletzt auch ein Fundus an gespeicherten Denk-, Struktur- und Verhaltensmöglichkeiten, ein Inspirationsquell für alle Art aktueller Aufgabenstellung.
Wohingegen wir in Mitteleuropa? drauf und dran sind, die letzten Reste unsres eignen Jahrtausenderbes – die Vielfalt der Sprachen und damit verknüpfter Identitäten – zugunsten einer grassierenden Pseudoamerikanisierung preiszugeben.[27] Und damit das, was sich in der Vernetzung kulturell höchst eigenständiger Einzelleistungen als unser Standort begreifen ließe, als unsre Spielart einer alteuropäischen Position, gegen ein haltloses Mitschwimmen im Strom der globalistischen Kulturindustrie einzutauschen: Zum schreckhaften Begreifen der eignen physischen beziehungsweise ökonomischen Schwäche bahnt sich als weitere Demütigung für Europa die kulturelle Ausrichtung auf eine neue Weltmacht an, die sich schon heute als selbstbewußter Global Player aktiv in den allgemeinen Weltkulturstrom einbringt.[28]
Bezeichnenderweise sieht man unser Defizit jedoch nicht von China aus am deutlichsten, sondern vom arabischen Raum – einer Weltgegend also, die de facto zwar vornehmlich Überbleibsel einstiger Hochkulturen vorzuweisen hat, dies freilich mit der Überzeugungskraft dessen, der sich seiner Superiorität trotz alledem sicher ist. Die zweifelsohne vorhandnen Kulturleistungen des Islam will ich nicht in Abrede stellen; aber mit der aktuellen Alltagswirklichkeit beispielsweise im Maghreb hat das Bild vom aufgeklärten Moslem herzlich wenig zu tun. Wo sonst in der Welt wird man so voller Verachtung gemustert, als Vertreter einer gottlosen Gesellschaft von Schlappschwänzen und Huren (wie man sie aus »schamlosen« Filmen und Videoclips zu kennen glaubt), wie in Marokko? Nun, in Jamaica kennt man in dieser Hinsicht auch keine falsche Zurückhaltung, die Rastas bezeichnen die gesamte westliche Welt unverblümt als »Babylon«. Wer, zurückgekehrt nach Deutschland, die Dokumentation unsrer Verkommenheit in ekelhaft liberal sich gebenden Postkarten-Moralsprüchen (»Wer ficken will, muß freundlich sein«)[29] in Betracht zieht, mag den Rastas sogar versuchsweise recht geben.
Doch zurück zum juvenilen Potenzgeprotze, das im arabischen Raum besonders ausgeprägt scheint; kaum eine Kultur der Welt gibt sich dermaßen phallisch, und natürlich will man als Europäer nicht mithalten, wenn enthemmt balzende Jungmänner an vorzugsweise blonden Touristinnen ihren Testosteronhaushalt auszugleichen suchen. Natürlich? Natürlich! Das eigentlich Bestürzende hinter diesem Phänomen ist nicht etwa, daß wir als postemanzipierte Mitteleuropäer – schon in Ost- und Südeuropa ist man in dieser Hinsicht wesentlich breitbeiniger aufgestellt – mittlerweile auch im heiklen Bereich der Zwischengeschlechtlichkeit zu den allerheimlichsten Erwägungen gezwungen sind. Wer sich angesichts des maghrebinischen Machismo zu nichts anderem als zur Würde eines altersgerechten Auftretens bekennt, wer sich in die Überlegenheit dessen flüchtet, der »das alles ja schließlich gar nicht nötig hat«, ist im Spiel der Evolution jedenfalls verloren.[30]
Das Bestürzende an solchen Reiseerlebnissen ist weniger die Scham angesichts einer ungebremst sich inszenierenden Virilität, sondern die kulturelle, besser: weltanschauliche Schwäche, die wir nebenbei bitter zu fühlen bekommen. Selbst aufgeklärte Moslems handeln aus einer kohärenten Weltanschauung heraus, haben die Wahrheit schon immer, die wir als Individualisten von Fall zu Fall erst suchen müssen: eine Hase-und-Igel-Konstellation, bei der wir von vornherein als tendenziell Irrende dastehen; und erfuhr man in derlei Gesprächen früher mitleidige Belehrung, so ist der Ton seit Bin Ladens hochemotionalisierter Kampfansage deutlich rauher, ja unversöhnlich geworden.[31] Toleranz? Aber man ist doch im Besitz der alleinseligmachenden Wahrheit! Aufklärerische Skepsis? Ist die Weltsicht von Weicheiern; man selber hat dagegen das ungebrochne Pathos eines Glaubens, der 600 Jahre jünger ist als der christliche und daher, was seine Entfaltung im Lauf der Zeit betrifft, noch auf dem Entwicklungsstand der Inquisition steht. Insofern wäre’s sogar als Zeichen eines islamischen Humanismus zu deuten, wenn man als touristischer Freigeist nicht mit Stockhieben, sondern nur mit Verachtung gestraft wird.[32]
Der Untergang des Weißen Mannes, wie er sich im »Kampf der Kulturen« abzeichnet,[33] hängt auf kategorielle Weise mit dem religiösen Vakuum zusammen, das wir zwar seit Feuerbach und Heine mit Ersatzreligionen anzufüllen verstanden, zum Beispiel mit»Kultur«, »Nation«, »Wiederaufbau«, deren letzte jedoch, die »Freiheit des Westens«, nach dem Zusammenbruch des Ostblocks eine Leerstelle zurückgelassen hat, die mit Spaßkultur nur vorübergehend zu besetzen war. Noch nie war unser Wertehorizont so leergewischt wie heute, noch nie waren wir als Vertreter einer spätdekadenten Zivilisationsstufe, von der man bereits in den USA kaum eine Ahnung, erst recht keinen Begriff hat – noch nie waren wir so hilflos angesichts außereuropäischer Herausforderungen wie heute. Bräuchte der islamische Raum vielleicht dringend eine kräftige Injektion kritischer Vernunft (wie man als Utopist grüner Provenienz sympathischerweise glaubt), oder brauchen, im Gegenteil, wir selber eine Reduktion derselben, um durch Vereinfachung einer allzu komplexen Weltsicht wieder an ihre vitalen Wurzeln zurückzukommen?[34]
Vielleicht kann man aus den Demütigungen, die man als Alter Europäer derzeit auf den verschiedensten Ebenen erlebt, vielleicht kann man von all jenen, die uns physisch, wirtschaftlich, kulturell und vor allem religiös herausfordern, eines lernen: die Herausforderung anzunehmen und ein gesamtgesellschaftlich getragenes Selbstverständnis zu entwickeln, das aus Verbrauchern wieder Menschen macht, Menschen, die ihr Glück jenseits von Renditeerwartung und Steuervorteil suchen. Und dies notfalls in einer Sprache zum Ausdruck bringen, die auch von Fundamentalisten verstanden wird; möglicherweise müssen wir sogar auf eine – ich kann’s nicht anders als im Paradoxon ausdrücken – antifundamentalistische Weise fundamentalistisch, nein: fundamental werden.
Worauf aber könnte ein mitteleuropäischer Fundamentalismus hinauslaufen,[35] wenn nicht auf ein robusteres Mandat für Freiheit, Toleranz und Höflichkeit im Umgang mit all den Unhöflichen dieser Welt?[36] Es klingt absurd, nachgerade pervers, dieser altersschwach gewordnen Grundtoleranz des Westens jetzt einen Schuß Intoleranz beizugeben, auf daß sie überleben möge im weltweiten Wettstreit juveniler Weltbilder, und man sollte es auf keinen Fall nach Art amerikanischer Imperatoren tun. Doch es gibt eben nicht nur eine Toleranz der Schwäche, die rückgratlos alles abnickt, was der Fall ist,[37] sondern auch die der Stärke, die aus einer bewußt eingenommenen Position heraus erwächst und dem Fremden gegenüber so lange couragiert Distanz hält, bis es zur wechselweisen Anerkennung kommt.
Welchen Wert eine restlos aufgeklärte, sprich: gottlose Gesellschaft der (partiell) unaufgeklärten entgegenzusetzen hat – das ist das Grundproblem, an dem viele Hochkulturen zugrunde gegangen sind. Nun geht als nächstes also auch die Mission des Weißen Mannes zu Ende, wie sie seit der beginnenden Neuzeit betrieben wurde, nicht zuletzt aufgrund ihrer zunehmenden Konzentration aufs Diesseitige: Nahezu niemand außerhalb der westlichen Welt will aufs Dach einer schützenden, sinnstiftenden Transzendenz verzichten, wenn er dafür nur die fragwürdigen Früchte des Nihilismus erhält; die jahrhundertelang betriebne Aufklärung der Unaufgeklärten erfährt nun selber, da sie zur reinen Lehre vom Konsum verkommen scheint, so etwas wie eine Gegenmissionierung.
Selbst am Ursprungsort dieser Aufklärung müssen wir, die wir unser Leben so behaglich in ironischer Distanz zu jedweder Position eingerichtet haben, allenthalben Zeichen einer Sehnsucht nach festen Standorten wahrnehmen, die auf eine sanfte Gegenaufklärung hinauslaufen: auf eine neue, zunächst eklektische Religiosität aus esoterischen Versatzstücken, die sich bereits jeder dritte nach Gusto zusammensetzt, als behelfsweisen Reflex auf eine Glaubensintensität, mit der wir seit ein paar Jahren so massiv von außen konfrontiert werden. Ja mehr noch, sind wir letzten Aufklärer mittlerweile nicht vielleicht selber unsrer freischwebenden Ungebundenheit satt, sehnen uns nach einer neuen Verwurzelung und sind bereit, den Hiatus zwischen alles zersetzender Vernunft und irrationaler Vision zu wagen?[38]
Oft habe ich mich während meiner karibischen Monate gefragt, warum ich, erschöpft von der Vitalität der anderen, ausgerechnet in afrokubanischen Kulten wieder zu Kräften kam, ausgerechnet eine Geborgenheit während der Ausübung geheimbündlerisch anmutender Rituale der Santería und des Palo Monte verspüren konnte, die sogar noch im Alltag eine Weile nachwirkte: Gerade deshalb, so mußte ich mir gegen meinen Willen immer wieder antworten, weil die Aufklärung nicht nur jede Menge gibt, sondern letztlich das Allerwichtigste nimmt, was uns das Leben leichter und das Glück erfahrbarer macht: Gewißheit jenseits des Wissens, Unerschütterlichkeit trotz aller Erschütterungen – und weil eben das von jedem praktizierenden Santero oder Palero glaubhaft vermittelt wird. Erst während ihrer stundenlangen Rituale habe ich wieder das kathartische Erschauern vor dem Jenseitigen verspürt, das sich insbesondre in der protestantischen Kirche zum Programm der Nächstenliebe verflüchtigt hat:[39] Wer will schon Brot und Wein, wenn er Blut und (Opfer-)Fleisch bekommen kann? Wer will schon einen gütigen Gott irgendwo im Abstrakten, der sich seiner eignen Schöpfung entzogen, dazu einen Oberhirten, der trotz Papst-Hype immer unsicher wirkt,[40] wenn er Priester haben kann, von denen er klare Anweisungen und Lebensgewißheit erhält, wenn er Tote haben kann, die mit ihm reden, wenn er Götter haben kann, die mit Wucht in ihre Jünger fahren, um mit ihnen zu tanzen, zu rauchen und zu trinken? Wer einmal miterlebt hat, mit welcher Ungebrochenheit in der Karibik noch geglaubt wird, mit welch afrikanischer Intensität, die immer auch Angst und Schrecken einschließt, Grauen und Entsetzen, bis hin zur Barbarei, der weiß, daß sich unsre gottlose Gesellschaft nicht auf Dauer mit individualistischer Privatesoterik dagegen rüsten kann.[41]
Denn was nützt uns all die »Freiheit wovon«, wenn wir sie nicht mehr als »Freiheit wozu« nützen können? Selbst das Projekt der Aufklärung, wie’s als philosophische Spitzenleistung des Alten Europa einen Siegeszug um die Welt gemacht hat, markiert ganz offensichtlich noch längst nicht das Ende der weltanschaulichen Evolution, außer für die »happy few« einer freidenkerischen Elite, die jede Gesellschaft braucht. Aufklärung oder Gegenaufklärung, das ist die anstehende »Schicksalswahl«, die ganz gewiß nicht auf demokratische Weise entschieden werden wird. Wirtschaftswachstum – Innere Sicherheit – Vollbeschäftigung? Nein, Glaube – Liebe – Hoffnung, darunter scheint’s auf Dauer auch bei uns nicht zu gehen; und eben das gilt es jetzt ohne Häme zu begreifen, selbst von überzeugten Atheisten, die das Zerschreddern unsrer vertrauten Welt im Mahlwerk des Globalismus unverdrossen mit rein politischen Mitteln verhindern oder gar betreiben wollen. Andernfalls sind wir schon morgen nichts als Nachwelt.
(2005)