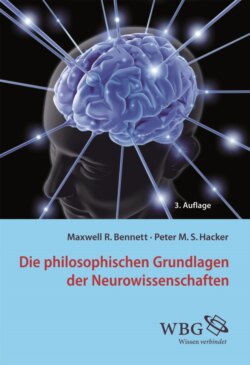Читать книгу Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften - Maxwell Bennett - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort Philosophie im Zeitalter der Neurowissenschaften
ОглавлениеIn aller Regel wird das „Leib-Seele-Problem“, das Kernstück einer umfassenden Anthropologie, als Rätsel eingeschätzt, das schwer oder überhaupt nicht lösbar ist. Diese Einschätzung hat dazu Anlass gegeben, ausgehend von unterschiedlichen philosophischen Positionen und auf der Basis differenter ontologischer Optionen Lösungsvorschläge zu entwickeln. Das wiederum hat die Autoren der Untersuchung über die Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften dazu herausgefordert, die Triftigkeit solcher Vorschläge kritisch zu prüfen. Interessant ist vor allem die Kooperation zwischen dem renommierten australischen Neurowissenschaftler Max R. Bennett und dem Oxforder Philosophen Peter Michael Stephen Hacker. So gelingt es, die Tradition der Philosophy of Mind nicht nur klar darzustellen, sie für die aktuelle Konfrontation mit und Kontraposition zu den Naturwissenschaften zu erschließen, sondern zugleich die philosophischen Anleihen der Neurowissenschaften und deren (zumeist fatale) Folgen aufzudecken.
Das Problemfeld: Menschliches Verhalten wird hier wie dort – in der Neurowissenschaft wie der philosophischen Bestimmung des Menschen, der Philosophy of Mind oder auch der Psychologie – auf seine Bedingungen, Gründe und Ursachen bezogen und gedeutet. Daraus scheint sich der Anspruch sowohl der Neurowissenschaften als auch der Philosophie zu rechtfertigen, dass jede von ihnen eine umfassende und unstrittig gültige Erschließung des „Geheimnisses Mensch“ durch eine spezifische Analyse seiner Vermögen bzw. Funktionsbedingungen oder sogar durch eine substanzmetaphysische Letztbegründung vorlegen kann. Allerdings soll dieser Anspruch durch unvereinbare Ergebnisse der Neurowissenschaften – sofern auf ihrer Grundlage eine Anthropologie, eine Theorie des Erkennens, Wollens, Fühlens entwickelt wird – und der Philosophie, die sich den nämlichen Aufgaben widmet, eingelöst werden. Die unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Resultate nötigen zur Prüfung, wie weit unbewusst und zumindest unthematisiert Vorurteile mit einfließen, die als methodische Vorentscheidungen Aufbau und Weg der Untersuchungen festlegen. Dieser Blick hinter die Kulissen der funktionierenden Neurowissenschaften zeigt, dass Ergebnisse bereits durch die Art des experimentellen Zugriffs prädestiniert sein können und in aller Regel auch weitgehend vorgefertigt sind.
Die hinführenden Überlegungen der Untersuchung zu den philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften weisen eine solche Verflechtung wissenschaftlicher Experimente mit jeweils unterschiedlichen philosophischen Ansätzen nach – so zunächst mit der aristotelischen ganzheitlichen Bestimmung des Menschen, dann aber vor allem mit dem cartesischen Dualismus. Das cartesische Problem, wie sich die Interaktion von Körper und Geist denken lasse, wird perpetuiert. Mit den Worten Charles Sherringtons: „Dem menschlichen Verstehen bot sich die Welt hartnäckig als doppelt dar“ (S. 58)1, was schließlich zu dem durch die philosophische Konzeption Poppers beeinflussten „interaktiven Dualismus“ führt, den J. Eccles vertritt und der auch in der deutschen Debatte Raum gewinnt. Die Frage, „wie eine immaterielle Entität wie der Geist mit Neuronen interagieren könne“ (S. 66), wird hier durch abenteuerliche Zusatzannahmen – wie der eines „Liaison-Gehirns“ (i.e. der dominanten linken Hemisphäre), das mit dem „selbstbewussten Geist in unmittelbarem Zusammenhang“ (S. 69) stehen soll, beantwortet. Es ist weder sinnvoll, eine solche (noch) an Descartes orientierte Zuschreibung menschlicher Fähigkeiten wie Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Wollen an den Geist als eigene Substanz vorzunehmen, noch, wie es F. Crick oder L. Weiskrantz tun, sie kurzerhand dem Gehirn zuzurechnen. Denn beide Versuche gehen von den nämlichen ungeprüften Annahmen aus: einer ontologischen Unterstellung zweier Substanzen und somit selbständiger Entitäten und einem Verständnis des Menschen, dessen Fähigkeiten im Prinzip entweder der einen oder der anderen Entität oder beiden aufgrund nicht weiter bestimmbarer Kooperationsformen zuerkannt werden.
Hier deckt die Untersuchung einen fatalen Mechanismus auf, der dann in eine ausführliche Kritik der im Wesentlichen angelsächsischen Versuche, das Leib-Seele-Problem zu lösen, mündet. Die entscheidende Kritik wird bereits gegen die Neurowissenschaften selbst vorgebracht durch den Vorwurf eines „mereologischen Fehlschlusses“ (S. 87ff. und passim). Dieser besteht im Kontext der Neurowissenschaften wie der anschließenden philosophischen Diskussion in der Zurechnung von Fähigkeiten (Vermögen) eines Lebewesens zu Teilen seines Organismus – so etwa zum Geist als der steuernden Instanz oder in den „Verfallsform[en] des Cartesianismus“ (S. 92) zum Gehirn als dem maßgeblichen materiellen Steuerungsorgan. Im Gefolge dieser Fehlzuschreibung entstehen eben die Missverständnisse sowohl der Neurowissenschaften als auch der Neurophilosophie: Psychologische Attribute werden fehlalloziert. Sie werden entweder dem Gehirn (also der wissenschaftlich erschließbaren Sphäre beobachtbarer, weil materieller Phänomene) oder der so genannten mentalen Sphäre, einem nur privat verfüg- und erschließbaren Inneren des Menschen zugeschrieben. Damit sind die alternativen Extrempositionen umrissen, die sich in der angelsächsischen Literatur in zahlreichen Mischformen und Differenzierungsversuchen wiederentdecken lassen.
Letztlich ist durch diese Kritik auch die aktuelle Debatte im deutschen Sprachraum mit betroffen, selbst wenn hier mit den Arbeiten von G. Roth und W. Singer ein ontologischer Materialismus (selbstverständlich unter der Hand und nie explizit diskutiert) bevorzugt wird. Das Leib-Seele-Problem scheint gelöst – allerdings auf kostenträchtige Weise, nämlich durch den von Bennett und Hacker plausibel kritisierten „mereologischen Fehlschluss“. Die deutsche Neurophilosophie beendet die Diskussion durch die Definition des Menschen, die lautet, er sei „sein Gehirn“. Diese Radikalisierung der Anthropologie ermöglicht natürlich eine ebenso radikale Lösung des Leib-Seele-Problems. Da sich alle Fähigkeiten des Menschen mit Gehirnaktivitäten verknüpfen lassen, ja entsprechenden Hirnsphären zugeordnet werden können, und es zudem als nachgewiesen gilt, dass sie den bewusst erfahrenen „mentalen Ereignissen“ zeitlich vorausgehen, wird diese Lösung nicht nur als plausibel, sondern als zwingend dargestellt. Gegen Kants Mahnung, nicht da Kausalität zu unterstellen, wo nur ein „post hoc“ beobachtbar ist, hat sich diese Theorie immun gemacht. Zudem wird Kausalität, kausale Verursachung, als die einzig wissenschaftlich legitime Bezugnahme unterstellt und der Mensch als Marionette seines Gehirns definiert. Die Kritik, die sich in der Abhandlung zu den philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften durchweg findet, fällt hier auf keinen fruchtbaren Boden. Es wird sowohl einem – wenn auch dem komplexesten – Teil eines Organismus das zugeschrieben, was der Organismus nur als ganzer vermag, und es wird übersehen, dass es neben einer kausalen Verursachung auch konditionale Beziehungen gibt, also Bedingungen, die vorausgesetzt werden müssen, will man bestimmte Fähigkeiten des Menschen erklären. Das Gehirn ist als materielles Steuerungsorgan eine solche Bedingung (condition), keine Ursache.
Kritische Anmerkungen, dass es sowohl für die Analyse menschlichen Verhaltens als auch für die des Handelns sinnvoller sei, von Gründen anstatt von Ursachen2 auszugehen, werden in dieser Diskussion kurzerhand vom Tisch gewischt. Denn – so das von G. Roth vorgebrachte „Argument“ – es lässt sich auch für das Finden von Gründen wie für alle mentalen Ereignisse die Vorgängigkeit einer Gehirnaktivität nachweisen. Diese wird dann als ein Suchen von Gründen durch das Gehirn gedeutet. Ersichtlich verleitet ein methodischer Fehler nicht nur dazu, ausgesprochen weitreichende und begründungsbedürftige ontologische Optionen einfach vorauszusetzen, sondern führt – wie sich in der aktuellen Diskussion zeigt – auch zu Schlussfolgerungen, die das menschliche Zusammenleben insgesamt radikal verändern würden, wollte man den Begründungsanspruch und die (vermeintliche) wissenschaftliche Gewissheit der Neurophilosophie akzeptieren und auf der Basis einer solchen praktischen Einsicht entsprechende Veränderungen vornehmen. Die Annahme, Bewusstsein, Selbstbewusstsein, die eigenen emotiven sympathischen oder antipathischen Hinwendungen und nicht zuletzt der freie Willensentschluss würden nicht von uns selbst oder den Menschen, mit denen wir interagieren, sondern von neurophysiologischen Prozessen in deren Inneren gesteuert, führt auf der einen Seite zu nicht geringfügigen Irritationen, auf der anderen Seite sogar zu weitreichenden Forderungen der Umorganisation unseres gesellschaftlichen Systems. Es zeigt sich, dass eine auf den ersten Blick beinahe kleinlich, weil eben nur philosophisch motiviert anmutende Kritik, nämlich die an mereologischen Fehlschlüssen, bei Nichtbeachtung radikale und fatale Konsequenzen zeitigen kann. Mit dieser Kritik an Teil-Ganzes-Fehlschlüssen und der konsequenten Korrektur kausaler in konditionale Voraussetzungen verknüpft Hacker seine an Wittgenstein orientierten sprachphilosophischen Überlegungen. Das wird in der vorliegenden Abhandlung durch eine minutiöse Auseinandersetzung mit den Lösungsversuchen des Leib-Seele-Problems in der anglo-amerikanischen philosophischen Debatte durchgespielt.
Diese Kritik durch methodische und sprachphilosophische Überlegungen wird anhand unterschiedlicher Probleme der Neurowissenschaften unserer Tage differenziert. Im Prinzip lautet der Vorwurf auch hier, dass der Gehirn-Körper-Dualismus durch „eine Art Krypto-Cartesianismus“ und zugleich durch Spielarten des mereologischen Fehlschlusses beeinträchtigt ist. So werden zunächst die Bestimmungen von Empfindung und Wahrnehmung, dann die kognitiven und die kogitativen Vermögen des Menschen analysiert in Auseinandersetzung mit Searle, Dennett, Crick, Damasio, Blakemore, um nur die in Deutschland Bekannteren zu nennen. Es folgen Überlegungen zur Emotion und ihrer Unterscheidung von Affektionen oder Trieben. Die Bestimmungen von Wollen und Willkürbewegung lassen sich in erster Näherung durch die Kritik am Verständnis des Willens als eines (quasi personalen aktiven) Auslösers von Wollensereignissen von Missverständnissen befreien. Hinzu kommt die Forderung des Verzichts auf eine entweder material-physische oder mental-psychische Lokalisierung des Willensaktes – also wieder der Nachweis eines faktisch virulenten mereologischen Fehlschlusses. Bei dieser Kritik zeigt sich, dass beide Extreme, nämlich eine Lokalisierung dieser Fähigkeiten und Vermögen des Menschen entweder im Bereich des Mentalen oder der physischen Gehirnereignisse durch dasselbe ontologische Schema, den verdeckten Cartesianismus, ebenso wie durch die Zuschreibung der Fähigkeiten des Lebewesens Mensch zu Teilen seines Organismus geprägt sind.
Bezeichnend ist das Fazit, das Hacker in Orientierung an Wittgenstein in seiner Bestandsaufnahme zieht. Die Begriffe, die hier eingeführt und differenziert werden, sind nicht die theoretischen Begriffe der Wissenschaft (vgl. S. 313). Eine Nichtbeachtung dieses Unterschiedes zwischen wissenschaftlichen Begriffen und den Charakteristika menschlichen Verhaltens, „Emotionen und Motiven, Wissen und Glauben, Denken und Vorstellen“ (S. 314), reproduziert unbewusst und contre cœur die strukturelle Beschreibungsweise des cartesischen Dualismus. Es wird lediglich dem „Gehirn eine Vielzahl psychischer Funktionen“ zugeordnet, die vorher dem Geist als der entgegengesetzten substantiellen Sphäre zugeschrieben wurden (S. 315).
In der eigens vorgenommenen Analyse des Bewusstseins und seiner Bestimmung in den Neurowissenschaften im dritten Teil der Überlegungen wiederholt sich der sprachkritische Analysestil und der Nachweis verdeckter ontologischer Unterstellungen – beide dazu angetan, das Bewusstsein als „ein[en] Sack voller Rätsel“ (S. 396ff.) zu deklarieren, ohne dass – von welcher philosophischen Position auch immer – eine Lösung wenigstens einiger der Rätsel in Sicht wäre. Zu dieser Resignation tragen im Wesentlichen hausgemachte philosophische Irrtümer bei. Dazu gehört nicht zuletzt die von Wittgenstein kritisierte Sprachverhexung, die Substantiierung von Fähigkeiten. Aus „Wahrnehmen wird eine Wahrnehmung“ bzw. eine dem Menschen zugeschriebene Wahrnehmung. Diese kann dann isoliert von den Subjekten einer deskriptiven Analyse unterzogen werden. Auch die evolutionäre Theorie der Emanation des Bewusstseins aus der Natur, genauer aus der Weiterentwicklung der Gehirne der Lebewesen, führt vor ein Rätsel, hat selbst aber kaum Erklärungskraft. Denn es sind wiederum Sprachverwirrungen im Wittgenstein’schen Sinn, wenn man z.B. danach fragt, wann Lebewesen die Fähigkeit erreichen, „Bilder-im-Gehirn“ (S. 411) zu haben, so dass sie sich ihre Welt repräsentieren können. Eine ähnliche falsch gestellte Frage ist die, wie aus einem neuronalen Muster ein Vorstellungsbild wird (S. 413 Anm.). Dies sind beides Fragen, auf die sich nur schwer eine Antwort finden lässt oder die zu ausgesprochen komplizierten Antwort-Konstruktionen führen. Der Eindruck, es beim Bewusstsein „mit etwas zutiefst Rätselhaftem“ (S. 413) zu tun zu haben, entsteht offensichtlich aus sprachlichen Irrtümern, Verwirrungen, die zu unlösbaren Problemen und schon in der Fragestellung angelegten Hemmnissen führen. Aus ihnen entstehende Gewissheiten verschärfen das Problem, wenn man versucht, das Selbstbewusstsein zu charakterisieren. Dieses wird häufig als eine Art Bühnenbild aufgefasst, auf dem das Selbst (eine eigenständige Entität) sich vor sich, d.h. das Ich (als ebenfalls eigenständige Identität) bringt. Leugnet man die hier versteckte ontologische Voraussetzung, so wird das Selbstbewusstsein schlicht als eine Illusion deklariert. Auch die Erklärung weiterer, ja letztlich sämtlicher menschlicher Fähigkeiten zu erkennen, wahrzunehmen, zu fühlen, zu wollen kann nicht gelingen, sobald die Fähigkeiten als eigenständige Entitäten – besonders deutlich wird dies in der Bestimmung des Willens als des Urhebers oder Auslösers von Wollensakten – konzipiert sind. Es steht die ontologische Falle bereit: Entweder muss man diese Fähigkeit einer eigenen Realitätssphäre im Menschen zuschreiben – dem materiellen Körper oder dem immateriellen Geist bzw. der Seele – oder man verfällt auf die in den augenblicklichen Lösungsvorschlägen bevorzugte Alternative, sich wegen der Schwierigkeiten, den ganzen Bereich des Mentalen wissenschaftlich zu erschließen, auf die materiellen und mit den Mitteln naturwissenschaftlicher Erfassung erklärlichen Phänomene zu beschränken. Die Weiterungen, insbesondere für die Leib-Seele-Debatte im anglo-amerikanischen Sprachraum, führen zu einer Reihe von Mischformen, die allerdings mit guten Gründen von Bennett und Hacker jeweils als entweder verkappter cartesischer Dualismus oder als ein durch diesen noch beeinflusster unschlüssiger Materialismus kritisiert werden.
In einem letzten Teil der Abhandlung fassen Bennett und Hacker noch einmal die aufgedeckten methodischen Probleme zusammen. Knapp und konzise wird in den Überlegungen ein Fazit gezogen, das auch die kritischeren Geister in der deutschen Debatte bereits befruchtet und den zunächst unschlüssigen Skeptizismus mit guter Nahrung versehen hat. Hier geht es um eine abschließende Bestimmung des Leistungsvermögens sowohl der Philosophie als auch der Neurowissenschaften.3
Für den deutschen Leser mag es auf den ersten Blick verwirrend und erschwerend sein, den Zugang zu einer (in aller Regel) neuen und fremden Welt des Denkens und Thematisierens zu finden. Bei näherer Prüfung zeigt sich aber, dass hier dieselben Probleme diskutiert werden, die in der deutschen Debatte um die Hirnforschung und um das Leib-Seele-Problem – oft wesentlich an amerikanischen Philosophen orientiert – aufgegriffen werden. Wie sich an den hitzigen Debatten in den Journalen, Fernsehsendungen und Kolloquien zeigt, reizen insbesondere die reduktionistischen Positionen wegen ihrer Brisanz, und d.h. vor allen Dingen wegen der in der deutschen Forschungslandschaft geforderten Konsequenzen, zum Widerspruch. Hier geht es nicht nur um theoretisch relevante Kontroversen, sondern zugleich um lebensweltliche Konsequenzen und Lebensformvorschläge durchgreifender Art – um Probleme also, die dringend gelöst werden müssen. Daher lässt sich das Fazit des ganzen Bandes, nämlich die Frage, was eigentlich die Philosophie und was die Neurowissenschaften leisten können, auch als Menetekel für die Debatte in den eigenen Reihen anführen und hoffentlich beherzigen.
Auf jeden Fall sind die Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Neurowissenschaften kulturübergreifend bedeutsam. Es gilt generell die Mahnung, sich an die eigenen philosophischen Anleihen zu erinnern bzw. philosophischerseits erinnern zu lassen (S. 537f.), die, weil sie unreflektiert, aber grundlegend in die Forschungskonzepte einfließen, zu gravierenden Verwirrungen führen können. Nur aufgrund dieser Basis-Verwandtschaft wird die Verwechslung bzw. Identifikation von neurowissenschaftlichen und philosophischen Fragestellungen und dann auch Ergebnissen vorderhand so plausibel. Umso gravierender und wirksamer sind die kritischen Vorschläge, die Bennett und Hacker in ihrem Band entwickeln. Der Anspruch, eine Erkenntnistheorie, eine Philosophie des Willens und damit des menschlichen Handelns und schließlich eine umfassende Anthropologie zu entwickeln, verdankt sich eben den (mereo-)logischen Fehlschlüssen und deren ontologischer Fundierung in der Annahme eigenständiger metaphysischer Entitäten. Ohne diese dubiosen Voraussetzungen erstreckt sich die Leistungsfähigkeit der Neurowissenschaften nicht auf eine Erklärung des Bewusstseins, Selbstbewusstseins, Wollens, ja nicht einmal der Wahrnehmung und der Emotionen. Mit Bennett und Hacker: Das „in den letzten Jahrzehnten erworbene Wissen über die Funktionsweise des Gehirns“ (S. 555) liefert keine Theorie psychischer Fähigkeiten und deren Ausübung. Unstrittig sind die Neurowissenschaften bestrebt und in der Lage, die neuralen Bedingungen für menschliche Fähigkeiten wie „Empfindung, Wahrnehmung, Gedächtnis, Affektion und Wollen“ (S. 553) zu analysieren; dies sind aber Bedingungen, nicht Ursachen der entsprechenden Fähigkeiten und Vermögen. Nimmt man Letzteres an, so erliegt man je nach der gewählten „Begriffsverwirrung“ den Schwierigkeiten, die letztlich zur These von der Unlösbarkeit des Leib-Seele-Problems geführt haben. Hier ist der Verzicht auf die unbewussten und auf keinen Fall gerechtfertigten Anleihen bei der Metaphysik des 17. Jahrhunderts (sei es beim cartesischen Dualismus, sei es bei der reduktionistischen Position eines reinen Materialismus; so z.B. S. 538) unumgänglich. Denn diese metaphysischen Versatzstücke verleiten einerseits zur Ausweitung des Konzepts wissenschaftlicher Erklärung auf die gesamte Realität, und sie erliegen andererseits der Verhexung durch die Sprache. Denn sie machen, sobald sie nicht nur auf physische, sondern auf psychische Phänomene angewandt werden, und gar da, wo sie anthropologische Erklärungen liefern, von der metaphysischen Verwirrung Gebrauch, die bereits unsere Alltagssprache verhext. Die Substantiierung von Vermögen, der Schritt von empfinden zu Empfindung, wahrnehmen zu Wahrnehmung, erinnern zu Erinnerung/Gedächtnis, wollen zu Wille öffnen dem mereologischen Fehlschluss Tür und Tor.
Es bleibt die Frage, was die Philosophie in dieser Debatte zu leisten vermag. Glaubt man den Neurowissenschaftlern – und zwar durchweg den im dritten Teil des Bandes von Bennett und Hacker untersuchten zeitgenössischen Neurowissenschaften einschließlich der hier nicht eigens mitkritisierten deutschen Neurowissenschaft – so wird Philosophie überflüssig, sobald die Prozesse des Gehirns mit Hilfe einer naturwissenschaftlich-physikalischen Methode gänzlich analysiert sind. Dann kennt man psychische Prozesse, weil man ihre Ursachen beschreiben und die Zusammenhänge der physischen Ereignisse im Gehirn, der neuralen Basis, mit den mentalen Ereignissen wissenschaftlich erklären kann. Hier ist bereits der klärende Hinweis darauf, dass es sich bei Gehirnprozessen zwar um Konditionen aller bewussten Erfahrungen handelt, nicht aber um Ursachen, angetan, eine erste Skepsis gegen den Global- und Gesamtanspruch zu nähren. Das nächste Problem wird durch den Hinweis auf den neben der ontologischen Option fundamentalen „methodologischen Fehlschluss“, also einen ebenfalls ontologiebedingten Irrtum, markiert. Diese Prüfung und Klärung obliegt der Philosophie. Ihr drittes, nicht ersetzbares Arbeitsfeld ist die „Klärung unserer Darstellungsform“. Durch diese Prüfung legt die Philosophie die „Sinngrenzen: das heißt die Grenzen dessen, was auf kohärente Weise gedacht und gesagt werden kann“ (S. 541) fest. Im Blick auf die allenthalben virulenten „Überschreitungen der Sinngrenzen“ und ihre Ursachen erweist sich die sprachkritische Philosophie im Sinne und im Gefolge Wittgensteins als „destruktiv“. In der „Überprüfung und Beschreibung des Wortgebrauchs – dessen, was kompetente Sprecher, indem sie Worte richtig verwenden, sagen und nicht sagen“ (S. 543), liegt die konstruktive Aufgabe der Philosophie. Das mag sich zunächst bescheiden anhören, es liegt darin aber eine Aufgabe der Philosophie, die „kein Ende nehmen“ wird, denn jede Begriffsverwirrung, „jede einzelne Konfusion stellt einen neuen Behandlungsfall dar“ (S. 543). So gibt es keine philosophische Grund- und Gesamterklärung etwa im Sinn der Eruierung metaphysischer Letztbegründung. Es ist aber auch keine übergroße Bescheidenheit angesagt, die die Fähigkeiten der Philosophie leichtfertig verspielt.
Im Gegenteil lässt sich unter Beweis stellen, was die Abhandlung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften überzeugend geleistet hat, dass die Philosophie, die sich in diesem Sinne versteht, auch für die Wissenschaften ein unverzichtbarer Gesprächspartner wird, dessen Hinweise zwar nicht die Ergebnisse, wohl aber Ziele und methodischen Aufbau wissenschaftlicher Forschung beeinflussen. Anhand einer Reihe in der Diskussion virulenter irriger Annahmen zeigte sich nämlich, dass und wie die begriffliche Klärungsarbeit auch für die neurowissenschaftliche Forschung sinnvolle Korrektive an die Hand gibt. Das geschieht beispielsweise in der Kritik an der Konzeption der Wahrnehmung, die weder „Bildersehen oder Bilderhaben … [oder] die Hypothesenbildung des Gehirns ist“, daran, dass „Emotionen keine körperlichen Reaktionen auf Vorstellungsbilder sind“, dass mentale Ereignisse nicht einer Innensphäre zugehören, die sie zu unerschließbarer Privatheit verdammt, dass sie aber auch nicht auf ihre physischen, d.h. neuronalen Bedingungen verrechnet werden können, dass das Selbst des Selbstbewusstseins oder der Wille keine eigenen Entitäten sind und vieles mehr. Durch die Festlegung der Sinngrenzen gewinnt die Philosophie Begriffsklärungen, die für das Erreichen neurowissenschaftlicher Ziele „alles andere als unerheblich“ (S. 549), ja letztlich unverzichtbar sind, will man Ziel und Aufbau der Wissenschaften mit den Mitteln der Wissenschaft erreichen können. Die Untersuchung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften weist nämlich an den faktischen Fragestellungen und der Entwicklung der Neurowissenschaften Probleme auf, die die Wissenschaft beeinträchtigen und vor allen Dingen den Erklärungsanspruch als erschlichen kenntlich machen. Nicht zuletzt werden Vorschläge entwickelt, wie man durch eine sinnvolle sprachliche Fassung auch belastbare Ergebnisse mit den Methoden der Wissenschaft erreichen kann.
Die vorgeschlagenen Mittel zur Beseitigung der Irritationen sind überraschend einfach, aber auch überraschend effektiv. Man wird an jenen Helden der Menschheitsgeschichte erinnert, den man den „Großen“ nannte, weil er den gordischen Knoten, an dessen Lösung sich viele vergeblich wagten, nicht durch das Zerren und Zupfen an möglicherweise erfolgsträchtigen Schlingen und Fäden, sondern durch die Schärfe seines Schwertes löste. Auch in den Kritiken Bennetts und Hackers wird gegen die verdeckten ontologischen Optionen, ihre Verflechtung und Verfilzung zu immer subtileren Differenzierungen die typisch philosophische Variante der Problemlösung, nämlich Occham’s Razor eingesetzt: Entia non sunt multiplicanda sine neccessitatem – d.h. keinesfalls ohne wirklich einsichtige Argumente. Verzichtet man auf die den Problemlösungen nicht förderlichen, sondern eher erschwerenden metaphysischen Annahmen, so wird die Kritik an mereologischen Fehlschlüssen eo ipso triftig. Denn diese Form der Ausstattung von Teilen bzw. Organen mit den Fähigkeiten eines lebendigen Organismus verdankt sich selbst wieder der Vorgabe, dass zunächst Realitätsbereiche verselbständigt, dann auf der Basis solcher substantiierter Bereiche (i. e. der Teile lebendiger Organismen) ihre Eigenständigkeit als jeweils deskribierbare Entität unterstellt wird. Wittgensteins Sprachkritik tut das Ihre, um zu anspruchsvolle Annahmen zu destruieren. Zwar wird behauptet, nur eine sprachkritische Reflexion zur Vorbereitung einer unbelasteten Lösung des nun nicht mehr unlösbaren Rätsels des Verhältnisses von Leib und Seele, Körper und Geist, Geist und Gehirn zu geben, aber diese dem Anspruch nach bescheiden daherkommenden Vorschläge sind triftig und durchschlagend. Des Rätsels Lösung ist die, die schon Ödipus der Sphinx, ihre mystische Aura zerstörend, entgegengeschleudert hat: „der Mensch“. Als ein Wesen mit spezifischen Fähigkeiten müssen psychologische Prädikate, die seine Vermögen umschreiben, auf ihn bezogen, ihm als Ganzem zugeschrieben werden. Eine Prüfung solcher Zuschreibungen, die bereits zum Schatz der Alltagssprache gehören, lässt die Philosophie dann nicht als eine dürre Form rein formaler Kritiken, als rein destruktives Unternehmen erscheinen. Sie bietet die Basis für den konstruktiven Versuch, den Menschen als ein sprachfähiges Wesen durch eine kritische Sichtung der Medien zu erschließen, mit deren Hilfe er sich die Welt und sich selbst zugänglich hält.
In weiterführenden Arbeiten will Hacker zeigen, dass der zunächst bescheiden anmutende Ansatz sich durchaus zu einer Anthropologie erweitern lässt.4 Da die einzelnen Kapitel des Bandes – nach dem Anspruch der Autoren – so aufgebaut sind, dass sie jeweils in sich schlüssig auch gesondert zur Kenntnis genommen werden können, bieten sie nicht nur die Möglichkeit, spezifische Interessen des eigenen Studiums zu verfolgen, sondern sie sind zugleich ein reiches Schatzkästlein an Argumenten, die die unterschiedlichen Aspekte der gegenwärtigen Debatte um die Grundlegung von Psychologie und Anthropologie bereichern.
In den einzelnen Kapiteln des Bandes findet daher auch der deutschsprachige Leser triftige Argumente, um sich mit den ihm bekannten Versionen des Leib-Seele-Problems auseinanderzusetzen. Die abschließenden Überlegungen des Bandes über die Leistungsfähigkeit sowohl der Neurowissenschaften als auch der Philosophie liefern Korrektive für die Auseinandersetzung mit den Ansprüchen einer neurophilologischen Anthropologie und können daher auch die heimische Debatte um das Leib-Seele-Problem einerseits vom Nimbus des Geheimnisvollen, andererseits von der das menschliche Selbstverständnis beeinträchtigenden Reduktion auf materielle Steuerung entlasten.
Trotz der von Hacker wie Bennett betonten Bescheidenheit, es handele sich um Vorüberlegungen zu einer Anthropologie, die sowohl mit (neuro-)wissenschaftlichen als auch mit philosophischen Ansätzen vereinbar ist, zeigt sich hier die Tragweite einer methodisch-sprachkritischen Bereinigung. Wenige Direktiven der Argumentation reichen hin, um überkomplexe Erklärungen und Deutungen überflüssig zu machen und zugleich tragfähige methodische Grundlagen für eine Anthropologie vorzugeben. Diese sollte sich auf die sprachlichen Vergewisserungen des Menschen über sich selbst beziehen; sie wird sich von Psychologie und Neurowissenschaften dadurch unterscheiden, dass sie keine Deskriptionen von Ursachenzusammenhängen, sondern unter Anerkennung gegebener physisch-biologischer Bedingungen die Besonderheit eines Lebewesens analysiert, das sich selbst sprachlich gegeben ist.
Annemarie Gethmann-Siefert
1 Die Seitenangaben beziehen sich auf die Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften, wo die Originalfundstellen ausgewiesen sind.
2 Es gibt auch in der deutschen Diskussion durchaus Versuche, sich mit dem methodischen Ansatz dieser aktuellen (und in angelsächsischen Positionen auch vorgezeichneten) Position auseinanderzusetzen, wie sie sich beispielsweise in der Überlegung von Lutz Wingert zu den Grenzen der naturalistischen Selbstobjektivierung, aber auch in sämtlichen Beiträgen eines Bandes mit dem Titel Philosophie und Neurowissenschaften, hrsg. von D. Sturma, Frankfurt a. M. 2006, finden. Als weiteres Beispiel kann die kleine Abhandlung von Peter Janich genannt werden: Kein neues Menschenbild. Zur Sprache der Hirnforschung, Frankfurt a.M. 2009. – Hinweise auf diese und ähnliche kritische Stimmen ließen sich vermehren. Durch die Abhandlung zu den Philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften wird die bereits begonnene Diskussion durch gezielte und weiterführende Argumente gestützt.
3 Dieser Teil der Abhandlung bildet den Auftakt in Philosophie und Neurowissenschaften (a.a.O. S. 20–42).
4 So geschehen in dem ersten publizierten Teil einer auf drei Bände angelegten Anthropologie, der den Titel On Human Nature (Harvard 2004) trägt.