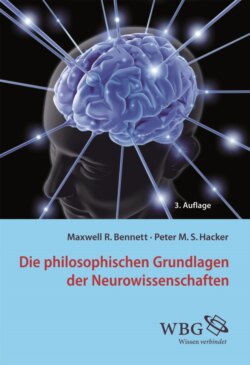Читать книгу Die philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften - Maxwell Bennett - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
ОглавлениеDie philosophischen Grundlagen der Neurowissenschaften sind die Früchte eines Gemeinschaftsprojekts eines Neurowissenschaftlers und eines Philosophen. Die Darstellung erörtert die begrifflichen Grundlagen der kognitiven Neurowissenschaften – Grundlagen, die von den strukturellen Beziehungen zwischen den psychologischen Begriffen gebildet werden, die bei Erforschung der neuralen Verhältnisse der kognitiven, affektiven und willentlichen menschlichen Fähigkeiten Verwendung finden. Die logischen Verbindungen zwischen diesen Begriffen zu untersuchen, ist eine philosophische Aufgabe. Mit dieser Untersuchung so umzugehen, dass die Hirnforschung in ein helleres Licht gerückt wird, eine neurowissenschaftliche. Darum unser Joint Venture.
Will man die neuralen Strukturen und Kräfte verstehen, die der Wahrnehmung und dem Denken, dem Gedächtnis, der Emotion und dem intentionalen Verhalten zugrunde liegen und sie ermöglichen, muss man sich über diese Begriffe und Kategorien Klarheit verschaffen. Beide Autoren, die sich der Untersuchung aus ganz verschiedenen Richtungen näherten, waren von der Anwendung der psychologischen Begriffe innerhalb der heutigen Neurowissenschaften verwirrt, mitunter sogar beunruhigt. Die Verwirrung resultierte häufig daher, dass wir uns fragten, was die Neurowissenschaftler mit ihren Behauptungen, das Gehirn und den Geist betreffend, wohl gemeint haben könnten oder weshalb ein Wissenschaftler davon ausging, seine Experimente hätten die zur Untersuchung stehende psychische Fähigkeit erklärt, oder sie wurde von den begrifflichen Vorannahmen ausgelöst, die in die aufgeworfenen Fragen eingingen. Das Unbehagen rührte von dem Verdacht her, dass die Begriffe in manchen Fällen fehlerhaft ausgelegt oder angewendet wurden oder die Grenzen ihrer definierten Anwendungsbedingungen überschritten. Und je mehr wir nachforschten, desto stärker waren wir davon überzeugt, dass trotz der beeindruckenden Fortschritte der kognitiven Neurowissenschaften mit den allgemeinen Theorieentwürfen etwas nicht stimmte.
Die Neurowissenschaften haben mit den empirischen Fragen zum Nervensystem zu tun. Ihr Geschäft ist die Feststellung von Tatsachen, die mit den neuralen Strukturen und Vorgängen in Zusammenhang stehen. Die kognitiven Neurowissenschaften haben es sich zur Aufgabe gemacht, die neuralen Ermöglichungsbedingungen der kognitiven, kogitativen, affektiven, die Wahrnehmung und den Willen betreffenden Funktionen zu erklären. Solche erklärenden Theorien werden durch experimentelle Untersuchungen bestätigt oder verworfen. Dagegen sind begriffliche Fragen (die beispielsweise die Begriffe des Geistes oder des Gedächtnisses, des Denkens oder der Vorstellungskraft betreffen), die Beschreibung der logischen Beziehungen zwischen den Begriffen (wie die zwischen den Begriffen der Wahrnehmung und der Empfindung oder den Begriffen des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins) und die Untersuchung der strukturellen Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichen begrifflichen Bereichen (wie die zwischen dem Psychischen und dem Neuralen oder dem Geistigen und dem Verhalten) die eigentliche Domäne der Philosophie.
Begriffliche Fragen gehen den Feststellungen zu Wahrheit und Falschheit voran. Bei ihnen handelt es sich um Fragen, die sich auf Darstellungsformen beziehen, aber nicht auf die Wahrheit oder Falschheit empirischer Aussagen. Diese Formen werden von den wahren (und den falschen) wissenschaftlichen Behauptungen und von den richtigen (und den falschen) wissenschaftlichen Theorien vorausgesetzt. Sie entscheiden nicht, was in empirischer Hinsicht wahr oder falsch ist, sondern vielmehr, was Sinn ergibt und was nicht. Folglich sind die begrifflichen Fragen wissenschaftlicher Untersuchung, wissenschaftlichem Experimentieren und Theoretisieren nicht zugänglich. Denn die Begriffe und begrifflichen Zusammenhänge werden von allen derartigen Untersuchungen und Theorieentwürfen vorausgesetzt. Wir befassen uns hier nicht mit Spitzfindigkeiten, sondern mit den Unterschieden, die zwischen intellektuellen Forschungsarten bestehen, die in logischer Hinsicht verschieden sind. (Diesbezügliche methodologische Einwände werden in Kapitel 14 erörtert.)
Begriffliche von empirischen Fragen zu unterscheiden, ist von allerhöchster Wichtigkeit. Wenn eine begriffliche Frage mit einer wissenschaftlichen verwechselt wird, entpuppt sie sich als äußerst widerspenstig. Es scheint in solchen Fällen, als wäre die Wissenschaft in der Lage, die Wahrheit über den Untersuchungsgegenstand mit Hilfe der Theorie und des Experiments herauszufinden – und doch scheitert sie beständig dabei. Was nicht überraschend ist, denn begriffliche Fragen sind empirischen Untersuchungsmethoden ebenso wenig zugänglich, wie rein mathematische Probleme nicht mit physikalischen Methoden zu lösen sind. Darüber hinaus bringen empirische Probleme, die begrifflich nicht ausreichend geklärt wurden, zwangsläufig irrige Fragen mit sich, was wiederum die Forschung sehr wahrscheinlich auf Abwege führen wird. Denn jede Unklarheit im Hinblick auf die einschlägigen Begriffe wird sich als Unklarheit in den Fragen niederschlagen und somit auch im Design der Experimente, die Antworten liefern sollen. Und jede Inkohärenz beim Erfassen der einschlägigen begrifflichen Strukturen manifestiert sich wahrscheinlich als Inkohärenz in den Interpretationen der experimentellen Ergebnisse.
Die kognitiven Neurowissenschaftler operieren über die Grenze zwischen zwei Gebieten hinweg, der Neurophysiologie und der Psychologie, deren jeweilige Begriffe sich kategorial unterscheiden. Die logischen bzw. begrifflichen Beziehungen zwischen dem Physiologischen und dem Psychologischen sind problematisch. Zahlreiche psychologische Begriffe und Begriffskategorien sind kaum bis ins Letzte zu durchschauen. Die Verknüpfungen zwischen dem Geist und dem Gehirn und zwischen dem Psychischen und dem Verhalten sind unübersichtlich. Diese Begriffe und ihre Artikulationen, die scheinbaren ‚Bereiche‘ und ihre Beziehungen untereinander haben die Neurophysiologie von Anfang an verwirrt (wir beginnen unsere Untersuchung in Kapitel 1 mit einem historischen Überblick über die frühe Entwicklungsphase der Neurowissenschaften). Trotz der großartigen Fortschritte innerhalb der Neurowissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sich in erster Linie der Arbeit Charles Sherringtons verdanken, fanden eine Reihe begrifflicher Fragen, allgemein bekannt als Körper-Geist- oder Gehirn-Geist-Problem, auch weiterhin keine Antwort – belegbar an den irrigen cartesianischen Ansichten, die von Sherrington und einigen seiner Kollegen und Schützlingen wie Edgar Adrian, John Eccles und Wilder Penfield aufgegriffen wurden. So brillant ihr Werk fraglos war, tief reichende begriffliche Konfusionen blieben bestehen – wie wir in Kapitel 2 zeigen. Ob die aktuelle Generation von Neurowissenschaftlern die begrifflichen Verwirrungen der Generationen vor ihr erfolgreich überwunden oder ob sie bloß ein begriffliches Durcheinander durch ein anderes ersetzt hat, das ist die Frage, der sich die Untersuchungen in diesem Buch widmen.
Ein solches Durcheinander offenbart sich in der beständigen Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn. Während Sherrington und seine Anhänger dem Geist (der als eine eigentümliche, möglicherweise immaterielle Substanz, die vom Gehirn zu unterscheiden sei, vorgestellt wurde) psychologische Attribute zuschrieben, tendieren gegenwärtige Neurowissenschaftler dahin, dasselbe Spektrum an psychologischen Attributen dem Gehirn (meist, jedoch nicht immer, als identisch mit dem Geist aufgefasst) zuzuschreiben. Der Geist, behaupten wir (3.10), ist aber weder eine vom Gehirn getrennte bzw. unabhängige Substanz noch eine mit dem Gehirn identische Substanz. Und wir zeigen auf, dass die Zuschreibung psychologischer Attribute zum Gehirn inkohärent ist (Kapitel 3). Menschen verfügen über eine große Zahl psychischer Vermögen, die in allen Lebensumständen zur Anwendung gelangen, wenn wir wahrnehmen, denken und folgern, etwas wollen, Pläne schmieden und Entscheidungen treffen. Besitz und Entfaltung solcher Vermögen machen uns zu dieser Art von Tieren, die wir sind. Wir können die neuralen Voraussetzungen und Begleiterscheinungen jener Vermögen untersuchen. Das ist die Aufgabe der Neurowissenschaften, die mehr und mehr über sie herausfindet. Ihre Entdeckungen rühren jedoch keineswegs an die begriffliche Wahrheit, dass diese Vermögen und deren Entfaltung beim Wahrnehmen, Denken und Fühlen Attribute der Menschen sind, nicht ihrer Teile – insbesondere nicht ihrer Gehirne. Ein Mensch ist eine psychophysische Einheit, ein Tier, das wahrnehmen, intentional handeln, folgernd denken und Gefühle haben kann, ein Sprache verwendendes Tier, das nicht bloß über Bewusstsein verfügt, sondern sogar über Selbstbewusstsein – kein Gehirn, das in den zum Körper gehörenden Schädel eingebettet ist. Sherrington, Eccles und Penfield betrachten die Menschen als Lebewesen, in denen der Geist, den sie als den Träger der psychologischen Attribute begreifen, mit dem Gehirn liiert ist. Man ist gegenüber dieser Fehlkonzeption keineswegs im Vorteil, wenn man davon ausgeht, dass es sich bei dem Träger der psychologischen Attribute um das Gehirn handelt.
Unter den heutigen Neurowissenschaftlern gibt es viele, die vom Wahrnehmen, Denken, Mutmaßen und Glauben des Gehirns sprechen, oder davon, dass eine Gehirn-Hemisphäre von Dingen etwas wisse, die der anderen verborgen bliebe. Verteidigt wird diese Position manchmal mit dem Hinweis, wir hätten es hier lediglich mit einer schlichten Façon de parler zu tun. Das stimmt jedoch nicht. Denn das charakteristische Erklärungsparadigma innerhalb der kognitiven Neurowissenschaften der Gegenwart besteht darin, dem Gehirn und seinen Arealen psychologische Attribute zuzuschreiben, um den Besitz psychologischer Attribute und die Entfaltung (und deren Mängel) der kognitiven Vermögen durch die Menschen zu erklären.
Wenn man dem Gehirn psychologische – insbesondere kognitive und kogitative – Attribute zuschreibt, handelt man sich, wie wir zeigen werden, viele weitere Konfusionen ein. Die Neurowissenschaften sind in der Lage, die neuralen Bedingungen und Begleiterscheinungen des Erwerbs, des Besitzes und der Entfaltung des Empfindungs- und Fühlensvermögens bei Tieren zu untersuchen. Sie können die Vorbedingungen der Möglichkeit der Ausübung einzigartig menschlicher Vermögen ermitteln: des Denk- und Folgerungsvermögens, der Fähigkeit, Erinnerungen und Vorstellungen artikulieren zu können, des Emotionsvermögens und der Wollensfähigkeit. Erfolge erzielen sie in diesem Feld durch das geduldige induktive Aufspüren der Wechselbeziehungen zwischen neuralen Phänomenen und dem Besitz und der Ausübung psychischer Vermögen und zwischen neuralen Schädigungen und Defiziten bei normal ausgeprägten geistigen Funktionen. Was sie nicht zu leisten vermögen, ist, die Vielzahl gewöhnlicher psychologischer Erklärungen menschlicher Aktivitäten anhand von Gründen, Intentionen, Zwecken, Zielen, Werten, Regeln und Konventionen durch neurologische Erklärungen zu ersetzen (der Reduktionismus wird in Kapitel 13 erörtert). Und sie können nicht erklären, wie ein Tier wahrnimmt oder denkt, indem sie sich auf die Wahrnehmung oder das Denken des Gehirns oder einige seiner Teile beziehen. Solche Zuschreibungen psychologischer Attribute ergeben keinen Sinn, wenn sie nicht dem Tier als Ganzem gelten. Es ist das Tier, das wahrnimmt, nicht Teile seines Gehirns, und es sind die Menschen, die denken und folgern, nicht ihre Gehirne. Das Gehirn und seine Aktivitäten ermöglichen uns – nicht ihm –, wahrzunehmen und zu denken, Gefühle zu haben, Pläne zu schmieden und sie umzusetzen.
Während viele Neurowissenschaftler in einer ersten Reaktion auf den Vorwurf, sie erzeugten begriffliche Verwirrung, behaupten, dass es sich bei der Zuschreibung psychologischer Prädikate zum Gehirn um eine bloße Façon de parler handelt, reagieren sie auf die nachweisbare Tatsache, dass ihre Erklärungstheorien dem Gehirn in nichttrivialer Weise psychologische Vermögen zuschreiben, manchmal mit dem Hinweis, dieser Fehler sei wegen der Mängel der Sprache unvermeidlich. Wir treten dieser Fehlkonzeption in Kapitel 14 entgegen, wo wir zeigen, dass die großartigen Entdeckungen der Neurowissenschaften auf diese abwegige Form der Erklärung nicht angewiesen sind – alles das, was entdeckt wurde, kann ohne Weiteres in unserer Sprache, so wie sie existiert, beschrieben und erklärt werden. Wir verdeutlichen das, indem wir uns den häufig erörterten Phänomenen zuwenden, die aus der Kommissurotomie herrühren und die von Sperry, Gazzaniga und anderen beschrieben (oder, wie wir nahelegen, falsch beschrieben) wurden (14.3).
In Teil II untersuchen wir die Verwendung der Begriffe der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, des bildlichen Vorstellens, der Emotion und des Wollens in den aktuellen neurowissenschaftlichen Theorieentwürfen. Fallweise zeigen wir auf, dass begriffliche Unklarheit – das Versäumnis, den einschlägigen begrifflichen Strukturen die nötige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen – oft die Quelle für Irrtümer in der Theorie und der Grund für abwegige Schlüsse gewesen ist. Es ist ein Irrtum, ein begrifflicher Irrtum, davon auszugehen, wahrnehmen heiße, ein Bild im Geist zu erfassen (Crick, Damasio, Edelman) oder eine Hypothese zu bilden (Helmholtz, Gregory) oder eine 3-D-Modell-Beschreibung hervorzubringen (Marr). Es ist verworren – eine begriffliche Verwirrung –, das Bindungsproblem als Problem der Verknüpfung von Gestalt-, Farb- und Bewegungsdaten auszugeben, aus der das Bild des wahrgenommenen Gegenstands resultiere (Crick, Kandel, Wurtz). Es ist falsch, begrifflich falsch, davon auszugehen, dass das Gedächtnis nur von der Vergangenheit handelt oder dass Erinnerungen im Gehirn in Form starker synaptischer Verbindungen gespeichert werden können (Kandel, Squire, Bennett). Und es ist verfehlt, aus begrifflichen Gründen verfehlt, die Untersuchung des Durstes, des Hungers und der Lust als Untersuchung der Emotionen aufzufassen (Rolls) oder zu denken, die Funktion der Emotionen bestünde darin, uns über unseren viszeralen und muskuloskeletalen Zustand in Kenntnis zu setzen (Damasio).
Die erste Reaktion auf solche kritischen Bemerkungen mag durchaus Entrüstung und Ungläubigkeit sein. Wie können florierende Wissenschaften sich im Irrtum befinden? Wie könnte es unvermeidlich sein, dass innerhalb gut etablierter Wissenschaften begriffliche Verwirrungen auftreten? Und gewiss doch können problematische Begriffe, wenn es sie denn gibt, leicht durch andere, unproblematische ersetzt werden, die den gleichen Erklärungszwecken dienen. Solche Erwiderungen deuten auf ein mangelhaftes Verständnis für den Zusammenhang zwischen Darstellungsform und dargestellten Tatsachen hin und darauf, dass nicht erfasst wurde, womit wir es bei einem begrifflichen Irrtum zu tun haben. Zudem offenbaren sie Unkenntnis, was die Geschichte der Wissenschaften im Allgemeinen und die der Neurowissenschaften im Besonderen angeht.
Die Wissenschaften sind vor begrifflichem Fehlgehen und begrifflicher Konfusion nicht besser geschützt als jede andere Form der intellektuellen Anstrengung. Die Geschichte der Wissenschaften ist voll mit Trümmern von Theorien, die nicht einfach in Bezug auf die Fakten fehlerhaft waren, sondern begriffliche Schieflagen aufwiesen. Stahls Verbrennungstheorie beispielsweise war begrifflich insofern abwegig, als sie, unter bestimmten Bedingungen, Phlogiston ein negatives Gewicht zuschrieb – eine Idee, die innerhalb ihres Rahmens, der newtonschen Physik, keinen Sinn ergab. Einsteins berühmte kritische Einwände gegenüber der Theorie des elektromagnetischen Äthers (das Medium, von dem man annahm, die Ausbreitung des Lichts beruhe auf ihm) zielten nicht nur auf die Resultate des Michelson-Morley-Experiments, das damit scheiterte, die absolute Bewegung in irgendeiner Form effektiv nachzuweisen, sondern sie richteten sich auch auf die begriffliche Konfusion, welche die relative Bewegung betraf, in Verbindung mit der Rolle, die man dem Äther im Zusammenhang mit der Erklärung elektromagnetischer Induktion zuschrieb. Die Neurowissenschaften stellten nie eine Ausnahme dar – wie wir in unserer historischen Übersicht zeigen. Es stimmt durchaus, dass sie heutzutage florieren. Das aber immunisiert sie nicht gegen begriffliches Durcheinander. Die newtonsche Kinematik war eine gedeihende Wissenschaft, was allerdings nicht verhinderte, dass Newton sich in begrifflichen Verwirrungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Fernwirkung verstrickte und dass ihn das Wesen der Kraft (ungeklärt bis zu Hertz) vor ein Rätsel stellte. So war auch Sherringtons überragende Leistung – die Erklärung der Integrationstätigkeit der Synapsen im Rückenmark, dadurch eliminierte er ein für allemal die verworrene Vorstellung von einer ‚spinalen Seele‘ – vollkommen vereinbar mit begrifflichen Konfusionen, die die ‚zerebrale Seele‘ bzw. den Geist und seine Beziehung zum Gehirn betrafen. Ebenso waren Penfields außerordentliche Verdienste um die Identifizierung der funktionalen Lokalisation im Kortex und die Entwicklung brillanter neuro-operativer Techniken vollkommen vereinbar mit beträchtlicher Konfusion hinsichtlich der Beziehung zwischen dem Geist und dem Gehirn und dem, was die ‚höchste Gehirnfunktion‘ angeht (eine von Hughlings Jackson geliehene Idee).
Kurz gesagt, begriffliches Durcheinander kann mit florierender Wissenschaft koexistieren. Das mag einem seltsam vorkommen. Wenn die Wissenschaften trotz begrifflicher Konfusionen gedeihen können, warum sollten sich Wissenschaftler dann um sie kümmern? Verborgene Riffe machen die Meere nicht unschiffbar, aber sie sind gefährlich. Die Frage ist, wie sich ein Auflaufen auf den Riffen manifestiert. Begriffliche Verwirrungen können sich ganz unterschiedlich und an unterschiedlichen Stellen der Untersuchung bemerkbar machen. In manchen Fällen mag es sein, dass die begriffliche Unklarheit weder die Stichhaltigkeit der Fragen noch die Fruchtbarkeit des Experiments berührt, sondern nur das Verständnis der Resultate des Experiments und deren theoretische Implikationen. So bemühte sich beispielsweise Newton in der Optik um die Einsicht in das Wesen der Farben. Seine Forschungskraft war schier unerschöpflich darin, Beiträge für die Wissenschaft zu liefern. Sein Fazit aber: ‚Farben sind Empfindungen im Sensorium‘, ist Ausdruck seines Scheiterns beim Versuch, das ersehnte Verständnis zu erlangen. Denn was auch immer Farben sind, sie sind keine ‚Empfindungen im Sensorium‘. Und weil Newton sich so um das Verständnis seiner Forschungsresultate bemühte, hatte er mithin guten Grund, sich um die begrifflichen Konfusionen zu kümmern, die seine Arbeit durchdrangen – denn diese standen einem adäquaten Verständnis im Wege.
In anderen Fällen jedoch erweist sich die begriffliche Verwirrung als nicht so unbedenklich für die empirische Forschung. Abwegige Fragen können die Forschung sehr wohl ins Abseits und also in die Bedeutungslosigkeit befördern (Beispiele hierfür werden dargelegt in Bezug auf das bildliche Vorstellen (6.3.1) und die willkürliche Bewegung (8.2)). Andererseits wiederum bringen Falschauslegungen von Begriffen und begrifflichen Strukturen mitunter eine Forschung hervor, die in keinster Weise auf Abwege gerät, was allerdings nicht das beweist, was es beweisen sollte (Beispiele werden erörtert in Bezug auf das Gedächtnis (5.2.1–5.2.2) und die Emotionen und Triebe (7.1). Gut möglich, dass die Wissenschaft in solchen Fällen nicht ganz so floriert, wie es den Anschein hat. Es bedarf einer begrifflichen Untersuchung, um die Probleme ausfindig zu machen und zu beseitigen.
Sind solche begrifflichen Verwirrungen unvermeidlich? Ganz und gar nicht. Dieses Buch wurde abgefasst, um aufzuzeigen, wie sie sich verhindern lassen. Sie lassen sich freilich nicht verhindern, während man alles andere so belässt, wie es ist. Sie können vermieden werden – gelingt das, werden bestimmte Arten von Fragen nicht mehr aufgeworfen, denn man wird sie als missverständliche entlarvt haben. Wie Hertz es in der wundervollen Einführung seiner Prinzipien der Mechanik ausdrückt: „Sind diese schmerzlichen Widersprüche entfernt, […], [hört] der nicht mehr gequälte Geist […] auf, die für ihn unberechtigte Frage zu stellen.“ Ebenso werden bestimmte Arten von Schlüssen aus einem empirischen Forschungsgegenstand nicht mehr gezogen werden, denn man wird realisiert haben, dass sie kaum oder gar nicht mit der Sache in Zusammenhang stehen, zu deren Erhellung sie beitragen sollten, obgleich sie mit etwas anderem in Zusammenhang stehen können.
Wenn es problematische Begriffe gibt, können sie dann nicht durch andere Begriffe ersetzt werden, die der nämlichen Erklärungsfunktion dienen? Ein Wissenschaftler ist stets frei, neue Begriffe einzuführen, wenn er die vorhandenen mangelhaft oder unzulänglich findet. Unser Augenmerk liegt in diesem Buch jedoch nicht auf dem Gebrauch neuer Fachbegriffe. Wir befassen uns mit dem Missbrauch der alten, nichtfachsprachlichen Begriffe – die Begriffe des Geistes und des Körpers, des Denkens und der Vorstellungskraft, der Empfindung und der Wahrnehmung, des Wissens und des Gedächtnisses, der willkürlichen Bewegung und des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins. Was die Zwecke angeht, denen sie dienen, sind diese Begriffe nicht unzulänglich. Es gibt keinen Grund für die Annahme, sie müssten in den Zusammenhängen ersetzt werden, die für uns von Belang sind. Problematisch ist hingegen, dass Neurowissenschaftler sie falsch auslegen und so zu Missverständnissen beitragen. Diese lassen sich durch eine korrekte Darstellung des logisch-grammatischen Gepräges der relevanten Begriffe beseitigen. Und genau das ist es, worum wir uns bemüht haben.
Wenn man auch zugesteht, dass die Neurowissenschaftler diese gewöhnlichen oder gebräuchlichen Begriffe nicht so verwenden, wie jedermann es tut, so stellt sich doch die Frage, mit welchem Recht die Philosophie behaupten kann, jene zu korrigieren. Wie kann die Philosophie die Klarheit und Kohärenz von Begriffen, wie sie durch kompetente Wissenschaftler Verwendung finden, mit einer derartigen Entschiedenheit beurteilen? Wie kann die Philosophie sich mit der Feststellung positionieren, dass bestimmte, von anspruchsvollen Wissenschaftlern hervorgebrachte Behauptungen keinen Sinn ergeben? Auf den folgenden Seiten werden wir derartige methodologische Bedenken zerstreuen. Allerdings könnten gewisse klarstellende Bemerkungen an dieser Stelle bereits einige von ihnen beseitigen. Was Wahrheit und Falschheit für die Wissenschaft, sind Sinn und Unsinn für die Philosophie. Empirischer und theoretischer Irrtum resultiert in Falschheit; begrifflicher Irrtum resultiert in einem Mangel an Sinn. Wie kann man die Grenzen des Sinns untersuchen? Nur indem man den Gebrauch der Worte untersucht. Oft entsteht Unsinn, wenn ein Ausdruck entgegen den Regeln seines Gebrauchs verwendet wird. Der fragliche Ausdruck mag ein gewöhnlicher, nichtfachsprachlicher Ausdruck sein, in welchem Fall seine Gebrauchsregeln seiner Standardverwendung und den Erklärungen seiner Bedeutung ‚entnommen‘ werden können. Oder es kann ein fachsprachlicher Kunstausdruck sein; in diesem Fall müssen die Gebrauchsregeln seiner Einführung durch den Wissenschaftler entnommen werden und den Erklärungen, die dieser bezüglich der vorgegebenen Anwendung des Ausdrucks gibt. Beide Ausdrücke können missbräuchlich verwendet werden, und wenn das geschieht, entsteht Unsinn – ein Gebilde aus Worten, das aus der Sprache ausgeschlossen ist. Denn entweder wurde nichts vereinbart, was die Bedeutung des Ausdrucks in dem irrtümlichen fraglichen Kontext angeht, oder dieses Wortgebilde ist tatsächlich durch eine Regel ausgeschlossen, die festlegt, dass es kein solches Ding gibt wie … (dass es z.B. so etwas wie ‚den Osten des Nordpols‘ nicht gibt), dass es sich um ein Wortgebilde handelt, für das keine Anwendung vorgesehen ist. Unsinn entsteht gemeinhin auch dann, wenn ein existierender Ausdruck einer neuen, möglicherweise fachlichen oder quasifachlichen Verwendung zugeführt wird und diese neue Verwendung sich versehentlich mit der alten überschneidet – wenn beispielsweise aus Propositionen, die den neuen Ausdruck enthalten, Schlüsse gezogen werden, die nur aus der Verwendung des alten gezogen werden dürften. Es ist die Aufgabe begrifflicher Kritik, solche Überschreitungen der Grenzen des Sinns zu identifizieren. Es ist freilich nicht damit getan zu zeigen, dass ein bestimmter Wissenschaftler den Ausdruck nicht seinem gewöhnlichen Gebrauch entsprechend verwendet – denn er könnte ihn auch in einem neuen Sinn benutzen. Der Kritiker muss nachweisen, dass der Wissenschaftler den Ausdruck im üblichen Sinn zu verwenden beabsichtigt und dass er das nicht getan hat oder dass er den Ausdruck in einem neuen Sinn zu verwenden beabsichtigt, den neuen Sinn jedoch mit dem alten gekreuzt hat. Der auf Abwege geratene Wissenschaftler sollte, wann immer möglich, mit seinen eigenen Worten widerlegt werden. Im Detail widmen wir uns methodologischen Zweifeln sowohl in Kapitel 3, Unterpunkt 3, als auch in Kapitel 14.
Bei der letzten Fehlkonzeption, vor der wir warnen wollen, handelt es sich um die Vorstellung, dass unsere Reflexionen durchweg negativ seien. Alles, womit wir uns befassen, so könnte man meinen, sei die Kritik. Unsere Arbeit könnte einer oberflächlichen Betrachtung als bloßes destruktives Unternehmen scheinen, das weder Hilfe leistet noch eine neue Perspektive eröffnet. Schlimmer noch, sie könnte sogar den Anschein erwecken, sie habe es auf eine Konfrontation von Philosophie und Neurowissenschaften abgesehen. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein.
Wir haben dieses Buch in Bewunderung für die Leistungen der Neurowissenschaften des 20. Jahrhunderts geschrieben und zugleich mit dem Verlangen, ihnen beizuspringen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie eine begriffliche Untersuchung ein empirisches Fachgebiet unterstützen kann, nämlich indem sie die (gegebenenfalls auftretenden) begrifflichen Irrtümer identifiziert und eine Karte zur Verfügung zu stellt, welche die empirischen Forscher davon abhält, die Hoheitswege des Sinns zu verlassen. Jede unserer Untersuchungen trägt dazu zwei Aspekte bei. Einerseits haben wir versucht, begriffliche Probleme und Verwirrungen innerhalb bedeutender gegenwärtiger Theorien über Wahrnehmung, Gedächtnis, Vorstellungskraft, Emotion und Wollen ausfindig zu machen. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass viele der aktuellen Schriften darüber, worum es sich bei Bewusstsein und Selbstbewusstsein handelt, unter begrifflichen Problemen zu leiden haben. Dieser Aspekt unserer Untersuchung ist in der Tat negativ und kritisch. Andererseits haben wir uns in jedem Fall darum bemüht, eine verständliche Darstellung des Begriffsfeldes jedes der problematischen Begriffe auszuarbeiten. Und das ist eine konstruktive Anstrengung. Wir hoffen, dieser begriffliche Überblick wird die Neurowissenschaftler bei ihren Reflexionen über die Ausgestaltung ihrer Experimente unterstützen. Es kann allerdings nicht die Aufgabe einer begrifflichen Untersuchung sein, empirische Hypothesen vorzuschlagen, die die empirischen Probleme, mit denen Wissenschaftler sich konfrontiert sehen, lösen könnten. Die Klage darüber, dass eine philosophische Untersuchung der kognitiven Neurowissenschaften keinen Beitrag für eine neue neurowissenschaftliche Theorie verfügbar mache, kommt der Beschwerde bei einem Mathematiker gleich, das neue, durch ihn bewiesene Theorem sei keine neue physikalische Theorie.
Es ist unwahrscheinlich, dass viele Neurowissenschaftler eine über 550 Seiten lange begriffliche Untersuchung von Anfang bis Ende werden lesen wollen. Dementsprechend haben wir versucht, die auf ausgewählten psychologischen Begriffen beruhenden Kapitel so zu gestalten, dass sie weitestgehend unabhängig voneinander sind. Wir verbinden mit unserem Buch die Hoffnung, dass es den kognitiven Neurowissenschaftlern, die den Konturen der für ihre Forschung relevanten psychologischen Begriffe nachgehen wollen, als ein begriffliches Referenzwerk dienen wird. Was freilich bedeutete, dass Wiederholungen zwischen bestimmten Kapiteln unumgänglich waren. Wir hoffen, dass der Zweck dies rechtfertigt.
Den Überschriften im Inhaltsverzeichnis sind die kursiv gesetzten Namen von Neurowissenschaftlern (und gelegentlich von Philosophen, die sich mit neurowissenschaftlichen und kognitionswissenschaftlichen Themen befassen) beigefügt, deren Theorien entweder detaillierter erörtert oder en passant im Kapitel erwähnt werden. Das wird es dem Leser hoffentlich ermöglichen, die ihn besonders interessierenden Themen und Ausführungen leicht zu entdecken.