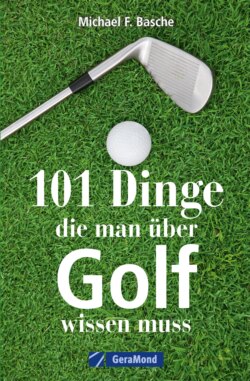Читать книгу 101 Dinge, die man über Golf wissen. - Michael F. Basche - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление9 Große Oper
Architektur und Design
Was macht einen großartigen Golfplatz aus? Ganz einfach: Jedes Loch wird zum Erlebnis, ohne den Spieler mit Eindrücken zu überfrachten oder mit unüberschaubaren Problemen zu malträtieren; eine brillante Bahn bietet unterhaltsame Herausforderungen für Golfer aller Klassen, bei denen das Auge mitspielt und die Seele gestreichelt wird. „Eine Golfrunde sollte 18 Inspirationen bieten“, hat vor einem Jahrhundert der angesehene Architekt Albert W. Tillinghast philosophiert. Und das „Bühnenbild“ sich stets „an den gestalterischen Vorgaben der Natur orientieren“. Das gilt bis heute.
Ein kolossaler Kurs vor kongenialer Kulisse ist schlichtweg große Oper. Es gibt die Ouvertüre: ein, zwei Auftaktlöcher, die den Spieler auf das Kommende einstimmen, ihm schmeicheln, ihn mit dem Kurs warm werden lassen. Pure Psychologie. Niemand will schon auf der ersten Bahn Frust schieben und bereuen, die Anlage überhaupt betreten zu haben.
Architektur-Arie: Die Überarbeitung nahezu aller Bahnen macht aus dem Golf Club Föhr ein Paradebeispiel für modernes, weil puristisches Platzdesign.
Wie das musikalische Vorbild hat auch der perfekte Platz seine Arien im Programm, die besonderen Höhepunkte in Form imposanter Löcher. Gefolgt von weniger aufwühlenden Intermezzi zum mentalen Verschnaufen, bevor die Runde idealerweise in einem fabelhaften Finale endet, das noch einmal alle Sinne und Fertigkeiten fordert, den Wunsch nach Wiederholung weckt. Sei’s bloß, weil man mit dem Platz nun eine Rechnung offen hat. „Kurse zu gestalten, die selbst Vergnügen bereiten, wenn du schlecht spielst, das ist die Kunst der Golfarchitektur!“, sagt Tom Doak, einer der brillanten Designer unserer Zeit.
Das Wesen eines Golfplatzes ist seine größtmögliche Individualität bei nur wenigen räumlichen Vorgaben – wohl einzigartig im Sport. Trotzdem haben sich Gestaltungsgrundsätze etabliert, seitdem das einst wilde Geländespiel zum Ausgang des 19. Jahrhunderts in geregelte Bahnen gelenkt worden ist. Mit der Ausbreitung „auf dem platten Land“ musste künstlich kreiert werden, was Mutter Natur in den Dünen so verschwenderisch vorgegeben hatte: Landschaft, Routen, Hindernisse. Mangels schwerem Gerät und Faible für Formensprache waren die ersten artifiziell angelegten Plätze tatsächlich reine Spielfelder, schematisch, symmetrisch, linear, mit standardisierten Distanzen und brutalen Barrieren. Golf verkam zum Hindernisparcours.
Autodidakten wie dem schottischen Arzt und „Golden Ager“ Dr. Alister MacKenzie und seinem Faible für die Kunst der militärischen Tarnung im Gelände ist zu verdanken, dass diese Langeweile zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Lust an einer Golf-Landschaft verdrängt wurde; gestützt auf das intensive Studium des Old Course und seiner unvergleichlichen Ästhetik. Seither kategorisiert sich das Design von Golflöchern in vier Erscheinungsformen:
Beim „Free Way“, der „Autobahn“, existiert eine konkrete Spiellinie, die schnurstracks zum Grün führt. Alle Hindernisse liegen davon entfernt und haben bei halbwegs zielgenauem Ballflug lediglich optische Wirkung. Das bestrafende („penal“) Design ist ein Relikt aus den eben beschriebenen Anfängen des Platzbaus. Sekt oder Selters heißt die Devise, ohne Alternativen: Scheitert man am Hindernis, droht Schlagoder gar Ballverlust.
Kreative Konzeption: „Eine Golfrunde sollte 18 Inspirationen bieten“, wissen exzellente Designer.
Hilfe aus Hollywood: Für den Bau des Steinbruchs auf dem Palmer South Course im irischen K Club wurden eigens Experten für Spezialeffekte angeheuert.
Königsdisziplin strategisches Design
Das heroische Design, gleichsam bekannt als „Risk and Reward“ hat bestrafende Spurenelemente. Der Architekt legt dem Golfer ein Hindernis in den direkten Weg zum Grün, das es zu über- oder umspielen gilt – Bunker, Wasser, Richtungswechsel. Wer was wagt, der gewinnt und wird mit einem kürzeren oder bunkerfreien Schlag Richtung Fahne belohnt. Oder mit beidem.
Der strategische Loch-Typ schließlich ist die Königsdisziplin des Golfdesigns. Auf jeder Bahn werden mehrere Wege zum Grün angeboten. Sie unterscheiden sich durch Art und Schwierigkeit der Hindernisse bzw. der Schläge, die zur Bewältigung notwendig sind. Schon am Tee ist der Golfer gefordert, eine Route zu wählen, die unter den herrschenden Bedingungen für seine Spielstärke erfolgversprechend erscheint. Der im Jahr 2000 verstorbene Star-Architekt Robert Trent Jones Sr. sagte einmal: „Das strategische Design soll den denkenden Spieler belohnen.“