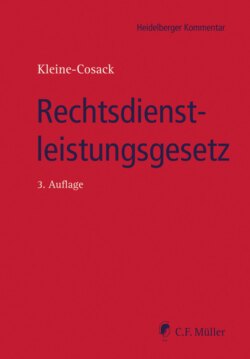Читать книгу Rechtsdienstleistungsgesetz - Michael Kleine-Cosack - Страница 111
(2) Schutzbedürftigkeit
Оглавление27
Die Rechtsuchenden müssen nicht nur schutzwillig sondern auch schutzbedürftig sein.
28
– Verbraucher/Unternehmer
Nach der Gesetzesbegründung soll kein Unterschied bestehen, ob der Rechtsuchende Verbraucher (§ 13 BGB) oder „Unternehmer“ (§ 14 BGB) ist.[25] „Verbraucherschutz“ im Sinn des RDG sei damit stets der Schutz aller Rechtsuchenden.[26]
29
Die fehlende Differenzierung vermag jedoch nicht zu überzeugen; schließlich sind Unternehmer – gleiches gilt bei Rechtskundigen wie Richtern oder Rechtsanwälten – im Regelfall nicht schutzbedürftig. Sie sind meist geschäftserfahren genug und zur Wahrung ihrer Interessen nicht darauf angewiesen, dass man ihnen den Gang zum Rechtsanwalt vorschreibt, zumal sie nicht selten über eigene externe und interne Juristen wie z. B. Syndikusanwälte verfügen. In Spezialregelungen findet sich durchaus die Differenzierung zwischen Verbraucher und Unternehmer. So bestimmt § 34e GewO „Die Versicherungsmaklererlaubnis enthält die Befugnis, Dritte, die nicht Verbraucher sind, bei der Vereinbarung, Änderung und Prüfung von Versicherungsverträgen gegen gesondertes Entgelt rechtlich zu beraten.“
30
– Verkehr zwischen Unternehmen
Soweit das RDG zudem entsprechend der früheren weiten Auslegung des RBerG auch bei einem Rechtverkehr zwischen Unternehmen gelten, es z. B. auch dann Anwendung finden soll, wenn eine Gesellschaft eine andere Gesellschaft rechtlich berät, so erscheint auch hier die Anwendung des Gesetzes völlig verfehlt. § 2 III Nr. 6 bestimmt zwar zu recht, dass die Erledigung von Rechtsangelegenheiten innerhalb verbundener Unternehmen (§ 15 AG) erlaubnisfrei ist. Diese Einschränkung dürfte jedoch nicht ausreichend sein. Schließlich fehlt es auch in anderen vergleichbaren Fällen am Schutzbedürfnis. Vor allem sind derartige Vorgänge überhaupt nicht zu kontrollieren, hängt doch die Reichweite des Erlaubnisvorbehalts z. B. davon ab, wie die Beteiligungsverhältnisse an den verschiedenen Gesellschaften sind. In der Praxis gibt es dementsprechend auch keine Fälle, in denen hier eine Erlaubnispflicht statuiert wurde.
31
Erst recht ist bei großen Unternehmen mit eigenen Rechtsabteilungen und hochqualifizierten Rechtsanwälten die Statuierung eines Erlaubnisvorbehalts mit der Verpflichtung zur Einschaltung eines niedergelassenen Rechtsanwalts schlicht abwegig. Im Prinzip ist die Annahme eines Erlaubnisvorbehalts bei Unternehmern teleologisch wie verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.
32
Der Auslegung des RDG ist auch insoweit Rechnung zu tragen, als sich zwischenzeitlich die Formen wirtschaftlicher und beruflicher Tätigkeit erheblich gewandelt haben. Es stehen die unterschiedlichsten Formen zur Verfügung, wie z. B. neben der Einzeltätigkeit in BGB- und Partnerschaftsgesellschaften, die OHG, KG, AG, GmbH, Kooperationen und ihre Pendants in anderen Ländern. Für die Wahl bestimmter Formen sind die unterschiedlichsten Gründe maßgeblich; Steuerrecht, Wettbewerbs-, Berufsrecht etc. können ausschlaggebend sein. Diese Aspekte sind jedoch am Maßstab der Verbraucherschutzfunktion des RDG irrelevant.[27]
33
Daher kann auch im Falle des heute häufig praktizierten Outscourcings nicht ohne weiteres eine Erlaubnispflicht angenommen werden. Unternehmen – wie z. B. Versicherungen im Hinblick auf die Schadensbearbeitung[28] – und Interessenverbände lagern Rechtsbesorgungstätigkeiten, die sie bisher selbst wahrgenommen haben, zunehmend aus Gründen ökonomischer Effizienzsteigerung auf verselbstständigte Einheiten aus. So hat z. B. auch der DGB seine arbeitsrechtliche Rechtsberatungs- und Prozesstätigkeit 1998 bei einer DGB-eigenen Rechtsschutz-GmbH konzentriert.[29]
34
Zwar handelt sich damit formal um eine erlaubnispflichtige Wahrnehmung fremder Rechtsangelegenheiten durch Nichtrechtsanwälte und greift auf den ersten Blick der Ausnahmetatbestand des § 5 nicht ein. Schließlich gestattet er nur Unternehmen, rechtliche Angelegenheiten für ihre Kunden zu erledigen, die mit einem Geschäft ihres Gewerbebetriebes im Zusammenhang stehen. Bei der gebotenen telelogischen sowie verfassungskonformen Auslegung verbietet sich jedoch die Annahme einer Erlaubnispflicht; sie kann schließlich nicht von der Wahl der Rechtsform abhängen. Nichts anderes gilt im übrigen bei der Auslagerung von Rechtsbesorgungstätigkeiten im Bereich der öffentlichen Verwaltung auf privatrechtliche Gesellschaften.[30]
35
– Elektronischer Rechtsverkehr
Es vermag auch nicht zu überzeugen, wenn das RDG keine Einschränkung enthält, soweit es um die Erbringung von Rechtsdienstleistungen mittels moderner Kommunikationstechnik geht.[31] Für die Frage, ob Rechtsdienstleistungen erbracht werden, sei es – so die ABG[32] – unerheblich, mit welchen technischen Mitteln dies erfolgt. So sei das Vorliegen einer Rechtsdienstleistung nicht etwa deshalb ausgeschlossen, weil der Rechtsuchende keinen persönlichen Kontakt zu dem Dienstleistenden aufnimmt, sondern etwa über eine Telefon-Hotline oder ein Internetforum seine konkreten Rechtsfragen prüfen lassen will. Hier hänge es stets vom Inhalt des Beratungsangebots und der Erwartung des Rechtsuchenden ab, ob die Beratung als Rechtsdienstleistung einzustufen ist. – Dieser Begründung ist jedoch entgegenzuhalten, dass bei bestimmten Medien mit steigender Anonymität die Schutzbedürftigkeit des Rechtsuchenden abnimmt, zumal die Einhaltung der Grenzen – z. B. die Einschaltung von Rechtsanwälten – überhaupt nicht kontrollierbar ist.