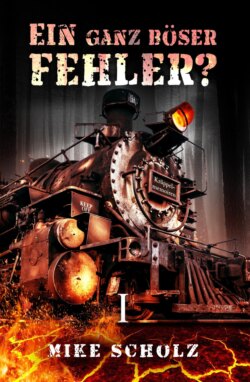Читать книгу Ein ganz böser Fehler? - Mike Scholz - Страница 11
Оглавление2
Am nächsten Tag glaube ich, der Zeitpunkt ist gekommen, von hier zu verschwinden. – Ja, danke, es war wunderschön hier. Doch es ist nichts nach meinem Geschmack; darum winke–winke. – Ich fühle mich munter und frisch genug, misslingen also ausgeschlossen.
Aufrichten. Muss dabei bemerken, mein Kopf zittert wie im Sturm befindliches Espenlaub. Doch im Moment kann ich dagegen nichts tun, also ab in den Hinterkopf damit.
Der Fußboden vor mir scheint eben, begehbar zu sein.
Auf einmal registriere ich, wie irgendein Blick auf mir ruht. Ich hebe den Kopf, lasse meinen eigenen umherkreisen – dann: Ein älterer Patient beobachtet mich argwöhnisch. – Spinnt der? Was hat denn der zu gucken? Der ist wohl neidisch? Na, was soll's; mich juckt es ja eh nicht. Weiter geht es.
Die Beine stoßen die Bettdecke weg und stellen sich auf. Rechts ist das noch etwas komisch, aber egal jetzt. Eeh, wenn ich hier erst einmal raus bin, nicht mehr unter dem hiesigen Einfluss stehe, dann wird sich das schon geben.
In dem Moment – es klingelt. Verdutzt schaue ich mich um – der Alte hat geklingelt. Mistbock. Schleunigst wieder ins Bett.
Eine Schwester kommt hereingerannt. "Wer hat geklingelt?", will sie wissen.
Der ältere Patient meldet sich: "Ich war's. Der Junge da drüben war aufgestanden."
"Ist irgendwas nicht in Ordnung?", wendet sie sich an mich.
Ich gucke ganz unschuldig und zucke mit den Schultern.
"Okay, aber mache das nie wieder!"
Kaum ist sie weg, schnellt mein Körper wieder in die Höhe.
Es klingelt.
Ich lasse mich wieder zurückfallen und werde so wütend, dass ich ihm den Hals umdrehen könnte, wäre er in meiner Reichweite: Scheinbar will der sich als Amme aufführen. Hat der nicht mehr alle? Doch was bleibt mir anderes übrig? Ich muss nach wie vor gute Miene zum bösen Spiel machen, die Schwester ganz unschuldig anlächeln. Wird nur mit jedem Mal schwerer.
Die gleiche Schwester wie vorhin. Der Hilfsaufpasser reckt nur seinen Finger in meine Richtung, worauf sie sofort zu mir weiterläuft.
"Also wenn ich wegen dir noch einmal gerufen werde, passiert was!", schreit sie mich an. "Dann schnalle ich dich wieder fest!"
Darauf zu nicken, fällt mir schwer, doch ich tue es. Muss es tun, denn sonst passiert das sofort; man kann erkennen, dass sie dazu bereit ist.
Nach ihrem Weggang beobachte ich erst einmal meinen Aufpasser, um erfassen zu können, wann sich mir eine reelle Chance zum Aufstehen und Abhauen bietet.
Nach einer langen Weile – einer unendlich langen Weile; kostbare Zeit geht mir dadurch verloren – hat er vom mich Anstarren genug und wendet sich ab.
Jetzt!
Wie auf einem schlappen Trampolin liegend katapultiere ich mich aus dem Bett. Ein Schritt, der zweite – plötzlich knicke ich mit dem rechten Bein um und lande unter dem Bett.
Es klingelt. Ich mache mir nicht erst die Mühe des Aufstehens.
Die Schwester kommt wieder hereingerannt und stürmt sofort auf mein Bett zu. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr Gesicht jetzt zorngerötet ist, die Blutadern pulsierend hervortreten wie bei einem, der soeben gehenkt wird.
Nach einem längeren Augenblick erscheint ihr Gesicht in meiner Höhe. "Was soll das? Du willst dich wohl völlig umbringen?" Ihr Gesicht ist tatsächlich hochrot.
Ich fange an zu grinsen. – Soll ja helfend sein, habe ich gehört. – Was sie dazu animiert, es mir gleichzutun. – Sieht so richtig niedlich aus. Das andere stand ihr nicht.
"Und, wie kommst du jetzt wieder hoch?"
Eh, mache dir darum mal keine Sorgen.
Ich bedeute ihr mit einer einladenden Geste, sich neben mich zu legen; worauf sie mir aber ein Stirnrunzeln herüberschickt.
Kann sie das Zeichen nicht richtig interpretieren oder ist es ihr unterm Bett zu unromantisch?
Da sie die Frage nicht hört, kann sie auch nicht antworten. Bedauernd zucke ich deswegen mit den Schultern; schnappe mir danach mit links eine Bettstütze und ziehe mich hoch, wobei sie mir hilft.
Oben lasse ich mich erleichtert ins Bett fallen. Muss dabei erstaunt feststellen, dass das unnormal anstrengt, Höchstleistungen von mir abfordert. Was aber nicht heißt, dass ich es nie wieder machen werde. Obwohl sie mir eine "letzte Warnung" gegeben hat und ich angeschnallt sein als beschämend empfinde.
Es klingelt.
Diesmal schimmert kein Lächeln auf den rosigen Wangen der Schwester, ihr Gesicht ist eine starre Maske, durchpulst von übermächtigem Ergrimmen. Mir wird klar, jetzt ist der Zeitpunkt der Hinrichtung gekommen, jetzt brauche ich nicht erst die unschuldsvolle Miene aufzusetzen, jetzt hätte sie keinen Sinn mehr.
"Jetzt reicht es! Jetzt wirst du angeschnallt!", bestätigt sie meine Befürchtung.
Ich will dagegen was sagen; muss aber wieder mal feststellen, dass ich vergessen habe, dies ist unmöglich – zurzeit, denn ich bin fest davon überzeugt, dass es mir wieder gelingen wird. – Ich greife zu meiner einzigen Kommunikationsmöglichkeit – schüttle heftig den Kopf wie bei Rock'n Roll.
Sie ignoriert es.
Ich balle die linke zur Faust und wehre mich. Sie ruft eine zweite Schwester herbei; nun liegt das Kaninchen auf der Schlachtbank.
*
Wieder allein. Angeschnallt an der linken Hand. Ich bin ein Schwerverbrecher, der im Zuchthaus an den Ketten hängt und auf seine Hinrichtung wartet. Meine Wut, sie wird unvorstellbar groß, wächst immer weiter, so dass es mich schon fast selber vor ihr graust: Wenn ich reden könnte, würde ich den dafür schuldigen Alten so belegen, dass er sich unterm Bett verkriechen müsste und die Maden in seinem Gesicht verschwänden. Doch es gibt kein Abflussventil für meine Wut! Nicht durch den Mund, nicht durch die Hände! Oder doch? Meine rechte Hand ist nicht festgeschnallt; man nimmt ja an, ich könne sie nicht rühren. Doch niemand hat bedacht, dass die Finger ein bisschen beweglich sind. Damit müsste es doch gehen, nicht? Okay, ich versuche es. Und wenn ich es geschafft habe, was mache ich dann: dem Alten erst eine reinziehen oder gleich verduften?
Ich bekomme tatsächlich die beiden Hände zusammen, zumindest soweit, dass ich mit der rechten den Gurt berühre, muss ihn nur noch aufbekommen.
Immer wieder habe ich es versucht, und es gelang mir auch, den Gurt zu lockern. Doch gelöst hat er sich nicht. Weil mir das Gefühl in der Hand fehlt. Was mache ich nur? Was? Sollte das schon alles gewesen sein?
Die Schwester kommt herein und schaut nach, ob mein Gurt noch sitzt.
Ja, Frau Wärterin, meine Fessel ist noch dran.
Sobald sie wieder verschwunden ist, versuche ich es noch einmal wie vorhin.
Wieder nichts. Doch so schnell werde ich mich nicht unterkriegen lassen.
Plötzlich fällt mir eine vielversprechende Möglichkeit ein.
Ich führe meinen Kopf an den Gurt, fasse diesen mit den Zähnen. Und – ääh, schmeckt furchtbar beschissen – er löst sich tatsächlich. Immer weiter.
Die Schwester kommt schon wieder herein. Sieht den nun fast gelösten Gurt.
"Das kann doch wohl nicht wahr sein", stöhnt sie auf. "Das kann es doch nicht geben! Vor dir ist wohl gar nichts sicher?" Und will mich wieder festbinden.
Ich gebe es auf. Lege meine linke zur rechten Hand, was als Zeichen dafür gilt, dass ich ein Nickerchen machen will. Denn nur, wenn ich die Notlichtlampe hinter meinen Lidern beschaue, kann ich schlafen.
Sie gewährt mir die Erholung.
*
14.00 Uhr. Ein älterer Mann in weißem Kittel wird mir vorgestellt. Er soll mich bei meiner Krankengymnastik anleiten. Ich weiß zwar nicht, was Krankengymnastik beinhaltet und warum die bei mir angewandt wird, doch der Mann ist sympathischer Natur, schnell fasse ich Vertrauen zu ihm.
"Guten Tag! Wie geht es?", fragt er mich als erstes.
Ich weiß nicht, ob ich den Daumen heben oder senken soll, also lächle ich.
"Jetzt machen wir erst einmal paar Tests und dann schreiten wir zur Tat."
Er schaut nach, wie die Beweglichkeit meiner Arme und Beine aussieht: Das linke Bein kann ich ein paar Zentimeter anheben, rechts ist die ganze Seite katastrophal – kein Drehen, kein Heben, keine Bewegung, nichts. Warum?
*
Am Ende dieser Krankengymnastik bin ich schon in der Lage, das rechte Bein einen Mikrometer anzuheben.
Wow, super! Wenn ich bedenke, dass ich vor nicht allzu langer Zeit im Stehen das Knie bis zur Brust brachte ... wow, Superleistung! – Er bescheinigt mir das auch. – Eeh ich weiß zwar nicht, warum ich hier liege, doch ich bin schon in der Lage, das rechte Bein und auch den Arm soweit anzuheben, dass sie nicht einstauben. Und mit dem linken Bein kann ich schon tieffliegende Mücken jagen. Und wenn ich die zur linken Hand treibe, kann ich sie sogar erschlagen. Wow, was bin ich glücklich! Der glücklichste Augenblick in meinem Leben!!! – Scheiße hoch ... ich weiß nicht, wie viele Nullen.
Als er dann fertig ist, einigen wir uns noch darauf, dass er – wenn es geht – zweimal am Tage kommt.
*
Wieder allein. Ich liege im Bett und stelle zum ersten Mal fest, wie langweilig es hier ist. Habe auch nichts zum Lesen. Normalerweise vertreibe ich mir die Zeit immer damit, aber hier – Fehlanzeige. Was dann?? Üben, was er mir gerade gezeigt hat? – Affig, okay, denn wenn es mir gelingt, hier abzuhauen, ist das mit den unbeweglichen Beinen und Armen eh gegessen; doch irgendwas muss man ja tun gegen dieses scheiß-nagende Scheusal, das sich Langeweile nennt.
*
Meine Mutter lässt sich wieder mal blicken, bringt ein junges Mädchen mit, dass ich sofort als meine Schwester erkenne.
"Hallo Mike, wie geht es dir?"
Ich lächle. Bin froh darüber, Besuch zu bekommen. Denn es ist mein einziger Kontakt zur – Außenwelt? Wenn ich hier wirklich in einem Krankenhaus liege, kann es ja nur die Außenwelt sein.
Meine Mutter hat Saft und Früchte mitgebracht, übermittelt mir Grüße von Leuten, an die ich mich sofort erinnern kann: ehemalige Lehrer, frühere Klassenkameraden. Doch was jetzt für mich primär ist: Ich will endlich was über den letzten Monat erfahren!
Darum starte ich einen Versuch, mich mit Gesten verständlich zu machen. Die aber nicht verstanden werden, auch nicht von meiner Schwester, obwohl sie krampfhaft versucht, sich in meine Sprache hineinzuversetzen. Allerdings glaube ich, dass selbst ich meine Gesten nicht verstanden hätte, wenn ich nicht wüsste, was sie bedeuten.
Plötzlich habe ich einen neuen Einfall: Na klar, ich werde einfach das, was mich bewegt, aufschreiben.
Nachdem ich mir Stift und Zettel habe bringen lassen, erscheinen die ersten Striche auf dem Papier. Und da ich Rechtshänder bin, schon immer mit rechts schrieb, versuche ich es auch automatisch mit rechts. Doch – weit komme ich damit nicht. Ich kann den Stift einfach nicht festhalten! Wenn ich ihn ansetze, muss ich immer ohnmächtig und von Grausen erfüllt sehen, wie er mir wegrutscht, wie er gegen meine Finger drückt und dann zwischen ihnen hervortritt wie beim Seewolf die zerquetschte Kartoffel, weil sie keinen Gegendruck erzeugen können.
Oh no! Sollte ich etwa überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, meine Fragen in die Öffentlichkeit zu bringen? Ich kann nicht sprechen! Ich kann keine Zeichensprache! Ich kann nicht schreiben! Ich kann nichts! Nichts!! Nichts!!! Bin ich auf Ewigkeit dazu verdammt, in meiner eigenen Traumwelt zu leben, in ihr ständig isoliert zu sein, weil ich sie niemandem vermitteln kann??
"Mike, versuche es doch mal mit links!", reicht mir plötzlich meine Schwester einen Vorschlag herüber. Einen brauchbaren, glaube ich.
Ich versuche es. Muss dabei feststellen, das Schreiben klappt, nur – selbst ich kann es nicht lesen.
Meine Mutter und meine Schwester natürlich auch nicht. Darum versuche ich es noch einmal, krakle diesmal ganz, ganz langsam, Strich für Strich sorgfältig ausführend, Punkt für Punkt besonnen nachdrückend. Sieht auch etwas besser aus; doch – auch jetzt können sie sich nicht hineinversetzen.
Sie rufen eine Schwester; die schaut es sich konzentriert an, kommt dann dahinter: "Wie komme ich hierher?"
Ich juble innerlich, könnte der Schwester um den Hals fallen: Du bist ein Schatz! Die ersten Worte von mir, seit ich hier drin bin, die das Tageslicht erblicken.
"Das erfährst du nächste Woche", sagt meine Mutter. "Jetzt wäre es noch zu zeitig dazu."
Ich glaube, mich verhört zu haben: Warum will sie mir das verheimlichen?
Plötzlich durchzuckt mich ein Schatten, der mir zuflüstert, ich hätte schon vor meinem Hiersein nicht das beste Verhältnis zu ihr gehabt. Aber das warum, wieso, weshalb usw.. bleibt im Dunkeln. Nur katapultiert es mich zögerlich doch stetig zu der Überzeugung, dass sie die Ursache für diesen Schlamassel ist: Vielleicht will sie mich wieder an sich binden, damit ich ihr den Dreck wegräume.
Ich stutze: Woher kommt dieser Gedanke schon wieder? Und spüre, dass sich irgendetwas hinter diesem Blitz verbirgt, irgendeine Wahrheit, vielleicht irgendetwas mich aufklärendes, zu dessen Schloss ich aber den Schlüssel nicht finden kann, vielleicht nie mehr finden soll und deshalb nie mehr finden werde.
Wütend schaue ich vor mich hin. Die Wärme, die ich so wohltuend empfand, hat sich in Luft aufgelöst; wenn ich meine Mutter ansehe, fühle ich, wie Erinnerungen an die Oberfläche wollen, nur noch keine Öffnung finden. Und ich muss ehrlich sagen: Ich habe Angst vor den Erinnerungen; und doch gelüstet es mich, den Schleier von ihnen herunterzureißen, mich den sicher existierenden Komplikationen zu stellen.
Meine Mutter und meine Schwester – sie nimmt mein Geschriebenes mit, um sich mit ihm vertraut machen zu können – gehen wieder; mit dem Versprechen, auch morgen wiederzukommen.