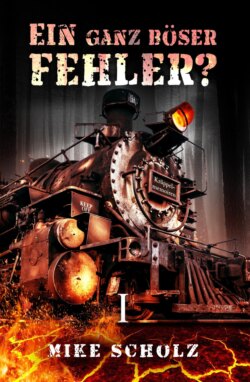Читать книгу Ein ganz böser Fehler? - Mike Scholz - Страница 28
Оглавление5
Dienstag, 25. September.
"Die bringe ich nun jeden Tag – oder besser, ich lass sie gleich hier", verkündet mir Frau Miller, die soeben in der Tür erschienen ist und auf die von ihr mitgebrachte Krücke weist; "du wirst ja damit keine Versuche starten, oder?"
"Ach, iwo. Ich bidoni lebensmüd-e." Gut, dass ihr meine Aktionen in der ITS nicht bekannt sind. Denn dann würde sie die Krücke wohl kaum hier lassen.
*
Während ihrer Gymnastik will sie wieder wissen, ob inzwischen meine Mutter hier war. Und nachdem ich den Kopf geschüttelt habe, ist sie sich dessen bewusst, dass nun etwas eingeleitet werden muss. – Aber wenn ich ganz ehrlich bin: Wären da nicht meine Anziehsachen, würde mich ihr Wegbleiben überhaupt nicht jucken. Denn Pia empfang ich viel lieber. – "Anders geht es bei ihr scheinbar nicht. – So, jetzt aber werden wir rauslaufen, auf den Gang."
Bei dieser Aufforderung fängt mein Herz an wie wild zu rasen, Schweißtropfen perlen auf meiner Stirn, ein unangenehmes Ziehen hat auf der Stelle von meinem Magen Besitz ergriffen. Trotzdem – oder gerade deswegen – drücke ich mich schnell zum Sitzen hoch, befördere meine Beine aus dem Bett und dann hilft mir Frau Miller. Vor meinem inneren Auge aber leuchtet jetzt wie bei einer Leuchtreklame das Wort auf: Spiegel. Denn nun bekomme ich sozusagen frei Haus die Chance geliefert, mich begucken zu gehen, darf nur nicht der Angst die Oberhand in mir überlassen.
Bis zur Tür klappt das Krückenlaufen schon eine Nuance besser als gestern. Wenn ich mich auch noch nicht dafür begeistern kann, die Knie durchzudrücken, wenn ich mich auch immer noch größtenteils auf Frau Miller stütze. Doch ich fange an, in den Rhythmus zu kommen, die Gefühle meiner Gehhilfe und meines Körpers haben begonnen, sich zu vereinigen.
Wir stehen auf dem Flur. Aufmerksam schaue ich mir den vor mir liegenden Fußboden an: Braunes Linoleum, eben, glatt, ohne Hügel. Und an der von mir aus gesehenen linken Seite hängt ein Balken, der bestimmt dem Festhalten dient.
"Und was nun?", will Frau Miller wissen.
Ich ignoriere ihre Frage, erkundige mich stattdessen, wo der nächste Spiegel ist.
"Gleich um die Ecke ist einer. Wollen wir bis dahin laufen?"
Ich nicke bedächtig, als ob in mir eine innere Ruhe eingekehrt ist.
*
Einige Zeit später stehe ich vor dem so lange herbeigewünschten Ziel. Schaue hinein, versuche, mich auf das Bild, was da vor mir auftaucht, zu konzentrieren: Ein krumm stehender, bärtiger, mit halblangen Haaren und hässlicher Frisur beschiedener Typ ist sich bei meinem Anblick nicht so sicher, ob er mir weiterhin die Ehre seiner Aufmerksamkeit schenken soll; zudem hängt auf der rechten Seite seine Lippe herunter (er grinst nur mit links) und hat für mich nur ein Stieren mit depressiven, von Wut, Schmerz und Hass gezeichneten Augen übrig.
Bin ich das???
Nein! Ich bin das nicht! Wer das sagt, ist ein Lügner! Der muss Unrecht haben! Und doch ... Aber ich ekle mich vor dem Kunden im Spiegel! ... Ekle ich mich vor mir selber?
Eine ganze Weile lang stehe ich davor, schüttle langsam den Kopf; bis sich eine folgenschwere Erkenntnis in meinem Kopf Bahn bricht: Ja, ich bin es! Bin es mit Leib und Seele! Bin es wahr und wahrhaftig!
Ich spüre, wie sich etwas in mir verkrampft: Dies war meine letzte Hoffnung, sollte mir aufzeigen, dass nicht Mike Scholz der Dahinsiechende ist. Doch er ist es! Niemals wurde ich verscheißert, mir wurde "nur" nichts gesagt!
"Na, genug gesehen?", bricht da Frau Miller in meine Hypnoseglocke ein. Doch erst einmal modelliere ich noch an der Frisur herum. Denn irgendjemand hat mir einen Seitenscheitel übergezogen.
*
Beim Zurückwandeln schwinden mir wieder mal rapide die Kräfte in den Beinen. Frau Miller hat ganz schön zu tun, mich oben zu halten. Und so lasse ich mich zurück im Zimmer sofort erschöpft und traurig in mein Bett plumpsen, während Frau Miller erleichtert keucht: "Endlich, geschafft. Du kannst dich ganz schön schwer machen. – Und, befriedigt für heute?"
"Biseut Nammag ja. Aber dann habch mi wiedr erholt."
"Heute klappt es noch nicht mit zweimal am Tag", teilt sie mir bedauernd mit. "Aber ab nächste Woche können wir es durchziehen. Also, tschüss bis morgen."
An der Tür dreht sie sich noch einmal um und hebt den Zeigefinger. "Aber keine krummen Touren mit der Unterarmstütze! Ich vertraue Ihnen. Oder soll ich sie doch lieber mitnehmen?"
Ich halte ihrer Blickkontrolle stand, worauf sie beruhigt geht.
*
Am Nachmittag kommt Pia. Eigentlich erwarte ich sie jeden Tag, obwohl ich natürlich weiß, dass es so nicht mehr sein kann. Doch es ist belastend, wenn man abgeschnitten ist von der Außenwelt. Nur – aller drei Tage ist besser als überhaupt nicht.
Eine Schwester kommt gleich mit herein. "Wollen Sie Mike mit rausnehmen? Wir packen ihn vorher ein, damit er sich nichts holt. Sonnig ist es ja."
"Von mir aus, wenn es geht", meint Pia.
*
Auf der kleinen Rundfahrt durch das Krankenhausgelände kommen wir zu einem Haus, an dem die Fenster vergittert sind, und wo sich davor ein Rudel Katzen tummelt.
Pia versucht sie anzulocken: "Miez Miez Miez – nix zu machen, die sind zu scheu."
Plötzlich hören wir einen barbarischen Brüller aus dem Haus.
"Was war denn das?", fängt Pia an zu staunen. Doch ich kann ihr keine passable Antwort geben, denn dieses Geräusch ist mir genauso unerklärlich wie ihr.
Dafür erscheint eine Schwester: "Kommen Sie bitte nicht so nahe heran. Die Patienten drin werden sonst nervös."
"Wir entfernen uns wieder", wird sie von Pia beruhigt.
Doch bevor wir wieder gehen, schauen wir erst auf das vor uns stehende Schild, um zu erfahren, was dies für eine Station sein soll.
"Aha, das ist ein Teil der Klapper", schlussfolgert Pia. "Deswegen wohl auch die vergitterten Fenster. Die dürften dazu da sein, dass keiner aus dem Fenster springen kann."
"Jetzolln wir abee liebr verschwindn", rate ich ihr. "I hanämich keenlus, vonem Geisestörn gekillt zu werdn."
Wir machen uns darüber noch eine Weile lustig. – Warum eigentlich? Die können doch nichts dafür. Ebenso wenig, wie ich was dafür kann, dass ich jetzt im Rollstuhl durch die Gegend krauche. (Nehme ich zumindest an.) Also, worüber machen wir uns dann lustig? Wir müssen doch froh sein, dass wir davon nicht betroffen sind. Und außerdem gibt es spezielle Sachen, die nur ein Geistesgestörter beherrscht. – Doch ich gefalle mir jetzt darin zu spinnen, kann nicht aufhören, darüber zu feixen, genieße dieses Gefühl, dass es nicht gegen mich geht, endlich wieder mal in vollen Zügen nach so langer Durststrecke.
*
Wir stoßen auf eine Bank, wo sich Pia hinsetzt, um rauchen zu können.
"Also Lus habch ou. Gibs mir bidde eene?"
"Meinst du echt, dass das gut für dich ist?"
"Viellcht fangch wiedran. Die Langeweilisett quäln."
Sie reicht mir die halb aufgerauchte Zigarette herüber. Ich aber muss nach dem ersten Zug feststellen, dass es bescheiden schmeckt. Hinzu kommt noch ein Reiz in der Kehle. Kann mich aber erinnern, dass dies nach einer langen Phase normal ist.
Ich nehme trotzdem einen zweiten Zug – und fange an zu husten – ausgiebig zu husten.
Pia nimmt mir die Zigarette sofort wieder weg.
"Siehst du, es ist doch nicht so gut für dich. Du kannst es mir ruhig glauben!"
"Vielleichaste rech", lenke ich ein, "aber du mussou bedenkn, wie langch nimmer gerouchta." Und damit sie keine Zeit hat, etwas zu entgegnen, komme ich gleich mit dem nächsten Thema: "Dies Wochenend versuchi, Urlau zu kiegn. Wir wolln domasähn, wasda Fakis." So richtig kann ich zwar an eine Veränderung oder Rückführung von mir auch nicht mehr glauben, doch das ist meine allerletzte Hoffnung; und an die werde ich mich klammern, solange es geht.
"Lass dich doch erst einmal gesund pflegen, Mike!"
Doch ich bleibe störrisch, lasse mich da von niemandem beirren: "Kanni schaddn, versuchn werdchs auf allef."
Darüber scheint Pia nicht so begeistert zu sein. – Warum? Ich weiß es nicht. Bin mir aber sicher, dass ich es bald wissen werde.
*
Wieder zurück im Zimmer werde ich von einer Schwester übernommen, die sich als Regina vorstellt: Jung ist sie, sagt zumindest ihr Gesicht; aber das war es dann auch schon. Es gibt doch immer wieder Töchter, die älter sind als ihre Mütter. Und dazu noch – Attraktivität? Wo denn? Irgendwie fühle ich es, ihr fehlt es daran nicht nur außen. Nein, die von der Bettkante zu stoßen, damit hätte ich garantiert keine Probleme. Oder ich müsste so besoffen sein wie 3000 Russen auf einer Hochzeitsfete.
Als sie mich fertig gewaschen hat, fragt sie mich, was der Grund dafür ist, dass meine Mutter nicht erscheint.
"Das bruht wahrschein--lich offem Missverstehnes", erkläre ich ihr kurz angebunden, denn auch für mich ist es peinlich, so was herumerzählen zu müssen. "IndeITS, alsie mi besudde, hattesese was völlich andres verstaddn, alch gesat hab. Na ja, und so ka-kams dann ebn, dat mer in Steit geriddn."
"Wie kann man denn so was machen? Man kann doch seiner eigenen Mutter nicht Unrecht geben! Sie sind also selber daran schuld!"
Was soll ich dazu sagen? Unglaublich, aber wahr. Solche spinnenden Getiere gibt es also doch noch! – Ich bin baff.
"Du hattowasim Kobbe", brumme ich vor mich hin. Weiß nicht, ob sie es verstanden hat, doch wenn, soll es mir recht sein. Auf jeden Fall verschwindet sie daraufhin.
Ja, es hat sich bestätigt: Innen ist sie ebenfalls vermodert, sie ist noch dümmer als sie aussieht! Ich glaube, mit der werde ich wohl kein gutes Auskommen haben.
*
Nach dem Abendbrot, das wieder zum Abgewöhnen schmeckte, verspüre ich Druck im Mastdarm. Und da ich den noch nicht unter Kontrolle habe, klingle ich.
Regina lässt mich wieder ihren Anblick genießen. "Was ist los?", will sie wissen – kauend.
Jetzt vor ihre Nase scheißen, das wäre es doch.
"Ich mussma offe Tolette", erzähle ich ihr anstelle dem und richte mich auf.
"Das geht nicht. Nehmen Sie den Schieber unter Ihrem Bett."
Ich weiß aus Erfahrung von der ITS her, dass ich mit dem Schieber nicht zurechtkomme. Was ich ihr mitteile und hinzufüge: "... hol mir wenchstens diesn, dies--en – Wie hiesser doglei? Keene Ahnun, wi mir ni einfalln – Kackstull her. Oder is dat zuviel verlat?"
"Sie nehmen den Schieber da! Und wenn Sie fertig sind, klingeln Sie wieder! Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe zu Ende Abendbrot essen!"
Der Punkt ist erreicht, wo ich nicht mehr an mich halten kann: "Da geh ni!", brülle ich sie an. "Find das keen Einang in dein beklobbn Schädel??"
Doch sie lässt sich davon nicht beeindrucken, verschwindet einfach.
Sofort beginnt wieder meine Fantasie, mir die schrecklichsten und obszönsten Horrorbilder ins Bewusstsein zu weben: Wenn ich könnte, wie ich wöllte, würde ich sie mit dem Kopf voran in ein vollgefülltes Scheißrohr stopfen und sie dort eine Stunde lang gären lassen. Doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben.
Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich mit dem Schieber herumzuquälen. – Eh, man kann sich kaum bewegen, muss aber ein paar Aerobicübungen machen, um scheißen zu können! Eh, die ist doch vom Dampfer gefallen, durch die Schiffsschraube gedreht worden und läuft jetzt als lebendiges Beispiel herum, wie man eine Schiffsreise nicht vonstatten gehen lassen sollte!
Bald merke ich, dass darauf sitzen unmöglich ist, denn so eine tiefe Kuhle ist auch in diesem Bett nicht zu finden. – Die ganze Angelegenheit ist so wacklig, dass ich mich mehr auf das Sitzen bleiben als auf das Abseilen im Mastdarm konzentrieren muss. Es geht nicht!
Ich versuche es mit liegen. Biege mich dabei ins Hohlkreuz, nehme eine für diesen Vorgang ungewöhnliche Haltung ein. – Mein After würde mir einen Vogel zeigen, wenn er eine Stirn hätte. Oh yeah, wäre es nicht so peinlich, würde ich ins Bett scheißen! Aber die meine Musrinne auch noch auslöffeln lassen – brr, muss nicht sein. Da würden sich ja sogar die Hämorrhoiden verdrücken.
Nach einer Weile kann ich auf dem Schieber einigermaßen ruhig liegen. Dabei muss ich daran denken, wo ich eigentlich bin. Wie hygienisch. Ob sie es zu Hause auch ins Bett macht?
Schließlich breche ich ab: Umsonst abgemüht und doch erklärlich. Hoffentlich halte ich es bis morgen Vormittag aus.
*
Regina lässt sich wieder mal blicken und schaut unterm Bett nach, ob da Nachschlag auf sie wartet. Ich habe die Augen zu, schlafe jedoch nicht. Was sie aber nicht zu wissen braucht.
"Nichts drin! Da macht der erst solch einen Aufriss, stört einen dazu noch beim Abendbrot!"
Die müsste eine braune Wurst auf den Teller gelegt kriegen, und die sollte nicht gerade klein sein. Wenn die so gierig ist auf ihr Abendbrot, muss sie ja schließlich gesättigt werden.
*
Spät in der Nacht wache ich auf. Irgendetwas ist an meinem Hintern. Ich wackle mit ihm, schon ahnen könnend, was mich da erwarten wird: Hervorragend, hat ja mal wieder geklappt. Doch wo es diesmal herkommt ... Aber was nützt das? Peinlich ist es so oder so, ob ich es nun weiß oder nicht. Ich muss klingeln.
Eine Schwester, die ich noch nicht kenne, kommt angetippelt: "Was ist los?"
Ich flüstere zurück: "Man hat mi heut ni glassn und jetz ..." Ich zeige nach hinten.
Nachdem sie mich gerügt hat, säubert sie mich und bezieht mein Bett neu. Währenddem wacht mein Bettnachbar auf (der junge, der ältere ist am Freitag entlassen worden), sieht die Bescherung und dreht sich auf die andere Seite.
Das ist die Krönung der Peinlichkeit. Und leider kann ich nicht wieder morgen oder übermorgen verschwinden wie in der ITS, muss mit dem Einscheißerimage leben, muss den Spott der anderen ertragen.
Als sie wieder gegangen ist, werden meine Lider wieder ganz schwer: Zum Glück, empfinde ich noch, ansonsten hätte mich mein Gewissen endlos gequält.