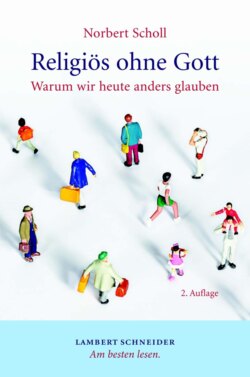Читать книгу Religiös ohne Gott - Norbert Scholl - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Abgehobene Sondersprache
ОглавлениеDie religiöse Sprache, wie sie im theologischen Schrifttum und in den Gottesdiensten der etablierten Kirchen zumeist verwendet wird, ist weitgehend zu einer Sondersprache geworden, die von den meisten als etwas Fremdes, wie einer anderen Welt Zugehöriges empfunden wird. Die meisten Texte kranken daran, dass sie ein veraltetes Weltbild widerspiegeln. Die Sprache wirkt weithin wie eine Sache von gestern, die mit der Welt von heute nicht mehr viel zu tun hat. „Welt“ und „Religion“ werden als zwei verschiedene, voneinander getrennte Bezirke mit unterschiedlichen Sprachsystemen wahrgenommen. Das Profane, das „Weltliche“ besitzt eine allen Menschen zugängliche, für alle erfahrbare Realität; das Sakral-Religiöse erscheint davon abgehoben, welt-entrückt. Damit aber wird es zu etwas Irrealem, Weltfernem, Weltfremdem. Das Profane ist angefüllt mit den höchst realen Lebenserfahrungen und Lebensbedingungen der Menschen; das Sakrale wirkt leer und unwirklich. Das Profane ist etwas, das man ernst zu nehmen hat, weil man täglich mit ihm zu tun bekommt, weil es einen überall angeht; das Sakrale braucht man nicht ernst zu nehmen, es geht niemanden wirklich an. Es ergreift niemanden, es erzeugt keine Ergriffenheit, es macht nicht betroffen.
Zwei Beispiele mögen das illustrieren.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat im Jahr 2008 eine „Orientierungshilfe“ in Sachen Taufe durch eine Kommission unter Leitung des Kirchenhistorikers und Präsidenten der Berliner Humboldt-Universität, Christoph Markschies, erarbeiten lassen. Darin heißt es über den durch die Taufe vermittelten Heiligen Geist: „Dieser Geist schenkt Kraft zu Glaube, Liebe und Hoffnung und konkretisiert sich in einer Vielzahl von Geistesgaben. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die dadurch verliehene Kraft und der dadurch geschenkte Trost sind keine magische Angelegenheit, vielmehr ist der Heilige Geist ‚der intimste Freund des gesunden Menschenverstandes‘ (Karl Barth). Er ist der Tröster, den Jesus den Seinen nach seiner Auferstehung sendet (vgl. Johannes 16,14). Menschen werden so durch die Taufe fähig, ihr eigenes Leben in der Gewissheit der Gegenwart Gottes und im Gehorsam gegenüber Gottes Wort verantwortlich zu gestalten und in den Dienst ihrer Nächsten zu stellen. Anders formuliert: Der Heilige Geist gibt den Getauften die Kraft, ein Leben als Zeugen Jesu Christi zu führen.“ Der Heilige Geist mache die Getauften, so weiß die Kommission außerdem, „lebenstüchtiger und gemeinschaftstauglicher, weil sie sich so weder über- noch unterschätzen.“3
Im Gotteslob, dem offiziellen Gebet- und Gesangbuch der katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum, ist folgendes Dankgebet für die Taufe abgedruckt:„Ich danke dir, Vater im Himmel, dass ich aus Wasser und Geist neu geboren wurde in der Taufe. Ich darf mich dein Kind nennen, denn du hast mich aus Schuld und Tod gerufen und mir Anteil an deinem Leben geschenkt. Ich danke dir, Jesus Christus, Sohn des Vaters, für deinen Tod und deine Auferstehung. Wie die Rebe mit dem Weinstock, so bin ich mit dir verbunden; ich bin Glied an deinem Leib, aufgenommen in das heilige Volk zum Lob der Herrlichkeit des Vaters. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass deine Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Du lebst in mir und willst mich führen zu einem Leben, das Gott bezeugt und den Brüdern dient. So kann ich einst mit allen Heiligen das Erbe empfangen, das denen bereitet ist, die Gott lieben.“4
Die Sachverhalte, die da verhandelt werden, sind den noch religiös sozialisierten Kirchenbesuchern bekannt. Sie brauchen vielfach nur die Anfangsstichworte zu hören, um Bescheid zu wissen. Es besteht für sie nach der ersten Andeutung kaum noch Ungewissheit, wie etwa die Rede weitergehen wird. Das meiste, was in kirchlicher Verkündigung zu hören ist, sind verbale Variationen, wenn nicht gar mehr oder minder wörtliche Wiederholungen altbekannter Themen und Lehrsätze. Das Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer wird kaum mehr geweckt. Erwartungshaltung und Neugier auf das Angebotene kommen kaum mehr zustande. Allenfalls die Art des Wie, die Weise der Vermittlung, das didaktische Geschick des Predigers oder des Religionslehrers, stößt noch auf Interesse.
Schon vor 40 Jahren hat ein Sprachforscher die für die religiöse Rede höchst beunruhigende Forderung aufgestellt: „Damit […] eine Kommunikationsverbindung zustande kommt, müssen Signale wenigstens einen gewissen Überraschungswert besitzen, sie müssen zu einem gewissen Teil unerwartet sein – andernfalls ist die Übertragung Zeitverschwendung.“5 Wie der Tod eines Witzes häufig darin besteht, dass die Pointe schon im Voraus gewusst wird, so zerfällt der Reiz jeder Nachricht mit dem Grad ihrer Bekanntheit. Das hat fatale Folgen. Denn Psychologen sagen: „Das Interesse am Neuen bezieht sich auf einen Reizbereich, der zwischen allzu homogenen und vertrauten Reizen einerseits und allzu fremdartigen (furchterregenden) andererseits liegt.“6 Religion, wie sie von den etablierten Kirchen angeboten und vorgestellt wird, erscheint demnach als uninteressant, wenig überraschend und kaum anreizend.
Ein treffendes Beispiel dafür bringt Martin Walser:
„Mit Lissa in der Kirche. Konnte nicht beten. Die feierliche Amtssprache der Kirche klang fremd. Kunstgewerbevokabular. Glauben die Frommen, Gott höre sie nur, wenn sie beten, er habe keine Ahnung von den Worten, die sie sonst denken und sagen? Man kann sich nicht vorstellen, dass der Pfarrer erlebt hat, was er in der Predigt erzählt. Mein Leben ist in der Gebetssprache nicht mehr unterzubringen. Ich kann mich nicht mehr so verrenken. Ich habe Gott mit diesen Formeln geerbt, aber jetzt verliere ich ihn durch diese Formeln. Man macht einen magischen Geheimrat aus ihm, dessen verschrobenen Sprachgebrauch man annimmt, weil Gott ja von gestern ist.“7
Eine weitere Schwierigkeit kommt hinzu, die jedem Sprachgeschehen anhaftet. Wenn ich einem Mitmenschen etwas sage, so kann es vorkommen, dass der etwas gänzlich anderes versteht, obwohl ich der Meinung bin, mich klar und unmissverständlich ausgedrückt zu haben.
Auch „Religion“ und „Welt“ leben in unterschiedlichen Sprachsystemen. Mit dem Wort „Liebe“ verbindet ein Erwachsener in der „Welt“ sicher andere Vorstellungen als ein religiös sozialisierter Kirchenbesucher. Und selbst der kann „neugeboren“ (s. o., Beispiel Taufgebet) heutzutage möglicherweise als Bestätigung seines Glaubens an die Reinkarnation ansehen, obwohl damit im Hinblick auf die christliche Taufe kirchenoffiziell etwas ganz anderes gemeint ist. Gleiche Wörter täuschen häufig auch gleiche Bedeutung vor. Tatsächlich aber weichen die Bedeutungen mehr oder minder wesentlich voneinander ab oder stehen einander geradezu diametral gegenüber. Wenn von „Buße“ gesprochen wird, so assoziieren viele damit „Bußgeld-Bescheid“, was so viel heißt wie: Man bezahlt die festgesetzte Summe, und damit ist der Fall erledigt; in der Sprache der (christlichen) Religion meint aber „Buße“ eine Umkehr, eine Bewusstseinsänderung, einen gänzlich neuen Anfang.
Die Sprachwissenschaft spricht hier von „De-notation“ und „Kon-notation“:
Bei der Denotation ist die Sachlage eindeutig und beide Sprachteilnehmer verstehen darunter dasselbe. Die Denotation von „Nacht“ ist die Zeitspanne zwischen Untergang und Aufgang der Sonne.
Im Gegensatz dazu meint Konnotation (das Mit-Bezeichnete) eine eher assoziative Nebenbedeutung eines Wortes. Konnotationen des Begriffs „Nacht“ sind je nach Kontext: Angst, Einsamkeit, Bedrohung, Schwärmerei, Liebe, Romantik etc. Die Konnotation kann allerdings in bestimmten Text- und Äußerungszusammenhängen die durchaus vorherrschende sein. Auch muss die konnotative Bedeutung eines Wortes keine bloß von einem individuellen Subjekt vorgenommene Bedeutungszuschreibung sein. Der Hörer versteht – häufig unterschwellig und emotional – etwas „mit“, was der Sprecher gar nicht meint, was aber im Hörenden bestimmte Gefühle, Sympathien oder Antipathien, aufkommen und ihn so dem Wort gegenüber voreingenommen werden lässt. Wer etwa unter der Obhut eines liebevollen, fürsorglichen Vaters aufgewachsen ist, wird beim „Vaterunser“ wahrscheinlich andere Konnotationen haben als jemand, dessen Vater sein Kind misshandelt hat. Die Konnotation kann auch mehr oder weniger stark konventionalisiert sein. Viel zitiert ist der Ausspruch von Gertrude Stein „Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose“, mit dem sie auf die verschiedenen Konnotationen des Begriffes anspielt. „Eigentlich“ ist die Rose nur eine Zierpflanze, aber mitschwingende Bedeutungen sind hier Liebe, Wohlgeruch, Vergänglichkeit und verschiedene politische Bedeutungen sowie Schmerz durch die „mitgedachten“ Stacheln.
Eine dritte Schwierigkeit kommt hinzu. Die tradierte religiöse Sprache zu ändern und heutigem Sprachgefühl anzupassen, ist nicht leicht. Denn der als verbindlich und authentisch von einer kirchlichen Obrigkeit festgelegte Wortlaut besitzt ein zähes Beharrungsvermögen. „Man weiß alles, und doch sagt es nichts […]. Man kann sich in dieses Vokabular wie in eine vergangene Weltanschauung einspinnen, dann bleibt man im Gedeuteten, begegnet aber nicht mehr oder nur sehr bedingt dem Anspruch der absoluten Wirklichkeit.“8 „Ewige Wahrheiten“, so meint man offenbar in den Amtsstuben der offiziellen Sprachregler in der Kirche, können nicht alle hundert Jahre ihr Gewand, in das sie gekleidet sind, verändern. Aber: „In geschlossenen Räumen weht kein Wind. Der Mensch aus Nazareth wies allen, die ihn hörten, den Gang aus den geschlossenen Räumen des ‚Gesetzes‘. Der Preis für den Gang ins Offene kann hoch sein. Aber es gibt die Wahrheit und die Huld des Geistes.“9 Häufig sind die Exponenten dieser Sprachsklerose subjektiv redlich meinende Menschen, aber sie sind inzwischen in ihrem Sprachsystem so fixiert, dass sie es nicht wagen, nach neuen sprachlichen Ausdrucksformen des Glaubens zu suchen – aus lauter Angst, es könnten ihnen dabei Wortschöpfungen oder Sprachregelungen unterlaufen, die zu Missverständnissen führen, oder sie könnten sich an den geheiligten altehrwürdigen Traditionen vergehen. Auch viele Gläubige, die sehr früh und nachhaltig religiös sozialisiert wurden, möchten das ihnen vertraute und wohlbekannte Vokabular nicht aufgeben, mit dem sie aufgewachsen sind, das ihnen vielleicht über lange Zeit hinweg große Glaubensschwierigkeiten bereitet hat, die sie nun überwunden (zu) haben (meinen).
So wird die religiöse Sondersprache gleichsam „von oben“ und „von unten“ gestützt und immunisiert. Das Sprachsystem der Religion hält sich, weil es „oben“ als sakrosankt und unveränderlich betrachtet und „unten“ frühzeitig eingeübt wird. Aber das ist auf Dauer nicht ungefährlich. „Anachronistische Orientierungsschemata blockieren den Kontakt mit der Wirklichkeit und machen unfähig, die gegenwärtige Situation – die allein real gegebene, zur Bewältigung aufgetragene – sachgemäß anzugehen.“10 Wer Klischees anbietet, offeriert alles und nichts. Er setzt sich nicht der Gefahr der Rückfrage aus, er erzeugt auch keine Unruhe. Denn niemand fühlt sich davon betroffen, weil er genau weiß, dass hier mit mehr oder weniger großem Wortaufwand im Grunde nichts gesagt wird. „Je allgemein gehaltener ein Aufruf ist, je entfernter von konkret bestimmter sozialer Situation, desto leerer wird seine Sprache.“11 Die Erfahrungsferne und Formelhaftigkeit der religiösen Sprache hat dazu geführt, dass religiöse Thematik im spezifischen Sinne fast nur noch in besonderen Zirkeln besprochen wird. Im Übrigen redet man von sich aus nicht davon, um nicht bei anderen peinliche Gefühle und Verlegenheit aufkommen zu lassen. Man bleibt „unter sich“.