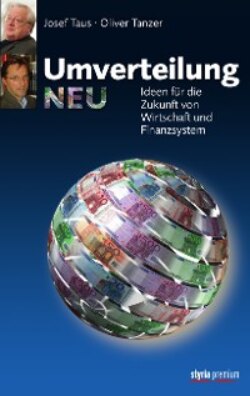Читать книгу Umverteilung neu - Oliver Tanzer - Страница 11
Platons Wächterstaat
ОглавлениеReich an Gütern starb im Jahre 348 v. Chr. der Philosoph Aristokles, aufgrund seiner Physiognomie auch „der Breitstirnige“ – Platon – genannt. Dieser Spross eines athenischen Aristokratengeschlechts steht an der Wiege des philosophischen Idealismus. Er war es, der in seinen maßgeblich von Pythagoras beeinflussten Werken Der Staat und Die Gesetze die Utopie eines Gemeinwesens und einer Ökonomie entwarf, die als erste philosophische Spielart des Kommunismus in die Geschichte einging.
Die attische Demokratie hielt Platon für minderwertig, was nicht heißen will, dass er einen Hang zur Diktatur gehabt hätte. Die bereits geschilderte Herrschaft des korrumpierten Pöbels dürfte einen großen Anteil daran gehabt haben, dass Platon sich nach anderen Staatsmodellen umsah. Unter den Zelebritäten eben jener Volksherrschaft in Athen war er jedenfalls nicht sehr beliebt. Aristipp, Molon und Xenophon schmähten den Mann in ihren Werken aufs Äußerste. Und auch unser Begleiter Diogenes macht sich einen Schalk daraus, Platons Vorlesungen zu stören. Als sich dieser bei seinen Studenten Applaus verschafft mit der Bemerkung, der Mensch sei ein federloses Wesen auf zwei Beinen, stürmt Diogenes Platons nächste Vorlesung mit einem gerupften Hahn und schreit: „Seht her, Platons Mensch!“14
Platon unterscheidet sich von seinen philosophischen Vorgängern zunächst dadurch, dass er ein begnadeter Schriftsteller ist. „Was er schrieb, war lieblich, wie der Zikaden Gezirp vom Hain des Hekademos“, schreibt sein Schüler Timon. Die Themen Religion, Moral, Logik, Philosophie, Staat und Recht behandelt Platon in Form von Dialogen, deren Hauptheld Platons Lehrmeister Sokrates ist.
Ob diese Gespräche Sokrates authentisch wiedergeben, darf bezweifelt werden. Der Meister selbst soll einmal gesagt haben: „Beim Herakles, wie viel hat der Junge bloß über mich zusammengelogen.“15 Doch das schmälert die platonische Kunst und den sokratischen Ruhm keineswegs. Denn wie kein anderer vermag Platon, dieses Gemisch aus Wahrheit und Erfundenem zu einem Gedankengebäude zu fügen, bis es solide wie aus Stein gemeißelt vor uns steht. Platon wird so Sokrates – und Sokrates Platon –, eine seit zwei Jahrtausenden erfolgreiche Legierung.
Der Philosoph landet in seinem beständigen Suchen immer wieder bei der Frage nach dem Sein an sich – und bei der pythagoräischen Transzendenz der Dinge. Wenn beispielsweise ein Mensch ein in den Sand gezeichnetes Quadrat betrachtet, sieht er eine geometrische Figur, deren Geraden in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Die Zeichnung selbst kann vom Wind leicht verweht werden. Das Quadrat als mathematisches Verhältnis aber ist unveränderlich und ewig. Die Realität kann demnach immer nur ein vergängliches Abbild einer Idee sein. Platons Schlussfolgerung: Wenn es eine reale Polis gibt, dann gibt es auch ein ewig gültiges Urbild dazu, das Ideal des perfekten, gerechten Staates.
Was aber zeichnet diesen besten aller Stadtstaaten aus? Ein Staat, meint Platon, ist ein Zusammenschluss von Menschen zu ihrem eigenen Vorteil. Ein jeder habe in diesem Gemeinwesen seine bestimmte Funktion. Der Baumeister kümmert sich um die Errichtung der Häuser, der Schuster um die Schuhe, der Bauer um die Produktion der Nahrungsmittel und so fort. Die Spezialisierung führt zu besserer Qualität und zu höherem Ertrag.
Weil nun ein jeder ein wertvoller Teil des Systems sei, gebiete es die Gerechtigkeit, dass niemand sich auf Kosten des anderen bereichere. Die Folgen: Keiner der Bürger darf mehr als das Vierfache eines anderen besitzen, Zinsnahme ist streng verboten: „Reichtum verdirbt die Seele des Menschen durch Genusssucht, die Armut wird durch ihren Jammer in das Gebaren selbst hineingetrieben.“16 Beides ist Platon zutiefst zuwider: Er will das Eindringen von Reichtum und Armut in die Polis „auf jede Weise verhüten“: „Denn jene erzeugt Üppigkeit, Faulheit und Neuerungssucht, diese außer Neuerungssucht auch niedrige Sinnesart und minderwertige Arbeitsleistung.“17
Die durch möglichen Güteraustausch und fremde Kaufleute hereingetragene „Reichtums-Versuchung“ wäre also eine viel zu große Gefahr für die Moral der Bewohner. Also wird für die ideale Polis auch ein Ort ohne Meereszugang gewählt, um den Seehandel fernzuhalten: „Denn indes die Meeresnähe dem Großhandel wie dem Kleinhandel Tür und Tor öffnet, erzeugt sie in den Seelen ein wetterwendisches und untreues Wesen und lässt in der Bürgerschaft den Geist der Treue und der Freundschaft gegen sich und die übrigen Menschen schwinden.“18
Ebenso gefährlich wie der Handel ist das Wachstum der Bevölkerung. Denn Wachstum bedeutet auch Drang nach einem größeren Territorium, das Nachbarn oder Feinden mit Gewalt abgerungen werden muss: „So haben wir also die Entstehung des Krieges gefunden“19, sagt Sokrates nachdenklich. Die Gewalttätigkeit des Wachstums erfordert also eine Kriegerkaste: die Wächter.
Dem pythagoräischen Vorbild folgend ist diese Elite eine Art strenge Ordensgemeinschaft. Wächter haben keinerlei Einkünfte, Eigentum ist ihnen verboten: „Was aber Gold und Silber anlangt, so muss man ihnen sagen, dass sie es von den Göttern als göttliches Gold in ihrer Seele haben und keines menschlichen außerdem bedürfen.“ Wächter unterhalten weder Ehe noch Familie und leben in gemeinsamen Unterkünften. Zudem gibt es eine „Weiber- und Kindergemeinschaft“, auf dass „Freunden alles gemein sein werde“. Dieses Bild entwirft Platon nicht aus „Lustgreiserei“, sondern zu Elitezuchtzwecken – es ist Rassenhygiene, die er anpreist.
In Platons Staat rekrutieren sich aus den Reihen der Wächter auch die Lenker des Staates. Gut ausgebildete, dem Gemeinwesen verpflichtete Philosophen sollten es sein. Auch sie bleiben ohne Eigentum, „denn sonst gibt es keine Erholung von dem Übel für die Staaten und auch nicht für das menschliche Geschlecht“20. Wieder zeigt sich Platons Ziel, jedes Erwerbsstreben von politischen Ämtern fernzuhalten. Doch auch die Vermögen der einfachen Bürger unterliegen im „Staat“ behördlicher Kontrolle und müssen ab einer bestimmten Höhe umverteilt werden. Auf geheimes Horten von Gütern steht strenge Strafe.
Diese Eigentumskontrolle und Beschränkung entspringt nicht irgendeiner Willkür des Philosophen. Sie beruht auf tief greifenden Überlegungen zur Freiheit menschlichen Handelns: Eine Gesellschaft, die den Egoismus über alles andere stelle, bringe das Gemeinwesen zu Fall und ende zwangsweise in der Diktatur: „Es schwindet jede Achtung vor den Gesetzen, gleich ob geschrieben oder ungeschrieben, um ja keinen Gebieter, welcher es auch sei, über sich zu haben.“ Wo keine Gesetze gelten, gilt bald das Recht des Stärkeren: „Das also ist der schöne und herrliche Anfang, aus dem die Tyrannis herauswächst, wie ich glaube.“21