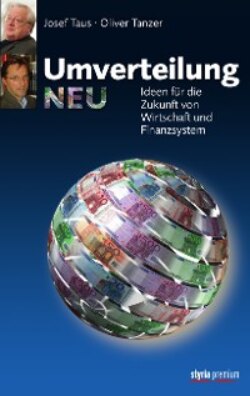Читать книгу Umverteilung neu - Oliver Tanzer - Страница 16
Die Religion der Armen
ОглавлениеSchließlich aber macht sich eine neue Religion auf, das Römische Reich von der verarmten Plebs her zu erobern. Ihr Gründer ist genauso arm wie die große Mehrheit der Bewohner des Reiches: der Zimmermann Jesus von Nazareth. Dieser Jesus und seine Jünger reden nicht vom gottgewollten Reichtum weniger, sondern von der Schönheit freiwilliger Armut und der Macht der Solidarität aller. Der Arme hat auf einmal mehr Anspruch auf die Liebe Gottes als der Reiche. So revolutionär das klingt, so wenig revolutionär wird es gelebt. Denn das Christentum erweist sich bald als Anker der Stabilität des Imperiums, indem es die Staatsraison inhaliert und den Kaiser unter Gottes Schirm stellt.
Der Apostel Paulus gießt die christlichen Werte in das Gefäß stoischer Weltsicht und passt auf diese Weise die junge christliche Religion den Bedürfnissen des römischen Staates an: Während Christus dem Staat betont gleichgültig gegenübersteht („Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, Joh 18,36; „Gebt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist“, Mt 22,21), wandeln Petrus und Paulus die Lehre ab. Paulus vollzieht den Brückenschlag zwischen Kaiser und Gott: „Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Nicht ist nämlich eine Gewalt außer Gott. Die bestehenden Gewalten sind von Gott gesetzt, sodass sich der der Obrigkeit Widersetzende der Anordnung Gottes entgegenstellt.“42 Das Imperium wird damit als Standbein des christlichen Gottes auf Erden interpretiert, der Kaiser zu seinem weltlichen Statthalter.
Schwieriger gestaltet sich freilich der Umgang der neuen Religion mit dem Eigentum. Viele christliche Gemeinden hatten sich Jesu Lehre gemäß ein urkommunistisches Gesellschaftsmodell der Eigentumslosigkeit verordnet. Cyprian von Karthago (200 – 258) schreibt über Roms Gemeinde: „Es herrschte unter ihnen kein Unterschied und sie behielten keines ihrer Dinge für ihr Eigentum, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das heißt, nach dem himmlischen Gesetze die Gleichheit Gottes des Vaters nachahmen. Denn alles aus Gott ist in unserer Benützung gemeinschaftlich und keiner ist von seinen Wohltaten und Gnaden ausgeschlossen, sodass das gesamte Menschengeschlecht in gleicher Weise genießen darf. So leuchtet allen in gleicher Weise der Tag, strahlt die Sonne, feuchtet der Regen.“43
Nicht für alle Gläubigen war diese Sicht der Dinge verständlich, und bald stellte sich die Frage, ob nicht das Eigentum mit gewissen Einschränkungen als von Gott gewollt betrachtet werden könnte. Lucius Caecilius Firmianus, genannt Lactantius (250 – 320) tritt als erster prominenter christlicher Schriftsteller zur Rechtfertigung an. In seinen Divinae institutiones, den „Göttlichen Unterweisungen“, lehnt er sich an Cicero an, indem er feststellt, das Privateigentum habe bereits seit Urzeiten bestanden und die Nächstenliebe könne nun auch die Gefahr überwinden, die sich aus dem Privateigentum ergebe. Kollektivismus, so Lactantius, sei nur für Menschen möglich, die das Geld verachten. Sonst aber beraube er die Fleißigen, und begünstige jene, die aus ihrer Schuld heraus wenig besitzen. Der Zwang zum Gemeineigentum sei ein Freibrief für die Laster, während das Privateigentum „auch Tugenden den Weg bereiten könne“.
Die Phase der Angleichung an den Staat während des Aufstiegs des Christentums zur Staatsreligion erreicht mit dem Mailänder Toleranzedikt 313 einen vorläufigen Höhepunkt. Doch dann kommt es zu Rückschlägen. Das Christentum verliert an Glaubwürdigkeit, vor allem als 410 das für unmöglich Gehaltene geschieht: Die Hauptstadt des Erdkreises wird von den Westgoten Alarichs erstürmt und geplündert. Die von der Kirche gepredigten angeblichen irdischen Interessen Gottes erweisen sich nun als Bumerang. Denn, so fragen die Bürger, wenn Gott Roms Schicksal leitet, warum will er es dann vernichten? Haben nicht die alten Götter das Imperium mehr als 700 Jahre viel besser beschützt als der Christengott?
Dazu kommt noch, dass die Eroberer Roms selbst Christen sind. Schnell sind Volksredner mit dem Vorwurf bei der Hand, man habe sich da wohl eine christliche Laus im Pelz gezüchtet und die Schutzgötter hätten ihre Hand von der Stadt abgezogen. In Scharen laufen die zweifelnden Christen nun wieder zu ihren alten Kulten zurück. Es ist Augustinus von Hippo (354 – 430), ein zum Christentum bekehrter Manichäer, fanatisch, von existenziellen Zweifeln zerfressen, besessen von einem heiligen Genie, der versucht, das Christentum gegenüber dem Staat neu zu positionieren. So nennt er auch sein Hauptwerk De civitate Dei, Vom Gottesstaat. Mit der Kraft göttlicher Polemik liest er den Römern die Leviten: Ungerechtigkeit habe das Imperium geschaffen, Ruhmsucht, Herrschsucht und Verbrechen hätten es erweitert. Daran schließt sich Augustinus’ gnadenloses Fazit: „Was sind überhaupt Reiche nach der Beseitigung der Gerechtigkeit anderes als große Räuberbanden? Wenn eine solche Gemeinschaft verworfener Menschen so ins Große wächst, kann sie mit Fug und Recht den Namen ,Reich‘ annehmen, den ihr die Bevölkerung beilegt, nicht als wäre die Habgier erloschen, sondern weil Straflosigkeit dafür eingetreten ist.“44
Selbst Heiden könnten Gottes Wort besser verstehen, sagt Augustinus. Was der Mensch Willensfreiheit nenne, sei bloß eine Auswahl unter den Möglichkeiten des Bösen. Er sei unfähig, Gott zu gehorchen. Nur einen Ausweg gebe es: die Liebe zu Gott, welche Gerechtigkeit und Nächstenliebe schaffe. Die heilige Aufgabe des Staates, so schließt Augustinus, ist nicht die Ausweitung seines Territoriums, sondern die innere Friedensordnung.
Hin- und hergerissen zwischen Paulus und Augustinus, zwischen geschickter Komplizenschaft mit Adel und Weltlichkeit und den radikalen Idealen des Christentums, mäandert die Staatsreligion durch die Völkerwanderungszeit ins Mittelalter. Entlang diesen gegenläufigen Strömungen entbrennt ab dem 13. Jahrhundert die Diskussion um die richtige Art, zu wirtschaften, und die gerechte Schöpfung von Gewinn. Da versucht einer der wichtigsten Köpfe der Kirchengeschichte, die Systeme durch reine Logik miteinander zu verzahnen, und schafft eine Theorie der gerechten Wirtschaft, die bis heute kaum an Aktualität verloren hat: Thomas von Aquin, in dessen Zeit wir nun eintauchen wollen.