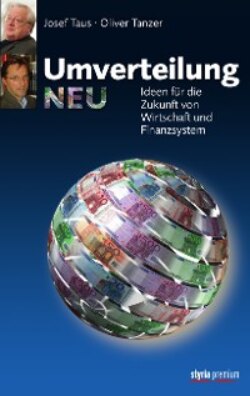Читать книгу Umverteilung neu - Oliver Tanzer - Страница 22
Die Suche nach der goldenen Mitte
ОглавлениеDas thomistische Denken zu Staat und Wirtschaft entwickelt sich nicht nur aus der aristotelischen Lehre, es basiert maßgeblich auf den Ansätzen zweier christlicher Denker, die Thomas vorausgehen: Otto von Freising (gest. 1158), Onkel des Kaisers Friedrich Barbarossa, und Johannes von Salisbury (1122 – 1180), Bischof von Chartres.
Otto von Freising denkt sich den vom Christentum geprägten Staat als die Überwindung des Fluchs, den menschliche Zivilisationen von Babylon bis Rom auf sich geladen haben. Besonders Babylon zieht dabei die Fantasien Ottos auf sich. Er glaubt gemäß einer ins Negative abgewandelten Entelechie-Lehre (das natürliche Streben nach einem höheren Zustand) des Aristoteles, dass jede Zivilisation bereits den Keim des Untergangs in sich trage. „Sehet Babylons Ruinen“, schreibt Otto. „Hyänen heulen in seinen Palästen.“ […] „Sehet Alexanders Reich, sehet Ägypten, sehet Rom“, ruft er. „Der Krieg ist allgegenwärtig. Der Krieg ist auch Roms Untergang.“ Nun aber – das ist Ottos Grundthese – wachsen der Gottesstaat von Augustinus und der Menschenstaat ineinander. Die Kirche, so Otto, vermag die Geschichte mit der Heilsgeschichte zu verbinden. Johannes von Salisbury ist es, der diesen Ansatz weiterentwickelt – auch er in aristotelischem Sinne. Er gilt mit seinem Werk Polycraticus als der Schöpfer der politischen Theorie. Hier einer seiner Kernsätze: „Das Gemeinwesen ist ein Körper, der sich nach dem Geheiß der höchsten Billigkeit bewegt und den die Vernunft wie ein Steuer lenkt.“50
Johannes betätigt sich aber auch als revolutionärer Chirurg dieses Staates: Wer nicht funktioniert, muss weg. Schlechte Herrscher, Tyrannen dürfen und sollen im Sinne des Ganzen beseitigt werden – auf welche Weise auch immer. Diese Auffassung wird übrigens prägend für die Scholastik und ihre Einstellung gegenüber dem weltlichen Herrscher sein, auch für Thomas von Aquin, zu dessen Lehre wir nun endlich vorstoßen.
Wie schon seine Vorgänger meint Thomas, dass allein die Vernunft die Welt gut gestalten kann. Der Mensch gründe Gemeinschaften „aus eigener Schwäche“. Es ist ein utilitaristisches Motiv, das ihn treibt. Er ist ein „Mängelwesen“. Nur der Zusammenschluss in der Gemeinschaft garantiert die Befriedigung seiner Lebensbedürfnisse. Dem entsprechend sind die Funktionen des Staates geordnet: Er dient der Aufrechterhaltung der Ordnung, der Abwehr von Feinden, dem Unterricht und der öffentlichen Gesundheit.51 Der Staat ist dabei nicht Selbstzweck, sondern nur das Medium zum Erreichen der göttlichen Ordnung. Erfüllt er diese Funktion nicht, ist es auch mit der Gehorsamspflicht der Bürger vorbei. Thomas: „Zum Gehorsam sind die Untertanen nur so weit verpflichtet, als es die Gerechtigkeit erfordert.“
Aber was bedeutet das nun für den Einzelnen? Thomas legt zunächst unveräußerliche Rechte fest: auf Nahrung, auf Almosen, auf „Notwehr gegen Feinde“ und nicht zuletzt das Recht auf Eigentum. Obwohl die Güter dem Menschen von Gott nur zum Gebrauch gegeben werden, so Thomas, ist Privateigentum nicht eine Folge des Sündenfalls. Nicht allen Menschen sei alles gemeinsam. Gemeinschaft bedeute auch das Recht auf Absonderung.52 Thomas schlägt sich in dieser Streitfrage klar auf die Seite des Aristoteles. Eigentum ist demnach der „Antrieb zur Arbeit“: „Es ist dem Menschen erlaubt, Eigentum zu besitzen. Und es ist auch notwendig um dreierlei Willen: Zuerst einmal, weil jeglicher mehr besorgt ist, sich etwas zu beschaffen, was ihm alleine zukommt, als etwas, das ein Gemeinsames aller und vieler ist. Denn ein jeder überlässt aus Flucht vor der Mühe dem anderen das, was in den Bereich des Gemeinsamen fällt. In anderer Weise, weil die menschlichen Dinge geordneter behandelt werden, wenn den Einzelnen die Sorge obliegt, ein Ding zu beschaffen. Es gäbe ein Durcheinander, wenn jeder Beliebige wahllos jedes Beliebige besorgen wollte. Drittens, weil in höherem Grade ein friedvoller Zustand unter den Menschen erhalten wird. Wir sehen, dass unter denjenigen, welche insgemein und ungeteilt etwas besitzen, allzu häufig Zänkereien entstehen.“53
Das bedeutet nun nicht, dass Thomas der Raffsucht das Wort redet. Im Gegenteil. In Notzeiten, so folgert Thomas, sei die Aufhebung des Eigentums bei lebensnotwendigen Dingen erforderlich, wenn es etwa um die Versorgung von Hungernden geht: „Was dem menschlichen Recht ist, vermag dem natürlichen Recht keinen Abbruch zu tun. Sohin wird durch die Verteilung der Dinge und ihre Zueignung, die vom menschlichen Recht ausgeht, nicht gehindert, dass einem Notstand beim Menschen aus solchen Dingen Hilfe zu bringen ist. Darum werden die Dinge, die Etwelche im Überfluss haben, aus dem natürlichen Rechte dem Unterhalt der Armen geschuldet.“54 Noch radikaler ist der Beitrag des Aquinaten zur Umverteilungsdebatte. Die Not rechtfertigt nach seinem Dafürhalten auch den Diebstahl: Die verteilende Gerechtigkeit sei auch durch „geheimes Wegnehmen“ erreichbar.55
So verstanden ist Thomas’ Lehre von der Wirtschaft, dem sozialen Handeln und der Lebenskunst ein Balanceakt zwischen Marktwirtschaft und Notgemeinschaft. Joseph Schumpeter erkennt den Lehren der Scholastiker generell die Autorschaft für die Welfare Economics zu.
Dieser Sinn für die Allgemeinheit zeigt sich auch in Thomas’ Sicht der Güterpreise. Er analysiert die Gegebenheiten und versucht, sie zu ordnen. Was also sieht er: Die ökonomischen Krisen des Mittelalters waren großteils durch Missernten ausgelöst worden und bedeuteten Hunger, Krankheit und Tod. Vor diesem Hintergrund waren natürliche Marktreaktionen auf Mängel, nämlich Preissteigerungen in gewissen Sektoren, etwa beim Getreide, in Europa damals ebenso verhasst, wie sie es heute in der Dritten Welt sind. Thomas versucht nun, die natürliche Gerechtigkeit über die Ausschaltung von Inflation zu erreichen. Sein Ziel, der justum pretium, der „gerechte Preis“, ist ein stabiler Marktpreis – stabil, aber nicht starr: „Er ist nicht punkthaft abgesteckt, sondern besteht mehr in einer gewissen Veranschlagung, sodass eine mäßige Zugabe oder Minderung die Gerechtigkeitsgleiche nicht aufzuheben scheint.“56
Dieses Ermessen sollte sich also nach den Bedürfnissen der Handelspartner und nach Maßgabe der Goldenen Regel aus dem Evangelium des Matthäus richten: Tue niemand anderem an, was du dir selbst nicht zumuten würdest. Ein Beispiel: „Nimm an, wann einer sehr bedürftig ist, irgendein Ding zu bekommen, und der andere den Schaden hat, wenn er ohne es dasteht. In solch einem Falle wird der gerechte Preis so liegen, dass nicht bloß Rücksicht genommen wird auf das Ding, welches verkauft wird, sondern auf den Schaden, den der Verkäufer aus dem Verkauf sich zuzieht. Dergestalt kann etwas erlaubterweise zu mehr verkauft werden, als es an sich wert ist, allerdings nicht zu mehr, als es Wert hat für den, der es besitzt.“57
Auf diese Weise also versucht Thomas die mittelalterliche Realität mit einzubeziehen, auch den Gewinn, den er als tolerierbar erachtet, solange damit ein sittliches Ziel verfolgt werde, etwa die Unterstützung von Bedürftigen und die Erhaltung der eigenen Familie, des eigenen Hauses oder einer Funktion für die Allgemeinheit. Der Versuch, die Reichtümer unbegrenzt zu vermehren, sodass es „ins Unendliche führt und kein Ende kennt“, so Thomas, führe allerdings in die falsche Richtung. Wirtschaftliche Aktivität müsse geordnet und gemäßigt werden.58
Wer über Preise nachdenkt, landet wie von selbst bei Geld und Zins. Beide stören nach Thomas den gerechten Preis. Geld tut das, wenn es vom Tauschmedium zur Ware wird und „sich selbst zeugt“ – durch den Zins.