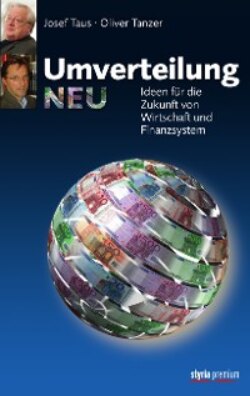Читать книгу Umverteilung neu - Oliver Tanzer - Страница 18
Bettler, Banchieri und Magnaten
ОглавлениеDas 13. Jahrhundert ist eine äußerst produktive historische Schnittstelle, die zumindest ökonomisch vieles Neuzeitliche vorwegnimmt. Je weiter die Forschung in diese Zeit einzudringen vermag, desto mehr erscheint das Denken in jener Zeit in einem ungewohnt modernen Licht.
Das Ende der Völkerwanderung bringt eine bis dahin nicht gekannte Prosperität. Um 1270 erreicht Europa mit 73 Millionen Menschen die höchste Bevölkerungszahl des Mittelalters. Die Städte und Stadtstaaten begründen im 12. und 13. Jahrhundert ihre Macht: In Italien sind dies Venedig, Genua, Florenz, Padua, Mantua und Ferrara. In Mitteleuropa und im Norden vor allem die Städte der Hanse, London, Lissabon und die Niederlassungen an den großen Flüssen: Köln, Kiew, Wien, Belgrad. Köln verzeichnet zu dieser Zeit immerhin 40.000 Einwohner, Paris 80.000, Mailand und Florenz sogar 180.000. Aber wie eine so enorme Zahl von Menschen ernähren, auf Basis primitiver Dreifelderwirtschaft und Bauern, die zumeist noch nicht einmal den Pflug einsetzen? Durch Handel, lautet die Antwort.
Der Warenverkehr kommt zu neuer Blüte, vermag Güter über weite Strecken anzuliefern und Versorgungslücken schnell zu schließen. Aber noch viel mehr befestigt er die steigende Macht der Städte gegenüber den Fürsten. Schon 1215 erhalten die englischen Städte mehr Rechte gegenüber dem Adel: Die „Magna Charta Liberatum“ markiert den Beginn eines langsamen, aber nicht mehr aufzuhaltenden Aufstiegs des Bürgertums.
Die Ideale des Feudalwesens, der ritterlichen Haltung und des Standes, ausgeschmückt mit fantastischen Legenden und brennender Leidenschaft, mit Heldentum und prächtigem Popanz, von welcher der Historiker Johan Huizinga in seinem Buch Herbst des Mittelalters erzählt, erleben ihren Höhepunkt und den Übergang zu ihrem schleichenden Ende. Reichtum ist zumindest in den großen Städten nicht mehr nur eine Frage vererbter Rechte, sondern entsteht auch durch Arbeit und den Austausch von Ideen, Geld und Gütern.
Vom frühen 12. bis ins 15. Jahrhundert erlebt Europa so einen deutlichen Handelsaufschwung. Die ersten echten Handelsverträge werden unter den Bezeichnungen „Societàs“ oder „Compagnia“ aufgesetzt, und ab dem 14. Jahrhundert halten Versicherungen auf Schiff und Ware Einzug ins Handelsleben. Hand in Hand mit den verfeinerten Rechtstechniken kommt es auch zur Verwendung von Geldwechseln und Geldanweisungen, die einen relativ sicheren Bargeldverkehr zwischen weit voneinander entfernten Destinationen ermöglichen. Eines der treffendsten Beispiele dafür ist ein Wechsel aus dem Jahr 1399 über 472 Pfund, die ein Tuchhändler in Brügge bei einem Brügger Bankier für Waren behebt, die er soeben an einen anderen Händler nach Katalonien geschickt hat. Dieser katalonische Händler wird nach Vorlage des Wechsels den gleichen Betrag mit Zinsen in anderer Währung an einen Partner des Brügger Bankiers in Barcelona bezahlen.
Doch vor allem ist es die Erfindung von Basiswerkzeugen, die den Handel revolutioniert, etwa der doppelten Buchhaltung. Damals heißt es freilich noch nicht Soll und Haben, sondern sinnfälliger compto vostro, compto nostro.