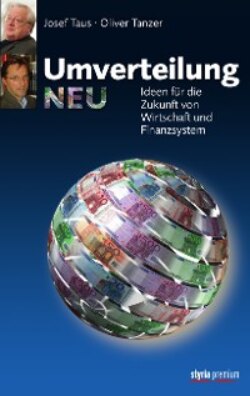Читать книгу Umverteilung neu - Oliver Tanzer - Страница 12
Aristoteles: Harmonie gegen Untergang
ОглавлениеWir wollen uns an dieser Stelle noch einmal das Bild der griechischen Gesellschaft in Erinnerung rufen. Dieses Gewimmel von hochintelligenten, künstlerisch über die Maßen begabten, streit-, spiel- und kriegslustigen Menschen, die zur Zeit der dionysischen Mysterienspiele auch in kollektive Raserei verfallen konnten; deren wichtigstes bürgerliches Kleinod die Redekunst und das Theater waren (und die für den Theaterbesuch auch noch vom Staat bezahlt wurden); Menschen, welche die Arbeit tendenziell als Strafe der Götter ansahen, und deren Götter ja auch nur dann selbst an die Werkbank traten, wenn es darum ging, einem Kollegen unter den Olympischen eins auszuwischen.
Ein solcher Staat konnte zumindest für seine Elite nur auf Basis der Ausbeutung anderer funktionieren. Im Falle Athens und Spartas waren das Sklaven. Menschlichkeit wurde den Unterdrückten nur zum Teil zugestanden: Man nannte sie je nachdem „männlicher“ oder „weiblicher Körper“ – oder schlicht „Menschenfüße“. Arbeit und Wirtschaft blieben großteils auf den Landbesitzer, den Sklaven und den Nichtbürger, den Metöken, beschränkt.
Diese überall mitschwingende Verachtung jeder Erwerbstätigkeit mag mit ein Grund sein, weshalb nur wenige der griechischen Philosophen wirtschaftliche Überlegungen hinterlassen haben. Man braucht schon einen Gelehrten, der sich über wirklich alles Gedanken macht, um Ausführliches zum Thema zu finden. Einen solchen universellen Geist finden wir in Aristoteles.
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) stammt aus Stagira, zwischen Thrakien und Makedonien gelegen. Sein Vater war der Hofarzt des Königs Nikomachos von Makedonien. Im Alter von 18 Jahren tritt Aristoteles in die Akademie Platons ein und bleibt dort zwanzig Jahre. Das ist insoferne erstaunlich, als die beiden Charaktere und ihr Denken nicht unähnlicher hätten sein können.
Aristoteles stülpt der Welt kein Ideal über. Er studiert sie zunächst im Kleinen, beobachtet akribisch den Kreislauf von Werden und Vergehen, die Mechanik der Kräfte, und erst aus diesen tausenden Observationen leitet er das Wirken eines Prinzips ab: das des „ersten Bewegers“. Die Ordnung der Natur winde sich gleichsam eine Treppe der Entwicklung hinauf, von den Pflanzen, die noch in der Erde wurzeln, über die Tiere, die der festen Verbindung zum Boden nicht mehr bedürfen, hin zum Menschen und danach zu Geist und Seele. Es ist eine Ordnung in Richtung Vollkommenheit, die ein jeder – bewusst oder unbewusst – beschreitet.
Ganz ähnlich sind auch seine Betrachtungen zur Politik aufgebaut. Unten, am Fundament der menschlichen Gesellschaft steht nicht irgendein hehres Ziel, ein Ideal, dem alle folgen, sondern schlicht der Eigennutz: Die Bedürfnisse verbinden die Menschen miteinander, wäre dies nicht der Fall, „so würde überhaupt kein Verkehr unter den Menschen statthaben. So aber sind sie aufeinander angewiesen“.22
Seine ökonomischen Überlegungen beginnt Aristoteles bei der kleinsten Wirtschaftseinheit: dem Oikos – dem Haus und seinen Gesetzmäßigkeiten und Bedürfnissen. Er beschreibt die Arbeitsteilung zwischen Hausherrn, Familienmitgliedern, Sklaven und Haustieren. Es bedarf noch keines Tausches von Gütern. Der Oikos genügt sich selbst. In seiner Urform ist der Haushalt auf den Erwerb von Nahrungsmitteln ausgerichtet. Viehzucht, Jagd und Ackerbau sind nach Aristoteles die klassischen Instrumente der Nahrungsgewinnung – aber auch die Räuberei.
Die nächsthöhere ökonomische Stufe ist der Tausch von Waren. Der Tausch dient dem Erwerb von Wertgegenständen. Die Bedürfnisse führen die Menschen dazu zusammen. Der Wert der getauschten Gegenstände ist nicht absolut, sondern wird vom Menschen subjektiv verliehen. Aristoteles nennt dabei zunächst den Nutzen, der dem Gegenstand beigegeben wird, und schließlich auch die Arbeit: „Gut ist, wofür viel gearbeitet und aufgewendet wird; denn schon deswegen erscheint etwas gut und wird als ein Ziel betrachtet.“23
Er hat damit einen Mechanismus erkannt, den man später als „Mehrwert“ bezeichnet hat: die Veredelung, welche ein Gegenstand durch Arbeit erfährt. Aber Aristoteles geht weit darüber hinaus: Er erfasst den Mechanismus von Angebot und Nachfrage und eine primitive Form des Gleichgewichtspreises, mit dem er später die Ideen von Thomas von Aquin bis Adam Smith beeinflussen sollte. Kurz fasst er es so: „Es ist der Bedarf, der alles zusammenhält“, und „alles muss geschätzt werden“. Der Schuhmacher, der für Schuhe Getreide eintauschen will, vergleicht vor dem Tausch den Wert seiner Ware mit dem Angebotenen, und nur wenn er eine Gleichheit feststellt, kommt es zum Tausch, vorausgesetzt, dass auch die Gegenseite so urteilt. Aristoteles nennt dies „Angemessenheit“, bei der sich „das Ganze zum Ganzen wie das Glied zum Glied verhält“.24
Auf dieser Basis errichtet Aristoteles nun sein System der Verteilung der Güter und des Reichtums. Zunächst warnt er davor, dass der Tausch um des Tausches willen als „künstliche“ Form des Erwerbs „kein Ende und keine Schranken mehr kennt“.25 Das gilt vor allem für das Medium, das den Handel um des Handels willen erst ermöglicht: Geld. Für Aristoteles ist es zunächst ein Wertmaß, eine gesellschaftliche Übereinkunft. Zum Zwecke des Tausches verwendet, ist Geld durchaus von Nutzen. Es besticht vor allem in seiner Eigenschaft, den Wert nicht nur zu symbolisieren, sondern auch zu halten. Der Geldwert konserviert also den Gegenwert eines Tauschgeschäfts und kann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt die Tauschkette fortsetzen.26 Er ermöglicht demnach „den Vergleich zwischen gegenwärtigen und künftigen Leistungen“.27
Dagegen hätte Aristoteles nichts einzuwenden, gäbe es da nicht den Zins. – Wir erinnern uns an die Schuldsteinpyramiden auf den Feldern Athens und die tausenden wegen Kreditschuld in Knechtschaft geratenen Bürger. Aristoteles wettert: „Es ist ein Missbrauch des Geldes, es nicht als Hilfsmittel des gesellschaftlichen Verkehrs, sondern zum Selbstzweck zu verwenden und so zum Vater anderen Geldes zu machen.“28
Für Aristoteles ist das „Chrematistik“, die „widernatürliche Erwerbskunst“. „Denn das Geld ist um des Tausches willen erfunden worden, durch den Zins vermehrt es sich aber durch sich selbst. Das Geborene ist gleicher Art wie das Gebärende und durch den Zins entsteht Geld aus Geld. Diese Art des Gelderwerbs ist also am meisten gegen die Natur.“29 Zur Erläuterung der Folgen der Geldgier führt Aristoteles seinen Schülern das sagenhafte Schicksal des König Midas vor Augen, der sich wünschte, alles von ihm Berührte in Gold zu verwandeln, und dabei übersah, dass er ja auch sein Essen berühren musste, und so vor goldenen Schüsseln verhungerte.
Die für Aristoteles ungewöhnliche Schärfe der Kritik entspringt vermutlich seiner Überzeugung, dass es vor allem die Chrematistik sei, welche die von ihm geforderte Gerechtigkeit im Staate gefährde. Solchen Missbrauch, „Wucher“, sagt Aristoteles dazu, müsse der Staat bestrafen. Um allen moralischen Defekten vorzubeugen, sollten wichtige Berufsgruppen wie Soldaten und Ärzte gänzlich vom unnatürlichen Gelderwerb ausgeschlossen sein: „Die Tapferkeit soll nicht Geld verdienen, sondern Mut erzeugen, und auch die Feldherrenkunst und die Medizin sollen dies nicht, sondern Sieg und Gesundheit verschaffen.“30
Der Staat solle darüber hinaus die Verteilung von Gütern, die Einhebung von Steuern, die Verteilung von „Ämtern und anderen Dingen“ überwachen.31 Und zwar nicht in der Form, dass alle Menschen gleich viel haben sollten, sondern, dass jeder das Seine erhalte, sodass die „Proportion“ des gesellschaftlichen Ranges und Verdienstes der Bürger gewahrt bleibe. Das ist der entscheidende Kontrapunkt zum kollektivistischen Modell Platons. Gemeineigentum ist Unsinn, meint Aristoteles: „Wenn jeder für das Seinige sorgt, werden keine Anklagen gegeneinander erhoben werden, und man wird mehr vorankommen, da jeder am Eigenen arbeitet.“32
Und doch gibt es einen Ausgleich. Der Reiche erhält zwar mehr an Ehren als der Arme. Aber wer mehr Geld und Ruhm hat, zahlt auch mehr: „Es widerspricht daher auch nicht der Gerechtigkeit, wenn der Reiche hohe, der Arme niedrige Steuern zahle.“33 Aristoteles nennt das die „austeilende Gerechtigkeit“.
Die gesellschaftliche Harmonie über den Staat herzustellen, ist für den Philosophen übrigens Grundvoraussetzung dafür, dass die Gemeinschaft funktioniert. Es ist eine immerwährende Verpflichtung, soll die Gemeinschaft nicht untergehen. Nicht der Tyrann, sondern der vollkommene Egoist ist für Aristoteles dabei der wahre Feind der Gesellschaft: „Der von Natur aus unstaatliche Mensch ist entweder ein Untermensch oder ein Übermensch“34 – und beide taugen nicht zum Gemeinwesen.
Daraus folgt das letzte warnende Credo: „Von Natur aus ist in allen Menschen der Trieb zur staatlichen Gemeinschaft der Urheber der größten Güter. Denn wie der Mensch in seiner Vollendung das vornehmste Geschöpf ist, so ist er auch bar der Gesetze und des Rechtes das schlechteste von allen. Deshalb ist er ohne Tugend das ruchloseste und roheste und bezüglich der Liebe und Gaumenlust das gemeinste Geschöpf. Denn die Gerechtigkeit ist staatlich.“35
Aristoteles erging es wie so vielen athenischen Größen. Nachdem er die Stadt mit seiner peripatetischen Schule zur Metropole des Geistes gemacht hatte, wollten ihm einige Bürger 323 v. Chr. wegen Religionsfrevel den Prozess machen. Aristoteles floh nach Chalkis. Ein Jahr später im Alter von 63 Jahren starb er, angeblich Sokrates nachahmend, durch den Schierlingsbecher.
Die Gedanken von Platon und Aristoteles über Wirtschaft und Gesellschaft werden Philosophen und Gelehrte der kommenden Jahrhunderte maßgeblich beeinflussen: Thomas von Aquin, Karl Marx und Adam Smith, um nur einige wenige zu nennen. Während Aristoteles das Mittelalter prägt, ist Platon der Philosoph von Reformation und Renaissance. In beiden Lehren wurzeln die heute geübten Staats- und Wirtschaftsformen: Kapitalismus, Sozialismus und die soziale Marktwirtschaft.
Damit verlassen wir Griechenland und wenden uns der römischen und frühchristlichen Zeit zu. Wir lassen auch Diogenes zurück, der uns mit einer seiner ätzenden Sentenzen verabschiedet: Weshalb Gold eine so blasse Farbe habe, will er wissen. Und als wir bloß die Achseln zucken, antwortet er grinsend: „Weil es die vielen fürchtet, die hinter ihm her sind.“36