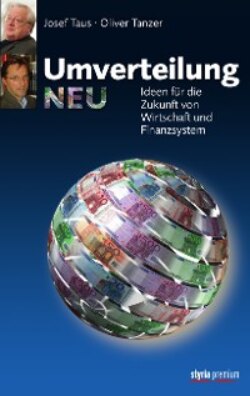Читать книгу Umverteilung neu - Oliver Tanzer - Страница 25
Ein neuer Weltentwurf
ОглавлениеFür die Scholastik ist Aristoteles der Spiritus Rector eines Versuchs, die Welt der christlichen Religion entsprechend zu ordnen, gleichzeitig aber auch der Kirche einen Weg zu einem gewissen „ökonomischen Realismus“ zu ebnen, der sich den sozialen Gegebenheiten der Welt anzupassen versteht. Doch diese Ansicht findet ab dem späten 15. Jahrhundert eine mächtige Gegnerschaft: jene der ersten Universalgelehrten der Renaissance. Sie fühlen sich als Vertreter eines neuen Menschenbildes, das nichts mehr mit jenem des Mittelalters zu tun haben will.
Ihr Ziel ist es nicht mehr, eine theologisch und philosophisch austarierte Form gesellschaftlichen Zusammenlebens zu erreichen. Vielmehr soll nun der Mensch und die Kraft seines Geistes die Existenz alleine bestimmen. So gesehen gibt es nicht nur die kopernikanische Wende, sondern auch eine anthropozentrische. Gott wird von den Kathedern der Wissenschaft auf die Kirchenkanzeln verbannt, die Scholastik und mit ihr Aristoteles kommen in Verruf. Mit drastischen Folgen für die Ökonomie, wie wir gleich sehen werden.
Auf einem Altarbild des Brügger Malers Hans Memling aus dem Jahr 1471 zelebriert die alte Zeit mittelalterlichen Glaubens ihre letzte künstlerische Blüte. Zu sehen ist eine Szene aus dem Jüngsten Gericht. Memling stellt die in der Offenbarung des Johannes geschilderte Wägung der Seelen dar. Der Erzengel Michael, überlebensgroß abgebildet in goldenem Harnisch und schwarzem Cape, wägt die aus ihren Gräbern erweckten Toten auf einer ehernen Waage, die über Rettung oder ewige Verdammnis entscheidet. Auch der Stifter des Altarbildes, der Bankier Angelo Tani, ist auf der Retabel verewigt. Er kniet innig betend auf einer der Schalen und wird der Rettung für würdig befunden, während andere Seelen schreiend und klagend den Schatten der Hölle anheimfallen. Der dargestellte Tani war im wirklichen Leben der Leiter der Medici-Bank in London.
Das Bild zeigt noch den angstvollen Respekt der Kaufleute vor dem Jüngsten Gericht. Sie wissen um ihre prekäre Lage, steht doch auf Wucher und Zinsnahme ewige Verdammnis. Viele der Reichen stiften deshalb vor ihrem Tod ihr Vermögen der Kirche oder den Armen – als Teil ihrer tätigen Reue. Das Diesseits ist in dieser Zeit also noch aufs Engste mit dem Jenseits verbunden.
Nach dem 15. Jahrhundert erlischt die Tradition der apokalyptischen Altarbilder. Die Letztverantwortung vor dem Schöpfer verblasst vor der menschlichen Selbstbehauptung, die nun Einzug hält.
Die philosophische Wende sucht und findet auch ein neues geistiges Aushängeschild: Platon. Schließlich war er es doch gewesen, der eine Transformation des Menschen zum Besseren durch die Anschau der ewigen Gesetzlichkeiten zum Prinzip erhoben hatte. War man diesen ewigen Gesetzen nicht gerade selbst auf der Spur? Setzte nicht Platon ein pythagoreisches, streng mathematisches Ordnungsprinzip, das geradezu maßgeschneidert war für die Erschaffung eines wissenschaftlichen Menschenbildes?63
Und noch etwas hatte Platon ersonnen: eine Utopie von der perfekten menschlichen Gesellschaft. Sein Entwurf vom idealen Staat füllt jenes Sinnvakuum, das der verlorene Jenseitsglaube zurückgelassen hat. Das Paradies muss nun nicht länger in einer Zeit nach dem Tod gesucht werden. Der Mensch kann im Hier und Jetzt sein Glück finden. Er wird sich selbst zum Erfüller der Vollendung.
Dies ist ein entscheidender Schritt: In der Scholastik versuchten die Lehrer, die Realität anzunehmen und als göttlichen Plan zu interpretieren. Nun aber wird das gemeinschaftliche Leben nach einer Idee geformt.
Die Wirklichkeit der Welt aber sträubt sich gerne gegen Utopien, Logik und System. Historische Konsequenz: In vielen Fällen zogen die Erfinder der Staats- und Gesellschaftsutopien aus der Unvereinbarkeit mit der Realität nicht die Konsequenz, sich der Welt anzupassen. Sie ignorierten vielmehr die Wirklichkeit und damit auch eines der wichtigsten Axiome der Geschichte: Ideen können geleugnet werden, aber die Realität zu leugnen, endet fatal.
Platons Utopie vom Idealstaat wird jedenfalls ab dem 16. Jahrhundert zum Vorbild für zahllose Projekte und Fantasien von einer idealen Gesellschaft. Die erste unter ihnen, die wie kaum eine andere ihre Spuren in der Geistesgeschichte hinterlassen hat, ist jene von der Insel Utopia, und ihr Verfasser ist kein Geringerer als der spätere Lordkanzler des englischen Königs Heinrich VIII.: Thomas Morus. Er malt als erster Vertreter der Neuzeit einen sozialistischen Gesellschaftsentwurf samt Kollektivwirtschaftsmodell.