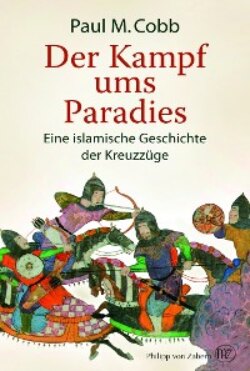Читать книгу Der Kampf ums Paradies - Paul M. Cobb - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der sunnitisch-schiitische Kalte Krieg
ОглавлениеAls der Prediger al-Sulami die Zwietracht innerhalb der muslimischen Gemeinschaft seiner Zeit beklagte, dachte er mit Sicherheit an interne Kämpfe wie jenen von Ibn al-Thumma gegen rivalisierende Kriegsherren auf Sizilien und ähnliche Vorgänge in Spanien und seinem eigenen Heimatland Syrien. Er sprach aber auch von unterschiedlichen Ansichten und Standpunkten, kurz gesagt: von Glaubensbekenntnissen. Für überzeugte Sunniten wie al-Sulami war die unheilvollste Spaltung innerhalb des Islams jene, die Sunniten und Schiiten trennte. Heute hat man sich allgemein damit abgefunden, dass sunnitische und schiitische Muslime nicht immer gut miteinander auskommen, aber dieser Konflikt war nicht immer der Normalfall. Konfessionelle Zugehörigkeit war im Islam – von wenigen Ausnahmephasen abgesehen – nie ein solcher politischer Streitpunkt wie heute. Im Mittelalter gerieten Sunniten und Schiiten zwar bisweilen hitzig aneinander, meist aber gelang es ihnen, Differenzen zu regeln, ohne zu den Waffen zu greifen. Das liegt größtenteils daran, dass es im mittelalterlichen Orient keine Nationalstaaten und Parlamentarier gab, die Konfessionszugehörigkeiten als Vorwand hätten nutzen können, um ihr eigenes politisches Süppchen zu kochen. Außerdem waren die Schiiten bei Weitem in der Unterzahl – eine Minderheit in einer überwiegend sunnitischen Welt.
Der zentrale Streitpunkt zwischen Sunniten und Schiiten war die religiöse Autorität nach dem Tod des Propheten Mohammed im Jahr 632. Wer sollte nun, in einer Welt ohne Propheten, im Namen des Islams sprechen? Jede Konfession definierte sich über ihre jeweilige Antwort auf diese Frage, die ebenso viel mit der Geschichtsdeutung wie mit Theologie zu tun hat. Unterschiedliche historische, theologische, rechtliche und kultische Merkmale hatten sich erst im 9. Jahrhundert so weit herausgebildet, dass man mit Fug und Recht von einem sunnitischen und schiitischen Islam sprechen kann. Für die Mehrheit der Muslime – die Sunniten – waren die wahren Erben des Propheten die Kalifen, deren Legitimität dadurch belegt wurde, dass sie von den führenden Mitstreitern des Propheten erwählt und durch die Zustimmung der muslimischen Gemeinschaft allgemein anerkannt worden waren. Ungeachtet ihrer individuellen Schwächen wurden die Kalifen im Laufe der Zeit zu idealtypischen Symbolen der Einigkeit. Ihre Autorität als Leitfiguren in Fragen des Glaubens und der Religionspraxis ging jedoch schließlich auf die Ulama über, in denen man den unmittelbarsten Zugang zum exemplarischen Handeln (Sunna) des Propheten zu finden glaubte und sie daher als der Menschheit größte Hoffnung betrachtete, Gottes Willen zu folgen. Für die überwältigende Mehrheit der Muslime bildeten nunmehr die Sunna des Propheten Gottes und der Konsens seiner Gläubigen (und insbesondere der Ulama) die tragenden Säulen der religiösen Identität. Die Abbasiden-Kalifen in Bagdad standen symbolisch für beides.
Der sunnitische Islam beruht auf dem gemeinsamen Interesse an der Orientierung an der Sunna des Propheten. Aber auch die Schiiten hatten ihre eigene Sunna.9 Für sie waren die wahren Erben des Propheten nicht die Ulama und noch weniger die von den Sunniten anerkannten Kalifen, sondern Verwandte des Propheten, insbesondere die Nachfahren seines Vetters und Schwiegersohns ʿAli ibn Abi Talib. In ihren Augen waren ʿAli und seine Familie (bezeichnet durch das Adjektiv ʿalid) vom Propheten selbst in seiner Nachfolge dazu bestimmt, als Imame die schiitische Gemeinde zu leiten.10 Für Schiiten bildete die Sunna des Propheten und ihrer Imame das Leitbild, das sie brauchten, um ein rechtschaffenes Leben zu führen. Der schiitische Imam war ein entscheidendes Kennzeichen einer gottgefälligen Gesellschaft: Gott gab jeder Generation einen Alidischen Imam, der von seinem jeweiligen Vorgänger ernannt wurde. Anders als die Kalifen der sunnitischen Lehre galt der Imam als unfehlbar und erfüllte daher die Aufgabe des letztlich entscheidenden Interpreten des religiösen Rechts, die der sunnitische Islam den Ulama und dem Konsens der Gemeinschaft zuwies. Für Schiiten war eine Gemeinde ohne Imam führungslos.
Es überrascht nicht, dass sich der Dissens innerhalb der schiitischen Gemeinde an der Person des Imams entzündete. Eine entscheidende Figur war der elfte Imam, Hasan al-ʿAskari, der im Jahr 873 in der irakischen Stadt Samarra starb, nachdem ihn die abbasidische Obrigkeit unter Hausarrest gestellt hatte, woraufhin sich zwangsläufig die Frage stellte, ob er während seines kurzen Lebens (er wurde nur neunundzwanzig) einen Nachfolger bestimmt hatte. Schließlich beschloss man, er habe einen Sohn und Erben als zwölften Imam namens Mohammed. Dessen Aufenthaltsort wurde jedoch geheim gehalten, um ihn vor seinen Gegnern zu schützen. Schiitische Gelehrte entwickelten aus dieser Idee eines verborgenen Imams mit der Zeit die Vorstellung der „Okkultation“: eines spirituellen Führers, der nicht einfach verschwunden war, sondern sich selbst aus der Welt verabschiedet hatte und am Ende aller Zeiten als messianische Gestalt zurückkehren werde, die man als Mahdi bezeichnete. Der Mahdi werde ein Zeitalter der Gerechtigkeit einleiten, in dem sich Gottes Wille für seine Jünger endlich erfüllen und die Rechtschaffenen in einer Gemeinschaft der Gläubigen vereinigt würden. Während die frommen Schiiten gläubig die Rückkunft des verborgenen Imams erwarteten, gaben sich die schiitischen Ulama alle Mühe, seine Abwesenheit theologisch zu begründen, und erteilten den Gelehrten die Autorität, seinen Willen zu interpretieren, während sie auf seine Rückkehr warteten. Daher warten die meisten Schiiten, die dieser imamitischen oder „Zwölfer“-Sekte angehören, heute noch.
Um den Imam gab es schon früher Streitigkeiten mit ähnlicher Tragweite. Im Jahr 765 starb der sechste Imam. Die Mehrheit der Schiiten erkannte seinen Sohn Musa als siebten ihrer zwölf Imame an, eine Minderheit betrachtete jedoch einen anderen Sohn, Ismail, als rechtmäßigen Nachfolger; man bezeichnet sie deshalb als ismailitische Schiiten. Wie sich herausstellte, war Ismail bereits vor seinem Vater gestorben; folglich waren viele Ismailiten der Ansicht, er sei gar nicht tot, sondern halte sich versteckt und führe seine Anhänger aus der Verborgenheit. Andere argumentierten, sein Sohn Mohammed sei als Erbe benannt worden und werde als Mahdi zurückkehren. Wie wir noch sehen werden, sind die Einzelheiten und die Stimmigkeit solcher Behauptungen nicht weiter wichtig, die Dunkelheit, die sie umgibt, jedoch sehr wohl.
Obwohl die sunnitische Mehrheit die Schiiten als rivalisierende und ketzerische Sekte betrachtete, gab es seit dem 9. Jahrhundert kaum offene Konfrontationen zwischen den beiden Konfessionen, vor allem aufgrund des mäßigenden Einflusses einiger Imame, die sich nicht gegen die Autorität der Abbasiden auflehnten, sondern die Ansicht vertraten, die schiitische Gemeinschaft sei zwar eine unterdrückte, dies beeinträchtige jedoch in keiner Weise die Legitimität und Autorität des Imams und seiner Anhänger. Hilfreich war auch, dass das schiitische Recht es erlaubte, sich zu verstellen und seinen Glauben zu verbergen, wenn dessen offene Ausübung Gefahren nach sich zog. Im Irak, vor allem in Bagdad und Kufa, gab es große schiitische Gemeinden, kleinere in Iran und in Syrien. Hochrangige Schiiten mischten sich am Hof der Abbasiden in Bagdad unter ihre sunnitischen Kollegen, und manche dienten sogar als Wesire und Verwalter. Es gab einige Dynastien, die offen schiitisch auftraten, Seite an Seite mit sunnitischen Bruderstaaten, die entstanden, als das Kalifat der Abbasiden zerfiel, so etwa die Hamdaniden in Nordsyrien und im Irak, die sich als führende Kämpfer im Dschihad gegen die byzantinischen Feinde des Islams priesen, und die spektakuläreren Buyiden im Irak und Westiran, die den abbasidischen Kalifen während des 10. und frühen 11. Jahrhunderts praktisch als Gefangenen seiner eigenen Herrschaft hielten. Manchen Historikern gilt diese Epoche als „schiitisches Jahrhundert“, da plötzlich überall auf der Landkarte schiitische Regierungen auf den Plan traten.11
Eine solche Situation war geeignet, fest verwurzelte Interessen zu bedrohen und in Gewalt auszuarten; die sektiererischen Straßenkämpfe, von denen aus dem Bagdad des 11. Jahrhunderts berichtet wird, sind dafür ein deutlicher Beweis. Insgesamt aber entwickelten Sunniten und Schiiten eine Art zähneknirschender gegenseitiger Anerkennung und feindseliger Hinnahme auch der simplen Tatsache, dass keine der beiden Konfessionen ihren Anspruch auf eine Vorrangstellung aufgeben würde – letztlich ein „Kalter Krieg“ der Konfessionen, in dem Vertreter beider Richtungen selten offen gegeneinander kämpften. Man trug die Rivalitäten vielmehr in der Öffentlichkeit durch gelehrte Polemik und Spektakel (wie die Verfluchung der ersten sunnitischen Kalifen durch Schiiten und die Entweihung schiitischer Heiligtümer durch Sunniten) und im Geheimen durch den Einsatz von Agenten und Missionaren aus. Und währenddessen handelten, arbeiteten und lebten Sunniten und Schiiten weiterhin miteinander. Der „Kalte Krieg“ war jedoch kein Dauerzustand und konnte das wohl auch nicht sein. Mitte des 11. Jahrhunderts, als die Schiiten bereits seit Langem nicht nur eine Dynastie, sondern auch ein Reich besaßen, wurde er heiß.