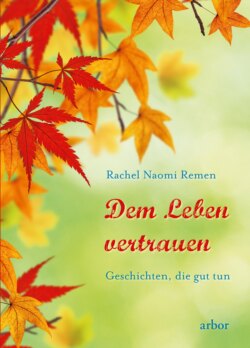Читать книгу Dem Leben vertrauen - Rachel Naomi Remen - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPflaumenblüten
Vor vielen Jahren sah ich mich während eines Einkaufsbummels mit einem Freund zusammen in einem großen Geschäft für japanische Möbel um, weil ich ihm bei der Einrichtung seines Hauses helfen sollte. Er wurde sofort von der einzigen Verkäuferin in Beschlag genommen, einer winzigen Frau im Kimono, die ihn am Arm fasste und ihn laut und eindringlich in eine Diskussion über japanische Malerei verwickelte. Sie reichte ihm gerade bis zum Ellbogen, und ungeachtet ihrer Größe war mir ihr Verhalten unangenehm, und ich verdrückte mich in Richtung Tür, versteckte mich hinter den Truhen, um abzuwarten, bis er seine Besorgungen erledigt hatte. Ich glaubte, mich gut genug versteckt zu haben, als sich die Frau unversehens umdrehte und zielstrebig auf mich zukam. Ich bemerkte, dass sie ziemlich alt war, außerdem schien sie taub zu sein, was vielleicht der Grund für ihre laute Art war. Sie packte mich am Arm und zog mich durch den Verkaufsraum, ermunterte mich mit kleinen, schnalzenden Lauten und einem wiederholten „Kommen Sie, kommen Sie“, ihr zu folgen. Ich versuchte, sie abzuschütteln, aber für ein so zierliches Persönchen hatte sie einen festen Griff. Ich ging also mit, gefolgt von meinem Freund, der sich unverhohlen amüsierte, dass all mein Sträuben vergeblich gewesen war.
In dem Raum, in den sie uns führte, hingen nur vier Schriftrollen, an jeder Wand eine. Auf ihnen waren die Jahreszeiten dargestellt. Im Unterschied zu den Bildern im Verkaufsraum hatten diese hier Museumsqualität. Auf einem erblühte ein alter und gekrümmter Zweig mit Hunderten von winzigen rosa Blüten. Der Zweig und die Blüten waren von Schnee bedeckt. Ein wunderbares Bild.
Sie veranlasste mich, vor das Bild zu treten, und sagte: „Sehen Sie, sehen Sie? Februar! Die Pflaumenblüte beginnt.“ Auf ihre merkwürdig eindringliche Art erzählte sie mir, dass der Pflaumenbaum leiden müsse, weil er als Erster blühe, nämlich im Februar, wenn oft noch winterliche Verhältnisse herrschten. Mit ihrer schmalen, arthritischen Hand berührte sie den Schnee auf dem Zweig und nickte lebhaft. Dann schaute sie mich scharf an, schüttelte leicht meinen Arm und sagte: „Die Pflaumenblüte ist der Anfang. Sie gleicht den japanischen Frauen, die so weich, zart und sanft wie Pflaumenblüten sind … aber sie überleben.“
Das ging mir lange nicht aus dem Kopf. Als Ärztin glaubte ich zu wissen, was Überleben bedeutete, schließlich arbeitete ich im „Überlebensgeschäft“. In meinem Bereich hing das Überleben von medizinischer Fachkenntnis, Kompetenz, von Geschicklichkeit und vom Handeln ab. Was die Japanerin mir erzählt hatte, ergab für mich keinen Sinn.
Noch aus einem weiteren Grund verwirrte mich der Vorfall. Ähnlich wie der Pflaumenbaum, der zu früh im Jahr blüht, war ich zu früh geboren worden. Da meine Mutter sich während der Schwangerschaft eine Blutvergiftung zuzog, musste sie durch Kaiserschnitt entbunden werden. Ich wog viel zu wenig, und damals, im Februar 1938, erwartete wohl kaum jemand, dass ich überleben würde. Während meiner Kindheit erzählte man mir immer wieder, ich hätte nur durch Einsatz eines Brutkastens überlebt. Viele Jahre lang empfand ich gegenüber dieser Technik, die mir das Leben gerettet hatte, große Dankbarkeit. Später, als junge Kinderärztin, arbeitete ich auf einer Intensivstation für Frühgeborene, auf der weitaus leistungsstärkere Apparate eingesetzt wurden als in meiner Kindheit, um die Babys am Leben zu erhalten. Doch was die alte Japanerin gesagt hatte, machte mich stutzig. Vielleicht war Überleben nicht nur eine Frage der Technik, vielleicht steckte in jedem dieser winzigen, schwächlichen rosa Säuglinge eine angeborene Kraft, die auch mich damals befähigt hatte zu überleben. Darüber hatte ich noch nie nachgedacht.
In diesem Zusammenhang kam mir ein Frühlingstag in den Sinn, an dem ich – damals gerade vierzehn Jahre alt – die Fifth Avenue in New York City entlangging und dabei erstaunt zwei winzige Grashalme bemerkte, die aus dem Bürgersteig wuchsen. Irgendwie mussten sie sich durch den Asphalt gebohrt haben. Obwohl ich die vorübereilenden Menschen behinderte, blieb ich stehen und betrachtete ungläubig die Hälmchen. Dieses Bild blieb mir lange im Gedächtnis haften, wahrscheinlich deshalb, weil mir die Begebenheit wie ein Wunder vorkam. Damals hatte ich einen ganz anderen Machtbegriff als heute. Ich verstand unter Macht die Herrschaft durch Wissen, Reichtum, Staat und Gesetz. Mit jener anderen angeborenen Macht hatte ich noch keine Erfahrung.
Nach Unfällen und Naturkatastrophen empfinden Menschen das Leben oft als etwas sehr Zerbrechliches. Nach meiner Erfahrung können abrupte und unvorhergesehene Ereignisse ein Leben zwar verändern, zerbrechen werden sie es aber nicht. Vergänglichkeit ist etwas anderes als Fragilität. Schon physiologisch gesehen ist der Körper ein komplizierter Mechanismus mit Kontroll- und Gleichgewichtssystemen – Ergebnis unzähliger Überlebensstrategien und Balanceprozesse. Jeder, der nach einem so massiven und gewaltsamen Eingriff wie zum Beispiel einer Knochenmarkstransplantation oder einer Operation am offenen Herzen den weiteren Heilungsprozess verfolgt, hat tiefen Respekt, ja Ehrfurcht vor der Fähigkeit des Körpers, so etwas zu überleben. Über diese Kraft verfügt jeder Mensch, egal, wie alt er ist, und ohne sie wäre kein medizinischer Eingriff von Erfolg gekrönt. Selbst innerhalb der einzelnen Körperzellen ist dieser Lebenstrieb vorhanden, und schon bei Neugeborenen behauptet er sich hartnäckig. Als Medizinstudentin habe ich es einmal miterlebt, wie einer meiner Lehrer einem Neugeborenen den Finger in den Mund steckte und es, sobald es sich festgesaugt hatte, sanft aus seinem Bettchen hochzog.
Mit derselben Kraft wie dieses Baby hält jeder von uns am Leben fest – bis zum Augenblick seines Todes.