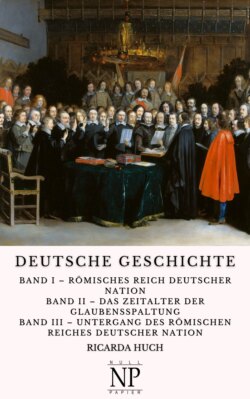Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ausgang
ОглавлениеIn jedem Unglück, das ihn traf, offenbarte Friedrich seinen elastischen Geist. Nicht einmal seine Mienen verrieten Niedergeschlagenheit, viel weniger Verwirrung oder Unsicherheit seine Handlungen. Vielleicht war es zu seinem Heile, dass das verwegene Herz des Grafen von Dassel nicht mehr schlug und ihn nicht mehr über die Schranken, die er sich selbst gesetzt hatte, fortreißen konnte. Infolge seiner Niederlage konnten allerdings die Widerstrebenden unter den lombardischen Städten allmählich neue Kraft sammeln; aber im deutschen Reiche blieb sein Ansehen unerschüttert, und es gelang ihm, dank dem Zusammenwirken mit Heinrich dem Löwen, einen leidlichen Friedensstand zu erhalten.
Heinrichs Lebenszweck war, sein sächsisches Herzogtum zu einem geschlossenen, womöglich das nördliche Deutschland umfassenden Staat zu bilden, in dem alle Rechte in seiner Hand lägen. Fast alle Fürsten suchten zu erobern und zu erraffen, was die Gelegenheit bot; wenige hatten die Bildung eines abgerundeten Staates im Auge, und noch wenigere gingen dabei mit so durchgreifender Rücksichtslosigkeit vor wie Heinrich der Löwe. Nicht Freundschaft, nicht Gerechtigkeit noch Dankbarkeit hemmten ihn. Wahrhaft wie ein Löwe, ein blindes Geschöpf der Natur, das mit schwerer Tatze zermalmt, was vor ihm sich bewegt, ging er großmütig und unheilvoll seinen geraden Weg. Den Grafen Adolf von Holstein, seinen Gefährten in vielen Kämpfen, zwang er, ihm seine Stadt Lübeck abzutreten; dem jungen Pfalzgrafen Adalbert nahm er seine Bergfeste Lauenburg bei Quedlinburg, auf die er keinerlei recht hatte. An den Heidenbekehrer Wizelin stellte er die Forderung, er solle von ihm die Investitur annehmen, ein unerhörter Eingriff in die kaiserlichen Rechte. Als Wizelin nach Beratung mit dem Erzbischof von Bremen sich weigerte, wie das auch seine Pflicht war, sperrte er ihm die Einkünfte, sodass der gute Mann, wenn er nicht verhungern wollte, sich fügen musste. Heinrich begründete sein Ansinnen damit, dass er die von ihm eroberten, ehemals slawischen Gebiete zu eigenem Besitz habe. Es gab kaum einen unter den norddeutschen Fürsten, dem er nicht irgendein Recht oder Gebietsstück entrissen; den er nicht durch sein herrisches Auftreten gekränkt hatte. Der Führer seiner Gegner war Albrecht der Bär aus dem Geschlecht der Grafen von Askanien, der ähnliche Bestrebungen wie der Herzog fast ebenso umsichtig und nachhaltig verfolgte. Er war zu der Zeit, wo Heinrich der Stolze durch Konrad III. geächtet wurde, an dessen Stelle Herzog von Sachsen geworden, und, nachdem er wegen der Wiedereinsetzung Heinrichs des Löwen hatte zurücktreten müssen, sein heimlicher Nebenbuhler geblieben. Bei der gegenseitigen Abneigung und den gleichartigen Zielen ergaben sich beständig Reibungen. Die Erzbischöfe von Bremen und Magdeburg und der Bischof von Halberstadt gehörten zu den Fürsten, die knirschend, sprungbereit im Kreise den Gewaltigen umgaben, der sie verachtete. Er tat das, weil es seine Natur war, und weil er sich durch die Gunst des Kaisers gesichert fühlte. Wie er seit der im Beginn von Friedrichs Regierung geschlossenen Versöhnung dem Kaiser bei allen seinen Unternehmungen ein treuer Gefolgsmann gewesen war, so schützte der Kaiser ihn, ohne dem Rechte peinlich Rechnung zu tragen. Selbst in der wichtigen Frage der Investitur der Bischöfe gab er nach, sodass Heinrich das Recht erhielt, die Bischöfe von Ratzeburg, Aldenburg und Mecklenburg, später Lübeck und Schwerin, zu belehnen. Als Heinrich den Markt- und Brückenzoll von Föhring, einem Ort, der dem Bischof Otto von Freising gehörte, nach München verlegte, um dadurch diese seine Stadt zu heben, auch da, wo es sich um seinen eigenen Oheim, einen hochangesehenen Geistlichen, handelte und Heinrich offenbar im Unrecht war, entschied der Kaiser zu seinen Gunsten. Im Bewusstsein der Unnahbarkeit seiner Stellung errichtete Heinrich seiner Stadt Braunschweig den ehernen Löwen, der uns bezeugt, was für bedeutende Werke aus den deutschen Erzgießereien hervorgingen. War er rücksichtslos gegen die Geistlichen, die ihn in seinen Plänen störten, so war er doch nicht unkirchlich. Wie einer ein Siegel unter gesicherten Besitz setzt, so unternahm er im Jahre 1172, als sein Gegner Albrecht der Bär gestorben und das Fundament seines Reiches festgelegt war, eine Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande. Alle Welt konnte sehen, dass er sein Herzogtum ruhig in den Händen seiner englischen Frau und seiner treuen Vasallen ließ. Unter den Geistlichen, die ihn begleiteten, war der gelehrte und verehrungswürdige Abt Heinrich von Braunschweig, der in Konstantinopel durch seine Gespräche über einige Punkte, in denen die griechische von der römischen Kirche abweicht, Bewunderung erregte. In Jerusalem hielt sich Heinrich drei Tage lang auf und teilte königliche Vergabungen aus. Den Ertrag dreier Häuser, die er kaufte, bestimmte er zur Unterhaltung dreier ewig brennender Lampen in der Auferstehungskirche. Er besuchte die heiligen Orte, den Ölberg, Bethlehem, Nazareth und das wüste Gebirge, in dem Jesus nach der Überlieferung vom Teufel versucht wurde. Überall wurde er von Christen und Heiden mit Ehrerbietung empfangen und reich beschenkt. Um den wertvollen Reliquien, die er mitbrachte, eine würdige Stätte zu schaffen, baute er in Braunschweig nach Niederreißung des alten Stiftes den Dom, in dem wir jetzt sein und seiner Frau Mathilde Grabmal bewundern. Auch die Dome von Ratzeburg und Lübeck hat er gegründet; sie haben den ernsten, stolzen und dabei gemütlichen Charakter, der dem alten Sachsenlande so sehr gemäß ist. An der Umrahmung eines Portals des Domes von Braunschweig befindet sich die Vertiefung, die der Sage nach die Klaue des Löwen, den der Herzog aus dem Heiligen Lande mitbrachte, zurückließ, als er den Weg zum Grabe seines Herrn suchte.
Einige Jahre nach Heinrichs Rückkehr brach der Reichskrieg gegen das wieder erstarkte Mailand aus, und der Kaiser verlangte von seinem Vetter den üblichen Zuzug. Da geschah das Unerwartete, Unbegreifliche, dass der Herzog ihm seinen Beistand versagte. Jahrelang hatte das feste Zusammenhalten von Kaiser und Herzog so bedeutende Erfolge für beide erwirkt, dass man meint, es müsse ein schwerwiegender Anlass zur Entfremdung vorgefallen sein; aber kein solcher ist bekannt. Dass Friedrich die Erbschaft des alten Welf, eines gemeinsamen Verwandten, angenommen hatte, die Heinrich für sich beanspruchte, scheint als Grund für solchen Abfall nicht zu genügen. War in Heinrich, der nun Schwiegersohn des Königs von England und Vater mehrerer Söhne war, das Bewusstsein der Macht so angewachsen, dass er nicht mehr ertragen konnte, einen Herrn über sich zu haben? Vielleicht war es wirklich nur das, dass er als Preis für seine Hilfe die Stadt Goslar verlangte, die dem Kaiser gehörte, und dass dieser sie ihm versagte. Auf diese Stadt mit ihrem Reichtum an Silber und Erzen glaubte er ein Anrecht zu haben, weil sie am Rande des Harzes, auf sächsischem Gebiet lag. Sie war ein Gegenstand, der die Raublust entflammen und einen Mann von so starrem Charakter so verblenden konnte, dass er selbst den Abgrund aufriss, der ihn verschlang.
Es steht nicht fest, wo die verhängnisvolle Begegnung zwischen den Vettern stattfand, ob in Chiavenna oder in Partenkirchen; der Kaiser kam aus Italien über die Berge, um die Hilfe vom Herzog zu erlangen, die den Ausschlag zum Siege geben sollte. Man erzählt sich, dass Friedrich dem Herzog zu Füßen gefallen sei, um ihn zum Nachgeben zu bewegen; es erschien den damaligen Menschen fast grauenvoll, dass der Herr der Welt vor seinem Vasallen das Knie beugte.
Der Sieg der Lombarden bei Legnano bedeutete für Friedrich das Hindernis des Schicksals, das den ins Leben Stürmenden zum Anhalten zwingt und zur Besinnung bringt. Er war groß genug, um zu lernen, dass er, wie hoch er auch stand, andere Mächte müsse gelten lassen, dass er sich vertragen müsse, wo er nicht herrschen konnte, und er handelte nach der gewonnenen Einsicht, ohne seiner Würde zu vergeben. Nach einer furchtbaren Niederlage erlitt er keine erhebliche Minderung seiner Macht, wenn er auch den lombardischen Städten die Selbstwahl ihrer Beamten zugestehen musste, und gar keine des Ansehens. In Venedig, wo der Frieden im Jahre 1177 abgeschlossen wurde, war er der Mittelpunkt der Bewunderung. Die beiden großen Kirchenfürsten, Christian von Mainz und Wichmann von Magdeburg, hatten erreicht, dass der Kongress nicht in Bologna stattfand, das dem Papst gehörte, sondern in der Republik, zu der der Kaiser in guten Beziehungen stand. Er unterzog sich in der Markuskirche allen Förmlichkeiten, die die Gelegenheit verlangte, um dann im Palast des Patriarchen in deutscher Sprache zu erklären, dass er geirrt habe, indem er in Angelegenheiten der Kirche mehr kraft seiner Macht als nach den Grundsätzen des Rechtes habe regieren wollen. Christian von Mainz, der sieben Sprachen fließend sprechen konnte, nämlich Griechisch, Lateinisch, Apulisch, Lombardisch, Römisch, Französisch, Brabantisch, verdolmetschte die Rede des Kaisers. Den Schluss der Festlichkeiten bildete eine Versammlung in der Markuskirche, wo der Papst den Bann über alle diejenigen aussprach, die den zwischen der Kirche und dem Kaiser, dem Kaiser und dem Königreich Sizilien und den Lombarden geschlossenen Frieden und Waffenstillstand stören sollten. Als er den Fluch ausgesprochen hatte: »Und wie diese Kerzen ausgelöscht werden, so sollen ihre Seelen der ewigen Anschauung Gottes beraubt werden«, warfen der Kaiser und alle Anwesenden die brennenden Kerzen, die ihnen überreicht worden waren, zu Boden, dass sie erloschen. Solange Alexander lebte, blieb der Friede erhalten. Er starb im Jahre 1181, ein Jahr später Christian, der große Erzbischof von Mainz, der nach wie vor den Kaiser in Italien vertrat. Die Entwicklung der Verhältnisse brachte es mit sich, dass der schneidige Bekämpfer des Papstes als sein Beschützer endete. Als die Römer im Aufstande gegen den Papst Tusculum belagerten, wo er einst seinen berühmten Sieg erfochten hatte, eilte er auf den Hilferuf desselben sofort herbei, und sein Name genügte, um die Angreifer zurückzuschrecken. Von einem Fieber ergriffen starb er bald darauf, nachdem ihn der Papst, es war Lucius III., mit den Sterbesakramenten versehen hatte. So hoch schätzte Lucius seinen Retter, dass er ein Rundschreiben an die deutschen Kirchen über seine Verdienste und seinen Tod erließ und Bestimmungen für die Feier seines Gedächtnisses traf.
Wie er einst nach einem Siege Italien gleich einem Flüchtenden hatte verlassen müssen, so kehrte Friedrich nach einer furchtbaren Niederlage wie ein Sieger nach Deutschland zurück. Er hatte auf eine unmittelbare Beherrschung der lombardischen Kommunen verzichten müssen, aber die kaiserliche Oberhoheit und ansehnliche ihr zustehende Einkünfte gesichert. Seine nächste Sorge betraf das Verhältnis zu Heinrich dem Löwen, und zwar hatte er durchaus nicht im Sinn, Rache zu nehmen für die Untreue seines Vetters, die ihn so teuer zu stehen gekommen war, sondern womöglich die frühere Gemeinschaft wiederherzustellen. Wahrscheinlich war er nicht frei von Erbitterung; aber er war gewöhnt, seinen persönlichen Gefühlen das Interesse des Reichs voranzustellen, vielleicht war unwillkürlich in seiner Brust schon beides eins geworden. Ein gedemütigter, aber immer noch mächtiger Herzog von Sachsen blieb für ihn der erwünschteste Bundesgenosse, die Stütze des Reichs, wenn er sich als Reichsfürst erweisen wollte. Was man von den steinernen Herzen der Sachsen sagte, ließ sich auf Heinrich anwenden: sein Trotz wich der Verständigung, die der Kaiser suchte, aus und zwang ihn dadurch, den Forderungen des Fürstenbundes nachzugeben, der den Herzog vernichten wollte. Friedrich hatte es ausgezeichnet verstanden, die hochmütige Adelsfamilie, die im Kaiser den von ihr erwählten Vertreter ihrer Interessen sah, zugleich zu ehren und zu beherrschen; umso weniger konnte er die offene Widersetzlichkeit eines der Ihren unbestraft lassen. Oft hatten seine vielen Feinde sich gegen ihn lahm gewütet, so, dachte der Herzog, würde es wieder einmal gehen; aber er musste erleben, dass den Geächteten fast alle seine Anhänger verließen. Unter den wenigen, die bei ihm ausharrten, war der tapfere Graf Bernhard zur Lippe. Als der Herzog sich nach verzweifelter Gegenwehr unterwerfen musste und unter kaiserlichem Geleit nach Lüneburg kam, wo der Kaiser sich aufhielt, sagte er zu den Rittern, die ihm entgegenkamen: »Sonst pflegte ich hierzulande von niemandem Geleit zu erhalten, sondern anderen zu geben!« Nur dieser karge Ausdruck des Schmerzes ist von dem gestürzten Löwen überliefert. Am meisten gewann durch seinen Untergang der Erzbischof von Köln, Philipp von Hainsberg, der, kaum dass er seine Beute in Sicherheit gebracht hatte, zum Papst überging und des Kaisers Feind wurde. Er erhielt die westliche Hälfte Sachsens mit allen herzoglichen Rechten, mit der kleineren östlichen wurde einer der Söhne Albrechts des Bären belehnt.
Bayern bekam Otto von Wittelsbach, nachdem die Steiermark davon abgetrennt worden war, Heinrich behielt seine Eigengüter, Braunschweig und Lüneburg, die später Friedrich II. mit der ehemaligen Grafschaft Stade vereinigt und zum Herzogtum erhoben einem Enkel Heinrichs übergab. Als der Kaiser den Kreuzzug antrat und die sächsischen Fürsten mit Recht fürchteten, Heinrich werde dessen Abwesenheit nützen, um sie zu überfallen, schlug Friedrich seinem Vetter vor, sich entweder mit einer sofortigen, aber nur teilweisen Wiedereinsetzung zu begnügen oder ihn ins Heilige Land zu begleiten, um nachher alle seine Lehen wiederzubekommen. Da er trotzig beides ablehnte, wurde ihm auferlegt, das Festland zu verlassen, und er ging nach England an den Hof des Königs, seines Schwiegervaters. Wie verderblich die Auflösung des sächsischen Herzogtums auch für das Reich war, im Augenblick genoss der Kaiser die Frucht seiner Zugeständnisse an die Fürsten. Sein Ansehen war größer als je und stellte sich auf dem Reichstage zu Mainz im Jahre 1184 eindrucksvoll dar. Die Schwertleite seiner beiden ältesten Söhne, Heinrichs, der schon den Königstitel trug, und Friedrichs, Herzog von Schwaben, gab Gelegenheit zu großartigen ritterlichen Spielen, an denen der Sechzigjährige sich rüstig beteiligte. Indessen war zwischen Papst und Kaiser bereits wieder eine Verstimmung eingetreten. Man hatte beim Frieden von Venedig, um nur zum Schlusse zu kommen, die Frage der Mathildischen Güter unerledigt gelassen; es war natürlich, dass sie wieder auftauchte und ebenso unlösbar blieb wie früher. Im Hinblick auf die Investitur sagte der Kaiser, er habe nachgeforscht und erfahren, dass seine Vorfahren, die alten Kaiser, Bischöfe nach Belieben gewählt und eingesetzt hätten. Soweit seine Vorfahren auf dies Recht verzichtet hätten, wolle er das auf sich beruhen lassen; was ihm aber an Rechten geblieben sei, wolle er sich nicht beschränken lassen. Da die Päpste nicht nur eine vom Kaiser ganz unabhängige Wahl der Bischöfe, sondern eine von ihnen abhängige wollten, bestand auch hierin ein unvereinbarer Gegensatz. Vollends erbitterte den Papst, was Friedrich als seinen größten Erfolg ansah, dass es ihm gelungen war, seinen Sohn Heinrich mit Constanze, der Erbin des Königreichs Sizilien, zu verloben. Wäre nicht Urban III. als Angehöriger einer Familie, die seinerzeit durch die Zerstörung Mailands schwer betroffen gewesen war, ohnehin ein unversöhnlicher Gegner des Kaisers gewesen, er hätte es werden müssen bei der Aussicht, den Kaiser als Besitzer desjenigen Landes zu sehen, auf das der Papst sich gegen den Kaiser zu stützen pflegte. Sowohl Lucius wie Urban weigerten sich, den jungen Heinrich zum König von Italien zu krönen. Großartig unbekümmert ließ Friedrich die Zeremonie durch den Patriarchen von Aquileja vollziehen und verlieh seinem Sohne selbst den Cäsarentitel. Um seinen Triumph zu vollenden, erbat sich die völlig versöhnte Stadt Mailand die Ehre, dass Heinrichs Hochzeit mit Constanze in ihren Mauern gefeiert werde.
Stellt man sich vor, wie Christian von Mainz unter dem Segen des Papstes starb und wie die Mailänder Barbarossa umjubelten, als er seinen Sohn mit der Erbin Siziliens verheiratete, will es einem vorkommen, als wären die Taten der Menschen nicht anders als Naturerscheinungen, Wolken oder Winde, die kommen und gehen, sich bilden und verschwinden, zerstören und befruchten. Und doch ist in dem verschlungenen Wechsel und der scheinbaren Wahllosigkeit eine stetige Folge und ein fester, tragischer Gang, im Schicksal des Reiches wie in dem des Kaisers und jedes einzelnen, ja zuweilen ist es, als fügten weit entlegene Ereignisse sich zusammen, um vorbestimmte Ergebnisse zu erzeugen. Von solcher Wirkung war die Eroberung Jerusalems durch Saladin im Jahre 1187, die im Abendlande allgemeine Erregung hervorrief und den Kaiser veranlasste, sich selbst an die Spitze eines Zuges zur Wiedergewinnung der Heiligen Stadt zu stellen. Auf dem Reichstage zu Gelnhausen, der ein Jahr vorher stattfand, verfassten zahlreich versammelte Bischöfe ein Schreiben an den Papst, in dem sie sich für verpflichtet erklärten, dem Kaiser, von dem sie ihre weltlichen Güter hätten, zur Seite zu stehen, und in dem sie den Papst baten, seinen berechtigten Forderungen zu entsprechen. Wieder scharten sich weltliche und geistliche Fürsten um die Krone. Diese Einigkeit des Reiches, die Befestigung der Dynastie, die sichere Stellung dem Papst gegenüber, die Wahrung der Reichsrechte in Italien, alle drei großen Erfolge waren hauptsächlich dem Charakter des Kaisers zu danken. Wie viel der Geist und Wille eines einzelnen tragen und bewegen kann, erlebten die Menschen an ihm. Dass er immer das Große und Rechte wollte und seine Person mit allen Kräften einsetzte, um es durchzuführen, das trug ihm die dankbare Liebe seines Volkes und die Anerkennung der christlichen Nationen ein. Schon die äußere Erscheinung des alten Mannes, der sich zum Kreuzzuge rüstete, vergegenwärtigte die imponierende Existenz eines Kaisers, der in harten Kämpfen das Nur-Persönliche abgestreift hat und eins geworden ist mit seinem Reich. Entwaffnet durch die heilige Aufgabe, der der Kaiser sich unterzog, erbot sich der ohnehin versöhnliche Papst Clemens seinen Sohn Heinrich, dem er die Reichsregierung übertragen hatte, und Constanze in Rom zu krönen.
Friedrich war bei den Vorkehrungen für den Feldzug so praktisch verfahren, dass man auf glückliches Gelingen hoffen konnte. Für die Verproviantierung auf der Reise war gesorgt, und damit nicht eine Menge Gesindel sich anschließe, das gewöhnlich die Kreuzzüge erschwerte, war verordnet, dass niemand, abgesehen von den Knechten und Handwerkern, mitgehen dürfe, der nicht Geld genug zum Ankauf von Lebensmitteln für zwei Jahre habe. Trotzdem ging die Reise nicht ohne Unfälle, Leiden und Kämpfe vor sich, die aber überwunden wurden, ohne dass der Kaiser an Frische und Zuversicht verloren hätte. Da, am 10. Juni 1190, ertrank er beim Baden im Flusse Saleph, womit er sich nach Übersteigung eines rauen Gebirges erquicken wollte. Sein Sohn Friedrich führte das Heer nach Akkon, das von dem Teil des Kreuzheeres, der zu Schiffe gereist war, belagert wurde, und starb dort im Anfang des Jahres 1191 an einer Seuche.