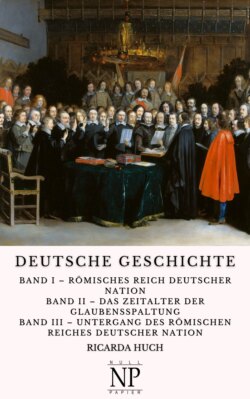Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Juden
ОглавлениеEs ist kein Blatt in der Geschichte der Menschheit so tragisch und geheimnisvoll wie die Geschichte der Juden. Einzig ihre Stellung unter den Völkern als das auserwählte, aus welchem der hervorging, der für das Abendland den Mittelpunkt und die Grenzscheide der Völker bildet, dessen Name und Wort das Höchste, das Verehrungswürdigste bezeichnet; einzig zugleich als das verfluchte, das ihn ans Kreuz schlug. Waren sie auserwählt, weil in keinem anderen Volke eine so leidenschaftliche Spannung zwischen dem Guten und dem Bösen bestand? Und warum konnten sie, nachdem der Gottmensch in ihrer Mitte Fleisch geworden war, nachdem sie aufgelöst und in alle Teile der Erde zerstreut waren, nicht untergehen? Sollte ihnen die irdische Unsterblichkeit zuteil werden, weil sie an die jenseitige nicht glauben wollten? Sollte das Götter- und Sünderblut erhalten bleiben als ein Tropfen bald heilsamen, bald tödlichen Giftes für seine Nachbarn?
Eine sagenhafte Überlieferung erzählt, der Frankenkönig Karl habe den König von Babel gebeten, ihm einen weisen Juden zu schicken, worauf der Rabbi Machir, ein Mann voll ungewöhnlicher Weisheit, nach dem Westen gekommen sei. Aus Liebe zu ihm habe Karl ihm den dritten Teil der damals eroberten Stadt Narbonne und den Adel verliehen, dazu Privilegien für die dort wohnenden Juden. Gewiss ist, dass die Juden im karolingischen Reiche unbelästigt, nicht selten sogar begünstigt lebten, sodass die Christen über ihre ungerechte Bevorzugung klagten. Die stolze Welfin Judith, Ludwigs des Frommen Frau, soll eine entschiedene Vorliebe für sie gehabt haben. Wahrscheinlich haben Juden fortdauernd während der unruhig bewegten Jahrhunderte der Völkerwanderung in den halb zerstörten, verfallenen Städten des Römischen Reiches gewohnt. In Worms wurde zur Erklärung dafür, dass die Juden dort besonders gut gestellt waren, angeführt, sie seien schon vor Christi Geburt hingekommen, trügen also keine Schuld am Tode Christi. Ein Vorfahr der Kämmerer von Worms, deren Name und Güter später auf die Dalberg übergingen, sollte zurzeit des Augustus römischer Hauptmann in Palästina gewesen und später nach der Provinz Germanien versetzt sein, wohin er Juden mitgenommen habe. Diese Familie rühmte sich der Verwandtschaft mit der Mutter des Erlösers. Zwar war den Juden erlaubt, Land zu besitzen, aber da sie keine christlichen Sklaven halten durften, konnten sie größere Güter nicht bewirtschaften. Dem Handwerk haben sich Juden in verschiedenen Ländern mit Glück gewidmet, aber im Römischen Reiche beschäftigten sie sich hauptsächlich mit Fernhandel, und das war es wohl auch, weswegen sie im Allgemeinen gern gesehen und von den Königen oft gebraucht wurden. Unermüdlich durchwanderten sie die alten Handelsstraßen nach dem Osten und wieder nach dem Westen, erwarben in Byzanz kostbare Stoffe und Gewürze, auch die Pelze, die von Russland dem großen Stapelplatz am Schwarzen Meer zugeführt und am Hofe der fränkischen Könige sehr begehrt wurden, kauften Sklaven in Böhmen und brachten sie nach Spanien. Da sie über die ganze Erde zerstreut waren, hatten sie überall gute Beziehungen, auch beherrschten sie verschiedene Sprachen und besaßen die Warenkenntnis, die für Handeltreibende nötig ist. Ihre Vertrautheit mit fremden Ländern war die Ursache, dass die Könige sie bei Gesandtschaften verwendeten. Karl der Große gab zwei Gesandten, die dem Kalifen Harun al Raschid Geschenke überbringen und vielleicht auch Handelsbeziehungen anknüpfen sollten, den Juden Isaak mit, der, da die beiden Franken unterwegs starben, als Haupt der Ambassade die Gegengeschenke Haruns zurückführte. Es war ein Elefant darunter, der in Italien überwintern musste, weil man ihm nicht zumuten konnte, die verschneiten Alpen zu übersteigen. Von einem anderen Juden wird erzählt, dass er auf den Wunsch des Kaisers einem Bischof, dem er einen Schabernack spielen wollte, eine mit Wohlgerüchen und Essenzen hergerichtete Maus als ein seltenes, in Judäa aufgefundenes Tier anbot und den Leichtgläubigen dahin brachte, einen Scheffel Silber dafür zu zahlen. Die jüdischen Kaufleute hatten Schutzbriefe mit Geltung für das ganze Reich und waren vom Heerbann und von anderen persönlichen Dienstleistungen befreit. Die ersten Privilegien, die die sächsischen Könige den einheimischen Kaufleuten für den Besuch ihrer Märkte erteilten, waren immer zugleich mit an die Juden gerichtet, oft so, dass die Juden den Kaufleuten vorangestellt wurden. Im Übrigen galten für die Juden die kanonischen Bestimmungen, die Gregor der Große festgesetzt hatte. Dieser hervorragende Papst hat Richtlinien für die Art, wie die Juden behandelt werden sollten, gegeben, die jahrhundertelang von seinen Nachfolgern beobachtet wurden. Allerdings hielt er sich dabei an die Gesetze, die vor ihm, im fünften Jahrhundert, von den Kaisern in Bezug auf die Juden erlassen waren: sie wurden dadurch von allen Ämtern und Würden im Staate ausgeschlossen, damit sie in die höheren Gesellschaftsklassen nicht aufsteigen könnten, Mischehen mit Christen einzugehen wurde ihnen verboten, und Todesstrafe wurde jedem angedroht, der Christen zum Übertritt verleitete. Gregor als Vertreter der christlichen Ideen hatte wohl manchen Anreiz, die Juden als Glaubensgenossenschaft anzugreifen, ihren Gottesdienst ebenso wie den heidnischen zu verbieten, allein er bewährte sich als Nachfolger der Kaiser ohne Fanatismus. Wie der Gotenkönig Theoderich es abgelehnt hatte, den Juden das christliche Bekenntnis aufzuzwingen, weil niemand wider seinen Willen zum Glauben gelange, so erlaubte ihnen auch Gregor die ungestörte Ausübung ihrer Religion. Neue Synagogen zu erbauen verwehrte er ihnen allerdings, wie die Kaiser getan hatten, nicht aber, die alten, baufälligen zu erneuern. An Hand dieser Bestimmungen fanden die Juden bei den Päpsten Schutz, wenn sie ihres Glaubens wegen angegriffen wurden, ebenso im fränkischen Reiche bei Karl dem Großen und seinen Nachfolgern. Sie genossen ein hohes Wergeld und brauchten sich dem Gottesurteil nicht zu unterwerfen, es kam sogar vor, dass sie christliche Sklaven hielten. Karl der Kahle hatte einen jüdischen Leibarzt; die schöne Begabung der Juden für die Heilkunst, die sowohl mit ihrem Scharfblick und ihrer Gabe der Einfühlung wie mit ihrer warmherzigen Neigung zu helfen zusammenhängen mag, bewirkte jederzeit, dass einzelnen Bevorzugten Vertrauensstellungen eingeräumt wurden. Der berühmte Abt von Fulda, Hrabanus Maurus, unter dessen schroffer Rechtgläubigkeit der unglückliche Mönch Gottschalk so bitter zu leiden hatte, verschmähte es nicht, sich von einem im Gesetz erfahrenen Juden über die Auslegung biblischer Bücher nach der mosaischen Tradition unterrichten zu lassen. Die Bestimmung einer Synode, wonach jeder, der aus Hass oder Habgier einen Heiden erschlage, als Mörder betrachtet werden und Kirchenbuße leisten solle, wurde von dem Abt Regino von Prüm auf die Juden ausgedehnt. Ebenso nahm Bischof Burkhard von Worms Bestimmungen zum Schutze der Juden in seine berühmte Gesetzessammlung auf. Man betrachtete die Juden nicht nur als das Volk, das Christus gekreuzigt hatte, sondern ebensowohl als das, dessen Geschichte im Alten Testament auch für die Christen die Heilige Geschichte war und dem man, in Hinblick auf seine großen Propheten und Lehrer, eine besondere Weisheit zuschrieb. Dieselbe unbefangene Duldsamkeit wie das karolingische Zeitalter charakterisiert das der Ottonen. Der Freund, der Kaiser Otto II. nach der unglücklichen Schlacht bei Cotrone in Süditalien sein eigenes Pferd zur Flucht gab, der voll Sorge dem Fliehenden nachblickte und den, da die Schiffer sich weigerten, den flüchtigen Kaiser aufzunehmen, der Zurückbleibende traurig fragte, was nun aus ihm werden solle, war ein Jude, namens Calonymus, der in Mainz zu Hause war und als ein weiser Rabbi hoch in Ehren stand. Eine andere Überlieferung erzählt, der Jude habe dem Kaiser, dessen Pferd störrisch gewesen sei, sein eigenes angeboten mit den Worten: »Wenn sie mich töten, denke an meine Kinder.« Tatsächlich gab es sowohl in Mainz wie in Lucca eine jüdische Familie namens Calonymus.
Abgesehen von einer einmaligen Vertreibung aus Mainz durch Heinrich II., haben die Juden unter den sächsischen und salischen Kaisern unbelästigt im Reiche leben können. Konrad II. hatte einen jüdischen Leibarzt. Die erste große Verfolgung brachten die Kreuzzüge mit sich, durch die fanatisierte Massen in Bewegung gesetzt wurden. Ein gelegentlicher Ausspruch, man solle doch die Feinde Christi im Lande bekämpfen, anstatt nach Palästina zu reisen, wurde wiederholt und fand Beifall in den unteren Schichten des Volkes, vollends das Wort eines angesehenen Führers, des Herzogs von Niederlothringen, Gottfried von Bouillon: er wolle das Blut des Erlösers am Blute Israels rächen und nichts übriglassen von allen, die den Namen der Juden trügen. Von den Judengemeinden in Frankreich trafen Warnungen ein vor den aufgeregten Scharen französischer, englischer und lothringischer Kreuzfahrer, die von dort nach Deutschland vordrangen, sodass sich Calonymus, der Vorsteher der Judengemeinde in Mainz, mit der Bitte um Schutz an Heinrich IV. wendete, der damals in Italien war. Dem Gesuch willfahrend, befahl der Kaiser allen Bischöfen, Fürsten und Grafen des Reichs, auch Gottfried von Bouillon, die Juden zu beschützen, ihnen beizustehen und Zuflucht zu gewähren, damit keiner sie anrühre, ihnen Böses zu tun. Alle gehorchten, ohne doch das nahende Unheil aufhalten zu können. Die Juden fühlten sich offenbar im Schutze des Kaisers und in der durchaus nicht unfreundlichen Gesinnung der Bürger so sicher, dass sie von der Wut des Überfalls wehrlos überrascht wurden. Es kam vor, dass Juden erschlagen wurden, die friedlich in ihrem Weinberg arbeiteten. In Speyer allerdings, wo die Kreuzfahrer zuerst einbrachen, verhinderte der Bischof Johannes, ein treuer Anhänger des Kaisers, durch strenges Eingreifen großes Unglück: den Bürgern, die sich an den Gewalttaten der Fremden beteiligt hatten, ließ er die Hände abhauen. Nur elf Juden wurden in Speyer getötet. In Worms dagegen, wo der Bischof untätig blieb, sollen an 800 niedergemacht sein, noch mehr in Mainz, wo Erzbischof Ruthard eine nicht ganz aufgeklärte, zweideutige Rolle spielte. Er versprach denen, die dem Blutbade entronnen waren, dem Vorsteher Calonymus und 53 Gefährten, Schutz in seiner Pfalz, wollte aber nachträglich sein gegebenes Wort nur gelten lassen, wenn sie sich taufen ließen. Die Juden, edler gesinnt als der Bischof, zogen vor zu sterben. In Köln verbargen sich die Juden in den Häusern ihrer christlichen Freunde, ein Beweis für das gute Einvernehmen zwischen Juden und Bürgern, und erhielten dadurch ihr Leben, während ihre Häuser geplündert wurden. Um sie noch besser schützen zu können, brachte sie dann der Erzbischof in Burgen auf dem Lande unter; aber diese augenscheinlich in guter Meinung vollzogene Maßnahme erwies sich als unglücklich, denn ein Teil wurde dort von den Verfolgern aufgespürt und getötet. Dass dieser Angriff auf die Juden nicht etwa durch Abneigung gegen die Rasse, sondern durch erhitzten Glaubenseifer verursacht war, geht daraus hervor, dass denjenigen Juden, die sich taufen ließen, nichts zuleide getan wurde. Zum Glaubenshass kam die Raublust der armen und bereits verwilderten Banden; Raublust war vermutlich auch die Triebfeder der Stadtbewohner, die mit jenen gemeinsame Sache machten. Das waren aber nur einzelne, im Allgemeinen standen die Bürger wie die Fürsten auf seiten der Angegriffenen. Der Kaiser ging so weit, den Juden zu gestatten, dass die Zwangstaufe, die an verschiedenen vollzogen war, nicht gelten solle, sondern dass sie wieder nach dem Gesetz leben dürften, ein Zugeständnis, das den Papst erzürnte. Als Heinrich gegen das Ende seines Lebens in Mainz einen Landfrieden beschwören ließ, zählte er die Juden unter denen auf, die besonderen Schutz genießen sollten. Beim nächsten Kreuzzug, den Bernhard von Clairvaux anregte, ging die Gefahr für die Juden wiederum von den unteren Schichten aus. Ein Mönch, namens Radull, hetzte zum Judenmord auf und hätte mit Hilfe räuberischen Pöbels ein großes Blutvergießen angerichtet, wenn ihm nicht Bernhard entgegengetreten wäre. Er hielt aufklärende Predigten und erließ ein Rundschreiben, in dem er auseinandersetzte, wie sich Christen gegen Juden zu verhalten hätten. Man dürfe, sagte er, die Juden weder töten noch vertreiben; denn, dies setzte er aus eigener Auffassung hinzu, sie würden sich beim Herannahen des Jüngsten Gerichtes bekehren. Den Wucher der Juden erwähnte er nicht ohne hinzuzusetzen, dass die Christen da, wo es keine Juden gäbe, den Wucher noch ärger trieben. Infolge der hochherzigen Bemühungen unterblieben die Verfolgungen, sodass die Vorkehrungen der jeweiligen Stadtherren zum Schutze der Bedrohten sich als überflüssig erwiesen.
Damals, zurzeit des zweiten Kreuzzuges, in der Mitte des zwölften Jahrhunderts, hatten die Juden sich bereits vorzugsweise dem Geschäft der Geldleihe zugewendet, und die Tatsache, dass es viele Menschen gab, die den Juden verschuldet waren, konnte den Antrieb bilden, Gläubiger unter dem Vorwande, sie seien Feinde Christi, zu ermorden, womit man seine Verhältnisse geordnet und sich zugleich ein Verdienst bei Gott und den Menschen erworben hätte. Dies Motiv trat aber in jener Zeit noch nicht sehr hervor, teilweise deshalb nicht, weil diejenigen Kreise, die den Kredit der Juden benützten, sie eher zu schützen suchten als mordeten, hauptsächlich aber, weil die Haltung eines Volkes immer von denjenigen bestimmt wird, die an der Spitze stehen. Ob es sich um eine Schule, eine Stadtgemeinde, eine Kirchengemeinde oder ein Land handelt, die Großmut oder Niedrigkeit, die Überlegenheit oder Beschränktheit des Führers wird den Charakter der Gruppe, des Landes bestimmen. Die Päpste des zwölften Jahrhunderts hielten immer noch, trotz ihrer veränderten Stellung zum Kaisertum, an den Bestimmungen Gregors I. über das Verhalten gegen die Juden fest, ja sie übertrafen ihren großen Vorgänger zuweilen noch an Milde. Sie blieben dabei, dass die Juden nicht zwangsweise getauft, nicht verwundet oder beraubt werden, keine Veränderung ihrer guten Gewohnheiten erleiden sollten. Man solle sie, verordneten sie, bei ihren Festen nicht stören, ihre Begräbnisplätze nicht beschädigen. Es versteht sich, dass die Päpste von den Juden stets mit scharfer Abneigung als von den Feinden des christlichen Glaubens sprachen, aber das hinderte sie nicht, bei Verfolgungen sich nachdrücklich für sie einzusetzen, wie sie es auch nicht, sowenig wie alle anderen Kirchenfürsten, hinderte, sich in Geldgeschäfte mit ihnen einzulassen. Von Gregor VII., dem großen Gegner Heinrichs IV., ist behauptet worden, ohne dass es im Geringsten bewiesen werden könnte, er stamme von Juden ab; jedenfalls hat er sich von der jüdischen Familie Pierleone in Geldangelegenheiten beistehen lassen, derselben Familie, aus welcher der Papst Anaklet hervorging. Der Getaufte durfte Papst sein, ohne dass jemand daran Anstoß genommen hätte; nicht das Blut, nur der Glaube wurde bekämpft. Ebenso wie die Päpste und noch eindeutiger gaben die Hohenstaufenkaiser das Beispiel der Duldung. Friedrich I. erneuerte das Privileg Heinrichs IV. für die Juden in Worms, wodurch sie reichsunmittelbar wurden, und Friedrich II. dehnte es auf alle Juden im Reich aus; doch ist anzunehmen, dass schon sein Großvater es in diesem Sinne auffasste. Als der alte Kaiser den Kreuzzug beschloss, fürchteten die Juden, in Erinnerung an die früheren Kreuzzüge, Angriffe auf Freiheit und Leben; allein auf dem großen Reichstage zu Mainz, wo die Judenfrage besprochen wurde, trafen Friedrich I. und sein Sohn Heinrich, der spätere Kaiser, Anordnungen zu ihrem Schutze. Mit strengen Strafen wurden alle bedroht, die sich an einem Juden vergreifen sollten; wer einen verwunde, dem sollte die Hand abgehauen werden, wer einen umbringe, sollte umgebracht werden. In einem Privileg Friedrichs für die Regensburger Juden stehen die schönen Worte: »Es ist die Pflicht der kaiserlichen Majestät, vom Recht wird es gebilligt und von der Vernunft gefordert, dass sie jedem unserer Getreuen, nicht nur den Vertretern der christlichen Religion, sondern auch denen, die, von unserem Glauben abweichend, nach den von ihren Vätern überlieferten Gebräuchen leben, das, was ihnen zukommt, nach Maßgabe der Billigkeit erhalten, ihren Gewohnheiten Dauer, ihren Personen und Gütern Frieden gewähren.« Dem Vorwurf, der in dieser Zeit zuweilen gegen die Juden erhoben wurde, als töteten sie christliche Kinder, um sich ihres Blutes bei gewissen religiösen Riten zu bedienen, standen sowohl Päpste wie Kaiser misstrauisch gegenüber. Sie durchschauten den Vorwand blutgierigen oder leichtgläubigen Pöbels, und es ist bemerkenswert, dass der Papst sich nicht bewegen ließ, den kleinen Werner von Bacharach, der in dieser Weise ums Leben gekommen sein sollte, und dessen Gedächtnis eine in ihren Resten noch immer den Beschauer entzückende Kirche gewidmet wurde, heiligzusprechen. Friedrich II. ließ es sich nicht nehmen, einen Ritualmord, der in Fulda vorgekommen sein sollte, gründlich zu untersuchen. Der Leichnam des angeblich von Juden getöteten Kindes wurde nach Hagenau gebracht, wo der Kaiser sich eben aufhielt. Um die Frage grundsätzlich zu lösen, bat er die Könige Westeuropas, ihm getaufte Juden zu schicken, die des Gesetzes kundig wären, von denen er annahm, dass sie ihn ohne Vorurteil unterrichten würden. Sie wiesen auf die Vorschriften des Talmud hin, wonach den Juden sogar die Befleckung mit Tierblut verboten sei, und lehnten damit die Beschuldigung ab. Daraufhin sprachen die Reichsfürsten auf einem Reichstage zu Augsburg im Jahre 1236 die Juden von Fulda und andere Juden völlig frei; die Urkunde über das Urteil wurde den Juden zugestellt. Ein Jahrzehnt später erklärte Papst Innocenz IV. in einem Sendschreiben die Beschuldigung des Ritualmordes für verleumderisch, für einen Vorwand zu Gelderpressungen, und wies die deutschen Bischöfe an, ungerechte Behandlung der Juden nicht zu dulden. Der klare Äther, der das Hohenstaufentum umflammte, zehrte die Dünste, die sich im Schlamme niedriger, verwilderter Begierden bildeten, auf, sodass sie sich nicht verderbend ausbreiten konnten. Mit seinem Untergang erlosch auch diese Klarheit.