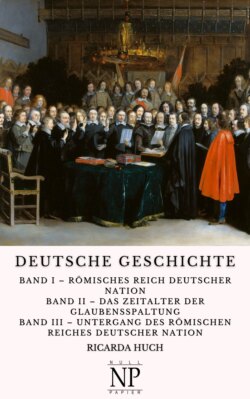Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Städte
ОглавлениеAls Barbarossa Herzog Heinrich von Sachsen bekämpfte, zog er vor Lübeck und forderte es auf, sich ihm zu unterwerfen. Da die Stadt zu Wasser und zu Lande eingeschlossen und Entsatz nicht zu hoffen war, baten die Bürger den Kaiser, er möge ihnen gestatten, den Herzog, ihren Herrn, zu fragen, was sie tun sollten. Vielleicht in Rücksicht auf das Ansehen ihres Bischofs Heinrich, der ihre Bitte vortrug, vielleicht auch in Rücksicht auf die Bedeutung der Stadt selbst, nahm der Kaiser das treuherzige Ansinnen gnädig auf, wenn er auch nicht unterließ, es als Anmaßung zu bezeichnen. Der Herzog stand dem Kaiser an Billigkeit nicht nach; er erteilte Lübeck die Erlaubnis, zum Kaiser überzugehen. Jubelnd begrüßten die Bürger den Kaiser, als er einzog, und das war nicht Wankelmut des Pöbels, der jede Fahne beklatscht; denn der Kaiser war ja der Herr aller, insbesondere der Herr der Märkte, war der Herr, dessen Herrschaft Freiheit bedeutete. Der König konnte und wollte nicht alle Städte selbst verwalten, es genügte ihm, wenn sie ihm, dem stets Geldbedürftigen, die regelmäßigen Zahlungen leisteten. Selbstverwaltung und eigene Gerichtsbarkeit, das war es, was alle Städte erstrebten; hatten sie es dahin gebracht, die hohe Gerichtsbarkeit, den sogenannten Blutbann, an sich zu bringen, so war die Reichsunmittelbarkeit vollendet, die Stadt war ein sich selbst regierender Staat im Staate geworden. Lag die Stadt nicht von vornherein auf königlichem Grund und Boden, so konnte das Ziel nur allmählich erreicht werden, bald in Kämpfen, bald mit Schmiegen und Beugen. Lübeck ließ sich, als Heinrich der Löwe während der Abwesenheit Barbarossas zurückblieb, seine Herrschaft wieder gefallen und bequemte sich auch unter die Herrschaft König Waldemars II. von Dänemark. Friedrich II. war so sehr in erster Linie König von Italien, dass er der Ausbreitung der dänischen Macht im Norden des Reiches nicht nur nicht entgegentrat, sondern sich damit einverstanden erklärte. Er trat dem dänischen König das allerdings von demselben bereits eroberte Nordalbingien, die Lande jenseits der Elbe und Weser, ab, ausdrücklich betonend, keiner seiner Nachfolger oder der Fürsten des Römischen Reiches dürfe wegen dieser Gebiete, weil sie früher einmal dem Römischen Reiche untertänig gewesen wären, den »viellieben Herrn König Waldemar« beunruhigen. Die Wiedergewinnung dieses so wichtigen Küstenlandes geschah ohne Friedrichs Zutun durch den Grafen Heinrich von Schwerin, dem ein köstlicher Fang glückte: er nahm den Dänenkönig in seinem eigenen Land und Zelt gefangen. Die Schicksalsgunst nützte Friedrich aus, indem er als Bedingung von Waldemars Befreiung Rückgabe Nordalbingiens, ein ungeheueres Lösegeld und den Vasalleneid verlangte; aber erst dem Grafen von Schwerin, dem beherzten kleinen David, gelang es, in den Schlachten bei Mölln und Bornhövede 1225 und 1227 den mächtigen Gegner zu besiegen und das Land wirklich zurückzuerobern, vom Herzog von Sachsen und Grafen von Schaumburg unterstützt. Lübeck, das in der Schlacht bei Bornhövede, der Überlieferung nach unter seinem Bürgermeister Alexander von Soltwedel, tapfer mitkämpfte, hatte schon vorher, sowie es von den Dänen befreit war, Gesandte nach Italien an den Kaiser geschickt, um sich die von Barbarossa verliehenen Privilegien bestätigen zu lassen. Vermutlich beraten von seinem Freunde Hermann von Salza, der die mächtig erblühende Stadt am Baltischen Meer in seine Ostseepläne einbezog, unterzeichnete Friedrich im Jahre 1226 die kostbare Urkunde, die die Grundlage von Lübecks Reichsfreiheit wurde: Concedimus firmiter statuentes ut predikta civitas Lubiciensis libera semper sit – Wir gewähren der Stadt Lübeck, dass sie immer frei sei.
Grundsätzlich begünstigt hat keiner der Hohenstaufen die Städte, und das lag auch nicht in ihrem Interesse. Abgesehen davon, dass die Städte damals erst aufstrebende Mächte waren, musste der Kaiser auf die Fürsten Rücksicht nehmen, die seine Wähler waren und die ihm die Mannschaft für seine Feldzüge nach Italien lieferten. Er konnte nicht wohl die Städte in ihren häufigen Kämpfen gegen die Bischöfe, wo sie meist dem Buchstaben nach Rebellen waren, unterstützen. Dazu kam, dass die Kaiser selbst aus dem Fürstenstande stammten und in den Fürsten die Ebenbürtigen sahen. Wenn sie auch einzelne hart bekämpften, so mussten sie doch einer zustimmenden Mehrzahl gewiss sein, und auch der Bekämpfte und Geächtete wurde, sowie er sich unterwarf, wieder in Gnaden aufgenommen als ein Gleicher. Während Heinrich VI. auf dem Wege war, das Kaisertum erblich zu machen, hat Friedrich II. die Unabhängigkeit der Fürsten gesetzlich verstärkt, die der Städte gemindert. In den bischöflichen Städten verbot er den Bürgern, einen Rat zu bilden, und den Handwerkern, sich in Einungen zusammenzuschließen, worauf die städtische Selbstständigkeit zum größten Teil beruhte. Die despotisch-zentralistische Richtung, die der Kaiser in Italien verfolgte, ließ er in Deutschland, soweit es da möglich war, gleichsam durch die Fürsten vertreten, was sich denn zwar auch gegen ihn selbst richten musste; doch war er ein zu guter Staatsmann, um nicht gelegentlich, wenn es nützlich schien, auch die Städte zu fördern. Wölflin, sein großer Landvogt im Elsaß, hat dort gewiss nicht ohne seine Billigung viele Städte, darunter Kolmar und Schlettstadt, gegründet.
Bis in die Zeit der Hohenstaufen war die Geschichte der Deutschen wesentlich eine Geschichte des Adels. Der König und seine Umgebung, die Fürsten, Grafen und Ritter, die Bischöfe, Äbte, Mönche und Nonnen gehörten dem Adel an. Von den Söhnen und Töchtern des Adels wurde immer ein Teil irgendeinem Benediktinerkloster gelobt, und das Standesbewusstsein hätte nicht gelitten, dass sie in eine andere als ebenbürtige Gesellschaft eingetreten wären. In manchen Klöstern, wie zum Beispiel in Sankt Emmeran, Obermünster und Niedermünster zu Regensburg, gehörten die Äbte und Äbtissinnen dem Reichsfürstenstande an.
Die Päpste haben wohl verschiedentlich gegen diese Ausschließlichkeit geeifert, und einige Orden, namentlich die Cisterzienser und Franziskaner, nicht deutschen Ursprungs, haben sie durchbrochen und ein demokratisches Element in die Kirche eingeführt. Aber sie führten es nur in die Kirche ein; innerhalb der Weltlichkeit waren es die Städte, durch die in die glanzvolle, schwertklirrende, erhabene Geschichte des deutschen Adels eine neue Kraft eindrang, die Freiheit. Die Adligen waren die Freien, Adel und Freiheit fielen zusammen, sie brauchten die Freiheit nicht zu betonen, so ähnlich, wie Adlige untereinander den Adelstitel weglassen. Das bewusste Erleben der Freiheit, die Freiheit als Befreiung, als Losung, als Ideal brachte die Stadt. Nicht als ob nicht die Menschen in der Stadt auch Deutsche mit lebhaftem Standesgefühl gewesen wären. Niemand dachte an Gleichheit. Die das städtische Leben beherrschenden Familien waren frei, ritterbürtig, vermischten sich nicht mit den Handwerkern, die an der Regierung und Verwaltung der Stadt keinen Anteil hatten. Die städtischen Handelsherren und Gutsbesitzer nahmen an den Turnieren der Ritter teil und gingen mit dem Landadel eheliche Verbindungen ein, waren ebenso hochmütig wie jener, wenn auch, besonders in späterer Zeit, zuweilen der Landadel dem Stadtadel die Ebenbürtigkeit absprach. Trotzdem bildete sich in den Städten allmählich ein neuer Stand, eine neue Kultur, die von der aristokratischen und klerikalen verschieden waren, der Stand und die Kultur des Bürgers. Insofern Gutsbesitzer, Kaufleute, Handwerker, Ackerbauer eine Stadt bewohnten, bildeten sie eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame Aufgabe hatte, ihre Arbeit, ein gemeinsames Interesse, die Erhaltung von Frieden und Recht, die ihre Arbeit ermöglichte, einen gemeinsamen Gegensatz gegen die Fürsten und den Adel, die Frieden und Recht so häufig störten. Wie auch der in den Städten herrschende Stand, den man später Patrizier nannte, die Handwerker verachten mochte, Handwerk und Handel erzeugten den Wohlstand der Stadt durch Arbeit. Das Selbstgefühl des Bürgers beruhte nicht so sehr oder nicht allein auf dem Standesbewusstsein und auf dem Schwert, sondern auf der eigenen Kraft in der Arbeit, im Werk. Dass Stadtluft frei mache, konnte man nicht nur sagen, weil der Hörige, der in die Stadt zog, wenn er nach Verlauf eines Jahres von seinem Herrn nicht zurückgefordert war, frei wurde, sondern auch weil der Gedanke hier einen freieren Flug nahm. Im Wesen des Geldes liegt es, frei zu machen; unmittelbar, weil mit Geld den Bischöfen und Fürsten, die Geld gebrauchten und nicht hatten, ihre Rechte abgekauft werden konnten, mittelbar, weil auf der Grundlage des Besitzes Bildung erworben und Vorurteile überwunden werden können, und andererseits, weil durch die Beweglichkeit des Geldes ein rascher Wechsel von Reichtum und Armut möglich wird und dadurch der Unwert von Geld und äußerem Ansehen und der Wert der Persönlichkeit vor Augen geführt wird. Die wohltätige Macht des Geldes, die eigentümlichen Vorzüge der Stadt entfalteten sich am reichsten in den Jahrhunderten, wo die Städte zwar durch Mauern, aber nicht durch ihren Charakter entschieden vom Lande getrennt waren. Noch im 13. und 14., ja noch im 15. Jahrhundert glichen die Städte sehr dem Dorf. Es war nicht so, dass steinerne Häuser und steinernes Pflaster die Erde verdeckten: mitten in der Stadt rauschten die Eichen und dufteten die Linden, die Kühe trabten in ihre Ställe und die Schweine grunzten über die schmutzigen Straßen. Neben wenigen Häusern aus Stein standen strohgedeckte Hütten aus Lehm und Holz. Nicht selten kam es vor, dass Dörfer in die Städte einbezogen wurden, die noch lange dorfähnlich blieben. Draußen vor den Mauern erstreckten sich Gärten und Äcker, deren Besitzer Bürger waren, die sie bebauten. Ebenso wie der Bürger bäuerliche Art behielt, so behielt er auch ritterliche. Die Geschlechter waren beritten, die Handwerker kämpften zu Fuß, jeder hatte Wehr und Waffen und war darin geübt. Die Handwerker bildeten den Kern des städtischen Heeres, das der Bürgermeister anführte; sie waren kriegerisch, ungestüm, ja grausam im Kampf, wie irgendein Ritter. Der Unterschied war der, dass die Bürger, die im Allgemeinen friedliebend waren, nur zur Verteidigung ihrer städtischen Freiheit Krieg führten. Die den Fürsten unterworfenen Landstädte bedangen sich, wenn sie unabhängig genug waren, aus, nur so weit Kriegsfolge leisten zu müssen, dass sie abends wieder hinter ihren Mauern sein konnten. Der Bürger wurde zu einem runderen, vielseitigeren Menschen, als die anderen waren; in ihm mündeten die vereinzelten Kulturströmungen, bis schließlich das Ideal des vollendeten, des humanen Menschen entstand, der frei aus den Schranken des Standes, der Nation, der Konfession hervortritt, aber doch gebunden bleibt durch das Gefühl und Bewusstsein der Menschlichkeit.
Noch immer gab es Klöster im Reiche, die die Wissenschaft pflegten, und solche, die die Wildnis kulturfähig machten, Klöster, in denen die unverheirateten Töchter des Adels sich in die Geheimnisse Gottes versenkten, kunstvolle Stickereien ausführten, fromme Betrachtungen niederschrieben. Andere Klöster erregten durch Ausgelassenheit oder Faulheit Ärgernis, und auch die besten waren nicht mehr die einzigen Sterne, von denen Licht und Wärme ausgingen. Der Wanderer, der im 12. und 13. Jahrhundert durch das Reich pilgerte, fand Schutz und Herberge in den Städten. Zu den alten Römerstädten am Rhein und an der Donau, zu den von den Ottonen gegründeten Städten am Rande des Harzes waren viele neue gekommen. Nachdem die großen Städtegründer, die Zähringer und Heinrich der Löwe, das Beispiel gegeben hatten, als die Fürsten gesehen hatten, welche Vorteile sich aus verkehrsreichen Plätzen ziehen ließen, beeiferten sich alle, in ihrem Gebiet schon bestehende Ansiedelungen zu Städten zu erheben oder neue anzulegen. Die Städte waren sehr klein, manche nicht viel größer als ein einzelnes großes Kloster. Sie hatten etwa 3000 bis 4000 Einwohner, die größten nicht mehr als 15 000 oder 20 000. Manche bestanden aus einem alten Dorf, mit dem ein Markt verbunden wurde, manche aus mehreren Siedelungen, die allmählich durch Mauern zu einem Ganzen verbunden wurden. Die Stadt Braunschweig zum Beispiel bestand aus fünf Städten: der ursprünglich dörflichen Alten Wiek, der Altstadt, dem von Heinrich dem Löwen gegründeten Hagen, der Neustadt und dem Sack. Jede von ihnen hatte ihren Bürgermeister, ihr Rathaus, ihre Kirchen. Den Mittelpunkt aller Städte, wenn auch nicht immer den topografischen, bildete der Markt, ihr Herz, wo die Verkehrsadern ausgingen und mündeten. Dort wurden Lebensmittel und andere Waren zum Verkauf ausgelegt. Er war umrahmt vom Rathaus, von den vornehmsten Gildehäusern und den Häusern der reichen Kaufleute; zuweilen gliederte auch das Rathaus, mehr oder weniger in der Mitte liegend, den Platz. Der Rechtsschutz, der vom König den Kaufleuten, die den Markt besuchen wollten, verliehen wurde, stellte den Markt unter Königsfrieden, machte ihn zu einer Stätte, wo ohne Verzug Recht gesucht und gefunden werden konnte. Der rechtliche Charakter des Marktes wurde durch ein Kreuz bezeichnet, wie sich ein solches noch auf dem Markt in Trier befindet; es ist von einer Granitsäule getragen und zeigt in der Mitte das Gotteslamm. Später symbolisierten den Rechtsgedanken im Norden des Reichs die seltsamen Rolandsfiguren, die, sollten sie auch mit anderer Bedeutung entstanden sein, im höheren Mittelalter als Sinnbild der Rechtshoheit der Stadt angesehen wurden. Wenn ein Fürst sich eine freie Stadt unterwarf, pflegte er wohl den Roland zu zerschlagen, zum Zeichen, dass nur er, nicht mehr die Stadt, Gerichtsherr sei. Die steinernen Riesen in Zerbst, Halberstadt, Bremen, Ritter mit edlem lockigem Haupt, die das Schwert gerade aufgerichtet in der Hand halten, stammen aus dem 15. Jahrhundert und sind Nachbildungen älterer Figuren aus Holz, die bei einem Brand oder sonst zugrunde gegangen waren. Zuweilen fanden Hinrichtungen vor dem Rolandsbilde statt. Die Gerichtssitzungen wurden anfangs unter freiem Himmel abgehalten, später, als es Ratäuser gab, unter den offenen Lauben derselben und noch später in einem Saal im Innern des Hauses. Das älteste erhaltene Rathaus soll das der Unterstadt von Gelnhausen sein; es ist ein schlichter romanischer Bau, von dem man annimmt, dass er im Jahre 1170 entstanden ist. Während die Marktplätze der alten gewachsenen Städte sehr verschiedenartig, malerisch gegliedert sind, hat die Regelmäßigkeit der östlichen Kolonialstädte, die alle nach dem gleichen Muster angelegt sind, zuweilen etwas Ödes. Wie schön auch diese sein können, beweisen die Märkte von Breslau, imponierende saalartige Plätze, deren einer durch die fabelhafte Pracht des Rathauses belebt wird. Eine unerschöpfliche Erfindung hat im Norden, Süden, Osten und Westen des Reichs Ratäuser von verschiedenartigem Reiz aufgerichtet. Wie ein wohllautender Reim der Pfarrkirche Sankt Martin gegenüber umrandet das Braunschweiger Altstadt-Rathaus die Ecke des Platzes, zierlich und schnurrig ist das von Osterode am Harz, das von Michelstadt im Odenwalde, fantastisch prächtig sind die nordischen Ziegelbauten von Stralsund, von Tangermünde, bäuerlich behäbig die schwäbischen und fränkischen Fachwerkhäuser. Im Inneren führen schöngeschwungene Holztreppen zu den Sälen, wo die Ratsmänner tagen, wo bald die Täfelung der Wände wohnliche Stimmung, bald Malerei das Gefühl erhabener Feierlichkeit verbreitet. Die Ratäuser, deren Schönheit wir jetzt bewundern, sind ebenso wie fast alle die Wohnhäuser, die erhalten sind, erst um die Wende des 15. Jahrhunderts oder später errichtet. Im heroischen Zeitalter der Städte waren die meisten Häuser niedrig, eng, mit Stroh gedeckt, nur einige Reiche und Mächtige bauten sich steinerne, turmartige Häuser, in denen sie das recht hatten, sich mit den Waffen zu verteidigen, sodass das Wort galt: mein Haus ist meine Burg. Kunst und kostbare Ausstattung wurden verschwenderisch auf die Kirche verwendet, das Haus Gottes und das Haus aller Bürger. Die Pfarrkirche lag gewöhnlich etwas abseits vom Markte, aber so, dass die Türme den Platz beherrschen; der Lärm des Verkehrs soll die Andacht nicht verwirren. Schauerliches Schweigen, kühle Dämmerung, in die es glühend tropft aus den bunten Fenstern, umfängt den Beter. Von den Pfeilern blicken die großen Heiligen, die kämpften und litten und nun in ewiger Glorie wohnen, ringsherum liegen die Toten, Söhne der Stadt, ruhend von ihrer Arbeit. Hier beginnt das Drüben, wo alle Rätsel gelöst, alle Sünden getilgt, alle Tränen getrocknet werden. Vom Turm läutet die Glocke, die der städtische Meister gegossen hat; jeder Bürger kennt ihre Stimme wie die Stimme einer Mutter. Weiter entlegen vom Markt steht in den größeren Städten der Dom, die Kirche des Bischofs, und stehen in fast allen die Kirchen der Franziskaner und Dominikaner.
Wenn der Kaiser seine Reichsstadt besucht, wird er zuerst in die Kirche geführt, abends vielleicht in ein Gildehaus oder in das Hochzeitshaus, wo er mit den schönen Bürgersfrauen tanzt und mit den Ratsmännern trinkt. Bei einem besonders angesehenen und wohlhabenden Bürger stieg er ab; Ludwig der Bayer wohnte in Nürnberg bei Heinrich Weigel auf dem Milchmarkt oder bei Albrecht Ebner auf dem Salzmarkt.
Einen großen Raum bedeckte das Spital mit den dazugehörigen Gebäulichkeiten. Es war fast immer dem Heiligen Geist geweiht; die Leitung stand entweder bei der Geistlichkeit und der Stadt zusammen oder bei der Stadt allein. Es nahm Kranke, Arme, Wöchnerinnen, alte Leute, Pilger, Wanderer auf und beherbergte sie je nach den Umständen für einige Nächte oder für Lebenszeit. Gewöhnlich war das Spital sehr reich; es besaß Dörfer, die regelmäßige Abgaben leisteten, aber auch einzelne Höfe und Gerechtsame, und es verfügte über Stiftungen, infolge welcher die Insassen an gewissen Tagen weißes Brot oder Wein und Bier oder Bäder erhielten. Einige Herren aus dem Rat hatten die Verwaltung des Spitals zu überwachen. Das Leprosenhaus, das dem heiligen Georg geweiht war, pflegte der Ansteckung wegen vor den Toren zu liegen; mit ihm war wie mit dem Spital eine besondere Kirche oder Kapelle verbunden.
Nicht nur die Krankenpflege nahm die Stadt der Kirche ab, sondern auch die Armenpflege, wenn auch die der Kirche weder ganz ausgeschaltet noch entbehrt werden konnte. Obwohl die Zünfte ihre Mitglieder nicht verelenden ließen, so gab es doch in den Städten sehr viel Arme; denn nicht alle Handwerker waren in Zünfte zusammengefasst, und außerdem gab es Tagelöhner und eine Menge anderer Leute ohne bestimmten Beruf und regelmäßige Einnahme. Manche wurden in den Spitälern versorgt, manchen kamen Stiftungen zugute, die die wohlhabenden Bürger reichlich zu Lebzeiten oder im Testament anordneten. Die regierenden Familien fühlten sich sowohl für die Ordnung wie für die Verwirklichung der sittlichen Forderungen in ihrer Stadt verantwortlich. Die Kirchenväter hatten einst die großartige Auffassung vertreten, man solle nicht sagen, es seien nur die würdigen Armen zu unterstützen; denn die Armut sei es eben, die würdig mache. Dies göttliche Allerbarmen konnte wohl von der Kirche und von einzelnen, nicht von einer Stadtverwaltung geübt werden. Ihr kam es hauptsächlich auf Ordnung an, der zuliebe mit den sie Störenden nicht viel Federlesens gemacht wurde. Mit den einheimischen Armen wurde man einigermaßen fertig, lästiger war das von auswärts zuströmende Gesindel, das sich bedenklich vermehrte, als das Ostland aufhörte, Kolonisten an sich zu ziehen. Um die Heimatlosen wenigstens christlich zu bestatten, wenn sie starben, bildeten sich in den Städten Elenden-Bruderschaften. Im Jahre 1313 stiftete Bischof Albert von Halberstadt ein Grundstück für einen Friedhof, auf welchem, wie es in der Urkunde heißt, alle die Schwachen, Armen, Heimatlosen, die von Krankheiten heimgesucht und verlassen auf der Straße lagen, menschlichen Trostes beraubt, ruhen sollten. In Frankfurt am Main wurde im Jahre 1315 die erste Herberge für Landstreicher gegründet. Das fragwürdige Volk, das nicht ansässig war, wurde von Zeit zu Zeit aus der Stadt verjagt. Die Justiz war schnell und hart, ein geringer Diebstahl wurde oft mit dem Tode bestraft. Vielleicht aber war ein schneller Tod am Galgen oder durch das Schwert dem Verfaulen im Turm vorzuziehen. Dort ließ man wohl Unverbesserliche aus den regierenden Familien verschwinden. Im Allgemeinen wurden die angesehenen Personen, wenn sie sich schwer vergangen hatten, im eigenen Hause in Haft gehalten. Ein eigentliches Gefängniswesen gab es nicht.
Umschlossen war die Stadt von der Mauer, die, wenn sie auch nicht von Anfang an zum Wesen der Stadt gehörte, doch ihr Wesen besiegelte. Sie rundete die Teile der Stadt zu einer Einheit ab, legte einen Gürtel um die Nachbarn, schirmte sie vor den Feinden draußen, verbürgte ihnen die Sicherheit, ohne die der friedliche und freie Charakter der Stadt sich nicht hätte entfalten können. Sie verlieh der Bürgerschaft das Gefühl der Unverletzlichkeit, das dem einzelnen Ritter sein Harnisch gab. Ehe die Städte frei waren, erstrebten die Bürger das Recht, die Mauern zu verteidigen, und wenn sie das besaßen, hatten sie schon die Hand auf die Freiheit gelegt. Ihrer Aufgabe, die Stadt vor Überfall oder Eroberung zu schützen, haben die Mauern in erstaunlich hohem Grade genügt. Unzählige Male haben sich Heere von Königen und Fürsten vor einer Stadt verblutet, fast immer mussten sie nach schweren Verlusten die Belagerung aufgeben. Wie stolz die Bürger auf ihre Mauer waren, zeigte sich nicht nur in der Sorgfalt, mit der ihr Zustand überwacht wurde, sondern auch in der das Auge erfreuenden Ausgestaltung. Die Türme, die die Mauer in gewissen Abständen durchbrachen, dienten dem Zweck der Verteidigung, und dass sie einen marschähnlichen, heroischen Rhythmus erzeugten, ist nur ein zufälliges Ergebnis; aber der Baumeister bemühte sich, auch in die Gestaltung der Türme Abwechslung zu bringen, und schmückte sie mit Wappen, Adlern, Kaiserbildern, Sprüchen. Mit besonderem Schwung gestaltete und schmückte man die Tore. Sie verkündeten dem Bürger, der seine Kühe aus- und eintrieb, dem Kaufmann, der seine Waren einführte, dem Feind, der die Stadt erstürmen wollte, dem Fürsten, der sie besuchte, dass hier eine mächtige Herrschaft beginne, die zu schützen, zu strafen und sich zu wehren wisse. Draußen dicht an der Mauer waren die Mühlen, ein wertvoller Besitz der Stadt, dann kamen Gärten, Äcker und Weiden, die wiederum durch eine Verschanzung geschützt waren. Die Dörfer in der Runde bildeten das nächste, sichere Absatzgebiet für die Waren der Stadt und mussten ihre Produkte auf die Märkte der Stadt bringen.
Das teuerste, bestgehütete Besitztum der Stadt waren ihre Privilegien von den Landesherren, ganz besonders die der Kaiser, auf denen die Reichsfreiheit beruhte. Es kamen Zeiten, wo die Leistungen der Reichsstädte fast die einzige sichere Einnahme des Kaisers ausmachten; auf ihre Anhänglichkeit konnte er immer rechnen. Im Gegensatz zu Fürsten und Rittern nannten sie sich wohl kurzweg das Reich. Ihnen gehörte der Kaiser in einer besonderen Weise, das prägten sie in Symbolen, Wappen, Fahnen allen Augen sichtbar aus. An einem Kronleuchter im Rathaus zu Goslar war der Vers angebracht: »O Goslar, du bist zugetan – Dem heiligen Römischen Reiche – Sonder Mittel und Wahn – Du kannst davon nicht weichen.« Über dem Ostentor in Dortmund stand: »Dus stat ist vry – Dem Riche holt – Verkoept das nicht umb alles Golt.« Ein Edelknecht des Burggrafen von Nürnberg, der mutwillig ein Adlerbild am Tore der Stadt Rothenburg beschädigt hatte, wurde hingerichtet; so heilig hielt man das kaiserliche Zeichen. Bei den häufigen Kämpfen zwischen Papst und Kaiser brachte die innige Beziehung der Städte zum Kaiser einen Gegensatz zur Kirche mit sich. In den Bischofsstädten bestand dieser Gegensatz ohnehin durch das Bestreben, sich von der Herrschaft des Bischofs frei zu machen, der noch dazu häufig zum Papst anstatt zum Kaiser hielt. Dem Kaiser zuliebe trotzten die Städte sogar dem Interdikt. Es war den Stadtbewohnern nicht gleichgültig, wenn die magische Hülle von Glockenklang und Gebet, die sie umschirmte, zerfiel, und ihre Giebel nüchtern und stumm in die Tageshelle starrten; sie wollten den Gottesdienst nicht missen, gaben aber deshalb nicht nach, sondern befahlen ihren Geistlichen, entweder ihn zu versehen oder die Stadt zu verlassen. Wie fest das Band zwischen dem Kaiser und den Städten war, zeigte sich zurzeit Ludwigs des Bayern, wo die ihm anhangenden dem Kirchenbann verfielen. Damals wurde der Erzbischof von Magdeburg im Kerker mit eisernen Stäben totgeschlagen, in Berlin wurde ein Propst vor der Marienkirche, in Basel ein päpstlicher Gesandter getötet. Kein Wunder, dass die Kaiser sich in den Städten wohlfühlten und gern dort verweilten. Die städtischen Chroniken verzeichneten die Gespräche, Scherze und Neckereien, die im Ton humorvoller Vertraulichkeit zwischen dem Kaiser und der Bürgerschaft gewechselt wurden. Rudolf von Habsburg verstand es besonders gut, diesen Ton anzuschlagen, der ihm die Gemüter gewann; es ist merkwürdig, wie sich diese Gabe viele Jahrhunderte hindurch in seiner Familie erhalten hat. Einmal kam der König, so wird erzählt, in Basel mit einem Gerber ins Gespräch, der, schlecht gekleidet, über seiner schmutzigen Arbeit war. Im Verlaufe der Unterhaltung lud der Mann den König auf den nächsten Tag zum Mittagessen ein, und Rudolf sagte zu, in der Meinung, einer armen Hütte königliche Gnade zu erweisen. Jedoch empfing ihn in einem stattlichen, geschmackvoll eingerichteten Hause ein feingekleideter Mann mit einer schönen Frau, die ihn zu einer reich bestellten, mit kostbarem Geschirr geschmückten Tafel führten. Der überraschte König fragte den Gerber, warum er denn, da er augenscheinlich ein wohlhabender Mann sei, ein so schmutziges, übelriechendes Gewerbe treibe, worauf der Mann zur Antwort gab, eben diesem Gewerbe verdanke er seinen Wohlstand, und deshalb bleibe er dabei.
Nachdem die Arbeit des hörig gewordenen Bauern der Verachtung anheimgefallen war, bildete sich in der Stadt eine neue Wertschätzung der Arbeit und des freien Arbeiters. Der Handwerker, einst ein Abhängiger, Wehrloser, wurde Hausbesitzer, hatte sein eigenes Recht, wurde Mitherr an der Stadt, verteidigte seine Stadt mit eigenen Waffen. Wie groß auch immer die Kluft zwischen Armen und Reichen, zwischen dem Regimentsfähigen und dem Untertan war, die Stadtluft war doch ein Element der Freiheit für alle, für das neu entstehende Volk der Wohlhabenden und Gebildeten. Wenn die Fremden damals und künftig die Herrlichkeit des Reiches priesen, so dachten sie dabei hauptsächlich an die Städte, von denen jede ihr besonderes Antlitz, ihre besondere Schönheit, ihre besondere Anziehungskraft hatte. Nicht nur die Kaiser, auch die Fürsten, weltliche wie geistliche, hielten sich gern in den großen Städten auf, besaßen dort womöglich ein Absteigequartier. Dort entwickelte sich eine neue Art von Frömmigkeit, die von der Kirchlichkeit unabhängig war, sich sogar mit Feindseligkeit gegen die Kirche vertrug. Sie war nicht mehr nur Magie, sondern sie wurde Lebensdeutung, Durchdringung des Lebens mit sittlichen Gedanken. Der Goldgrund des Drüben löste sich langsam auf, wurde dünner und dünner und ließ die blendende Wirklichkeit hindurchstrahlen; auf die greifbaren Ziele des tätigen Menschen richtete sich der Blick.