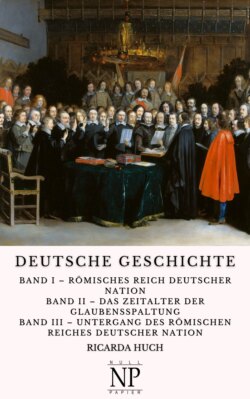Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kaufleute
ОглавлениеAls König Hettel von Hegelingen die Kunde von der schönen Hilde vernahm, deren Vater, der König von Irland, alle, die um sie warben, töten ließ, bemächtigte sich seiner der Wunsch, die verbotene Frucht zu besitzen; und er versammelte seine Vasallen und Freunde, um mit ihnen zu beraten, auf welche Weise er sie gewinnen könne. Da schlug Herr Frute von Dänemark vor, sie wollten Schiffe mit Waren beladen und als Kaufleute verkleidet nach Irland fahren, damit der wilde Hagen sie ohne Arg empfange und sie Gelegenheit hätten, die Königstochter zu sehen und vielleicht zu entführen. Der Plan wird ins Werk gesetzt, sie erreichen die Königsburg, werden freundlich aufgenommen, richten am Strande Buden auf, in denen sie kostbare Waren auslegen, schleichen sich in die Gunst der königlichen Familie ein, und nachdem der Däne Horand durch sein Singen das Herz der schönen Hilde bezaubert und die Einwilligung ihrer Mutter gewonnen hat, bitten sie um Urlaub und fahren mit dem Mädchen davon. In dem Volksmärchen vom treuen Johannes wird ein ähnlicher Vorgang erzählt: ein junger König verliebt sich in das Bild der Königstochter vom Goldenen Dache, und um sie zu erlangen, die augenscheinlich ebenso wie jene Hilde von einem gewalttätigen Vater behütet wird, verkleiden sich der König und sein alter Diener als Kaufleute und befrachten ein Schiff mit goldenen Gegenständen, die zu diesem Zweck kunstfertig hergestellt worden sind. Der Anblick der zierlichen Dinge verleitet die Königstochter, das Schiff zu besteigen, worauf die Anker gelichtet werden und der König die Entführte gewinnen kann.
In beiden Fällen wird darauf gerechnet, dass der Kaufmann ein gern gesehener, ein ersehnter Gast ist. In der Königsburg auf Irland werden die vermeintlichen Kaufleute vom Stadtrichter und den Bürgern freudig empfangen, und das Geleit, um das sie bitten, wird bereitwillig vom König erteilt. Man hat den Eindruck, dass sie nicht nur wegen der Waren, die sie führen, sondern auch als Bringer von Neuigkeiten willkommen sind. Allerdings sagt der alte Wate, ein ganz und gar auf Kampf eingestellter Recke, stolz ablehnend, er sei kein Handelsmann, wenn er Gut gewinne, pflege er es mit seinen Helden zu teilen, und die Herren halten auch darauf, mehr zu verschenken als zu verkaufen; immerhin aber halten sie sich nicht zu gut, um bürgerliches Kaufmannskleid anzulegen und als Kaufleute aufzutreten, und als solche werden sie auch vom König Hagen freundlich aufgenommen und zu Gaste geladen. Ihr großartiges Auftreten, ihre ritterlichen Künste fallen zwar auf, aber an Betrug wird nicht gedacht; es erscheint als möglich, dass Kaufleute zugleich Landbesitzer sind, viele Knechte haben, mit den Waffen umgehen können und mit Adligen wie mit ihresgleichen verkehren. Der gute Gerhard von Köln, eine legendäre Figur des Hochmittelalters, ein Kaufherr, der mit seinem Schatz an Waren gefangene Christen eingelöst und deshalb den Beinamen des Guten bekommen hat, erscheint als des Erzbischofs Freund und wird vom englischen Adel, der ihm zu Dank verpflichtet ist, zum König von England gewählt; er lehnt großmütig ab. Zum Geistlichen, zum Dynasten, Ritter und Bauern, dem Personal des frühen Mittelalters, tritt der Kaufmann als ein neues, fremdartiges Element, das vereint mit dem Handwerker eine neue, die bürgerliche Kultur begründet.
Die ältesten Städte Deutschlands waren die Römerstädte am Rhein und an der Donau, Köln, Mainz, Basel, Straßburg, Regensburg und andere. In manchen von ihnen gab es noch bedeutende römische Bauten, wie zum Beispiel in Trier, das kaiserliche Residenz gewesen war; allmählich aber verfielen sie, besonders wenn Normannen oder Ungarn zerstörend einbrachen, dann auch, weil sie als Steinbrüche beim Herstellen neuer Gebäude benützt wurden. Dass in die Städte königliche Pfalzen und Bischofssitze gelegt wurden, gab ihnen eine neue Bedeutung und Blüte. Das eigentliche Wesen der Stadt jedoch, ihren eigentümlichen Charakter im Gegensatz zum Lande, was sie zu Stätten des Friedens, des Rechtes und der Freiheit, zu selbstständigen, hochwichtigen Gliedern des Reiches machte, das war der Markt, die Niederlassung von Kaufleuten und Gewerbetreibenden. Man sieht das bei den Gründungen neuer Städte, die seit dem 12. Jahrhundert von vielen Fürsten vorgenommen wurden, und die darin bestanden, dass der betreffende Fürst eine Anzahl von Kaufleuten zur Ansiedelung veranlasste, indem er ihnen Vorteile in Aussicht stellte.
Sicherlich gab es immer da, wo Pfalzen oder Bischofssitze waren, Händler; denn die zahlreichen Personen, die mit einer Hofhaltung verbunden waren, hatten Bedürfnisse an Lebensmitteln und anderen Dingen, die nicht nur durch bäuerliche und handwerkliche Hörige befriedigt werden konnten. Im Orient, der Wiege uralter Kulturen, dem Schoß märchenhafter Schätze, gab es edle Produkte und Erzeugnisse höchst verfeinerter Industrien, die aus China, Persien, Kleinasien, Indien erst in Byzanz, dann auch an den arabischen Handelsplätzen Bagdad, Damaskus, Basra, Trapezunt und Samarkand zusammenströmten. Aus China und Byzanz kamen Seide und andere kostbare Gewebe, namentlich Purpurstoffe, die im Westen zur Bekleidung und zu kirchlichen Gewändern und kirchlichem Schmuck dienten. Der Rubin von Ceylon, der Türkis und Lapislazuli von Persien, Smaragd und Saphir aus Ägypten, Beryll und Karneol und andere Halbedelsteine wurden im Westen von Männern und Frauen getragen und im Kunstgewerbe, namentlich an Reliquienbildern, verwendet. Edle Hölzer gebrauchte man beim Färben, zum Auftragen der Farben, um den Farben größere Leuchtkraft zu geben, wie auch zu feiner Schreinerarbeit, so das Aloeholz, das Brasil- und Sandelholz. Perlen kamen aus dem Indischen Ozean, Elfenbein aus Afrika und Indien. Die Kunst des Glasmachens, die von Juden betrieben wurde, brachten diese nach Venedig; aber das Glas aus dem Orient, namentlich das aus Damaskus, galt als das bessere. Moschus, Ambra und Weihrauch waren begehrte Wohlgerüche, den Balsam gebrauchte man zur Herstellung von Salböl und zum Erhalten der Leichen. Lange glaubte man, dass die Balsamsträucher, die nicht weit von Kairo am Rande der Wüste wuchsen, wo der Überlieferung nach Maria mit dem Kinde auf der Flucht nach Ägypten gerastet hatte, die einzigen auf der Welt wären. Pfeffer, Ingwer und Zimmet waren als Gewürze hochgeschätzt. Als Süßstoff verwendete man in Deutschland im Allgemeinen noch lange den Honig, während der Zucker, den die Kreuzfahrer in Kleinasien kennenlernten, weil er sehr teuer war, nur als Heilmittel bei Brustleiden in die Spitäler kam. Friedrich II. sorgte für Neubelebung der Kultur des Zuckerrohrs, das durch die Araber nach Sizilien verpflanzt war.
Die Völkerwanderung hatte den Handel in Deutschland nicht ganz beendigt: immer wanderten kluge und kühne Männer, allen Gefahren trotzend, vom Westen nach dem Osten, nach Norden und Süden, wo sie Waren eintauschen und absetzen konnten. Juden und Friesen erscheinen zuerst als Kaufleute. Von Byzanz aus ging der Strom des Handels eher nach Norden und Osten als nach dem Westen, Wikinger, Araber und Slawen waren Vermittler. Schleswig und das sagenberühmte Jumne an der Mündung der Ostsee waren Handelsplätze, die auch die Frankenreiche versorgten, in der Nähe von Elbing soll sich ein Handelsmittelpunkt der slawischen Preußen befunden haben, in Russland waren Kiew und Nowgorod Märkte. Im zehnten Jahrhundert tauchen in Deutschland die Namen von Kaufleuten auf, die sich augenscheinlich Reichtum und Ansehen erworben hatten. Als Otto I. mit dem byzantinischen Kaiser Konstantin Porphyrogenetos freundschaftliche Beziehungen anknüpfen wollte, wählte er zum Überbringer von Geschenken einen reichen Kaufmann Luitfred, der in Mainz wohnte. Zum Führer einer Gesandtschaft nach Spanien an den Kalifen Abderrahman III. bestimmte er einen Kaufmann von Verdun, namens Ermanhard, weil der in Spanien gut bekannt war, und ließ ihm später noch einen anderen folgen. Es scheint aber, dass von Deutschland aus nur vereinzelt ein unmittelbarer Verkehr mit Byzanz gepflegt wurde; regelmäßig bezogen die deutschen Kaufleute, nachdem Jumne und Schleswig verfallen waren, die Erzeugnisse des Orients aus Italien. Erst waren es Amalfi, Salerno, Neapel und Gaeta, die mit Byzanz handelten, später trat Venedig mit diesen Städten in Wettbewerb und erlangte die Vorherrschaft. Die deutschen Kaiser trugen Sorge, günstige Verträge mit der betriebsamen Meerstadt abzuschließen. Sie blieben mit der selbstständigen in besseren Beziehungen, als sie mit der abhängigen vielleicht hätten erhalten können. Durch die Lage an der Straße nach dem Süden kam Augsburg empor, durch die Lage an der Donau Regensburg; seit dem elften Jahrhundert waren die Verhältnisse in Ungarn geordnet genug, dass dieser Wasserweg benützt werden konnte. Vielerlei verband König und Kaufleute. Die Wege, die sie benützten, waren hauptsächlich die Ströme und Meere, aber auch Landwege, zunächst die alten Römerstraßen, denen sich in merowingischen und karolingischen Zeiten neue anschlossen. Die Notwendigkeit, auf Strömen und Straßen mehr Schutz zu finden, als die eigene Kraft und Waffengewandtheit sicherte, auf den Märkten mit ihren Waren zugelassen zu werden, wies sie an die Geneigtheit des Königs, dem die Straßen im Reich, Märkte, Zoll und Münze gehörten. Dem König flossen die verschiedenen Abgaben zu, die der Handel abwarf, die er allerdings in den meisten Fällen seinen kirchlichen und weltlichen Lehensleuten abtrat; aber er hatte trotzdem Interesse an der Zunahme des Verkehrs, der das Ansehen und den Reichtum der Länder hebt und der zunächst eine Angelegenheit des Friedens ist. Als Beschirmer des Friedens im Reich und in der Welt war er der natürliche Beschützer des Kaufmanns, dessen Tätigkeit auf den friedlichen Beziehungen der Völker untereinander beruhte. Weil der König sie in seinen besonderen Schutz nahm, wurden die Kaufleute im Ausland homines imperatoris, Leute des Kaisers, genannt. Es war üblich, dass der König einen neugegründeten Markt durch einen Kauf eröffnete, war er abwesend, tat es ein Stellvertreter, indem er einen Handschuh des Königs verkaufte. Ein Marktkreuz, das Bild eines bewaffneten Arms, einer bewaffneten Hand deuteten auf den königlichen Rechts- und Friedensschutz und auf die Bestrafung des Gesetzübertreters oder Friedensstörers. Verlieh der König, wie er häufig tat, Markt, Zoll und Münze an Bischöfe oder weltliche Dynasten, so blieb er doch der eigentliche Herr, der Ursprung des Rechtes, und an ihn wandte man sich im Falle der Benachteiligung. Die Nachfolger Ottos des Großen gründeten Märkte an den Plätzen, wo häufiger Aufenthalt ihrer Familie, Klostergründungen und Bischofssitze mehr oder weniger dörfliche Ansiedelungen hervorgerufen hatten; so entstanden Quedlinburg, Nordhausen, Halberstadt und namentlich Magdeburg. Außerdem erhoben sie durch Urkunden Märkte, die schon früher bestanden hatten, zu gesetzlichen, rechtmäßigen. Ein dörfliches Ansehen behielten zwar die Städte, auch die großen, noch lange; dennoch wehte eine andere Luft in der Stadt als auf dem Lande, eine Luft, die frei machte.
Träger des neuen Geistes, der in das bäuerliche Deutschland eindrang, waren hauptsächlich die Kaufleute, und das Mittel, durch das sie wirkten, war das Geld. Sie waren auf eine andere Art reich als die Herren von Grund und Boden, die sich mit Fleisch und Eiern von ihren Bauern, mit Gewand und Mantel von ihren Lehensherren mussten versehen lassen. Ihr Geld konnte man in die Tasche stecken und damit kaufen, was einem gefiel, Menschen und Dinge, Ansehen und Freiheit. Die altgermanische Anschauung, dass Freiheit und Bürgerrecht an den Besitz von Grund und Boden gebunden sei, wurde durch sie gelockert. Auch der, welcher nichts besaß, auch der Hörige konnte in der Stadt persönlich frei und durch seine Arbeit vielleicht wohlhabend werden. Zwar fühlte sich der Kaufmann, da er frei war, dem Hörigen oder aus der Hörigkeit hervorgegangenen Handwerker ständisch übergeordnet; aber er dachte doch nicht daran, ihn in persönliche Abhängigkeit herabzudrücken, er förderte ihn sogar, indem er die Idee des Stadtbürgertums als einer gleichberechtigten Einheit schuf. Verglichen mit dem Bauer, dem Krieger, dem Geistlichen war der Kaufmann vorurteilsfrei. In den fremden Ländern erlebte er die menschlichen Eigenschaften fremder, auch heidnischer Völker; er nahm zwar seinen Gott und sein Gebet überall mit; aber er hielt sich doch, wenn das gefordert wurde, bescheiden damit zurück und fand sich mit den fremden Göttern ab. Vielleicht liebte er die Heimat inbrünstiger als der, der sie nie verließ; aber er lernte die Vorzüge der Fremden kennen und lernte sich mit ihnen zu verständigen. Obwohl er in den Waffen geübt war, bedurfte er doch noch eines anderen Mutes als der Krieger, der mit dem Schwerte zu entscheiden gewohnt war: in mancher Lage half ihm nur die dreifache Macht des Geldes, des Wortes und der Persönlichkeit. Auch dem Besitz gegenüber, obwohl Geldgewinn sein Geschäft war, war er freier als andere, weil er raschen Wechsel ohne Schuld erfuhr. Er dachte und fühlte in weiteren Grenzen als die meisten seiner Zeitgenossen. Solche Eigenschaften machten den Kaufmann fähig, aus der Stadt einen freien, geordneten Staat zu machen. In gewissem Sinne war er die Stadt: er stand am Steuer, er gab die Richtung, er trug die Verantwortung.
Wenn die Anziehungskraft, die der hausierende Kaufmann mit seinem bunten Kram und seinen Nachrichten aus nah und fern auf jedermann ausübte, auf die Stadt übertragen wurde, wo er sich ansiedelte, die er bewegter, reizender machte, so dachte doch die Geistlichkeit anders. Es ist begreiflich, dass die Bischöfe denen zürnten, die ihnen ihre Rechte als Stadtherren zu entwinden suchten und meist auch wirklich entwanden, dass der Klerus überhaupt die Neuerer witterte, die ihn aus dem Mittelpunkt der Kultur verdrängen sollten; aber auch ohne den Antrieb der Selbsterhaltung, aus ihrer Weltauffassung heraus war die Kirche dem Kaufmann feind. In kirchlichen und namentlich in mönchischen Kreisen wurde den Kaufleuten nur Böses nachgesagt. Man schalt sie Räuber, Trinker, Meineidige. Thomas von Aquino hat den Handel als erlaubt bezeichnet, wenn der Händler sich damit begnüge, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wie konnte er das bei der Art des kaufmännischen Geschäftes, das ein bedeutendes Kapital erfordert, bei den Aufgaben, die ihm als der regierenden Schicht in der Stadt gestellt wurden. Die Notwendigkeit, mehr Geld zu verdienen, als er brauchte, reizte den Kaufmann, mehr und immer mehr Geld und Gut aufzuhäufen, bis er schließlich von der Lust am Besitz beherrscht wurde; die Kirche hatte nicht ganz unrecht, wenn sie befürchtete, der Kaufmann möchte nicht nur selbst das Irdische über das Himmlische setzen, sondern durch den Luxus, an den er das Volk gewöhnte, materielle Gesinnung überall verbreiten. Die ungerechte Besitzverteilung, die Kluft zwischen Reichen und Armen, den Wucher und den Luxus hatte der heilige Ambrosius als die Ursachen vom Untergang des Römerreiches bezeichnet; die Kirche behielt das im Sinn und sah mit Unwillen diese Grundschäden von Neuem keimen. Sie hielt daran fest, dass das Bauerngewerbe von Gott eingesetzt sei und die hauptsächliche Beschäftigung der Menschen bleiben müsse. Mit weit vorschauendem Blick sah sie Gefahren, die sich viel später auswirkten, Gefahren, die mit dem reicher sich entfaltenden Leben verbunden sind und die man nicht unterdrücken könnte, ohne das Leben selbst in seiner Quelle und Fülle zu verschütten.