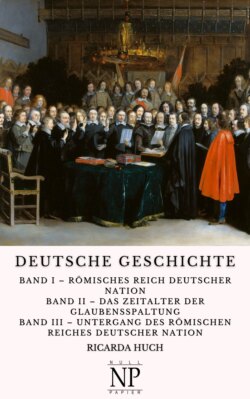Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Juden und der Wucher
ОглавлениеIm zweiten Buch Mosis heißt es: »Wenn du Geld leihst meinem Volke, das arm ist bei dir, sollst du ihm nicht zu Schaden bringen und keinen Wucher auf ihm treiben.« Und im dritten Buche: »Wenn dein Bruder verarmt und neben dir abnimmt, so sollst du ihn aufnehmen als einen Fremdling oder Gast, dass er lebe neben dir. Und sollst nicht Wucher von ihm nehmen noch Übersatz, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, auf dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Wucher tun noch deine Speise auf Übersatz.« Schließlich im fünften Buche Mosis: »Du sollst an deinem Bruder nicht wuchern, weder mit Geld noch mit Speise noch mit allem, damit man wuchern kann.« Mehr aber noch als auf die Stellen im mosaischen Gesetz beriefen sich die Päpste beim Zinsverbot auf den 15. Psalm, der auf die Frage: »Herr, wer wird wohnen in deiner Hütte, und wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge?« im letzten Verse antwortet: »Wer sein Geld nicht auf Wucher gibt und nimmt nicht Geschenke über dem Unschuldigen.«
Man weiß, dass alle Völker auf früher Stufe, welche sich noch als eine einzige Familie betrachten, deren Glieder eins für das andere auf Tod und Leben einstehen müssen, den Zins verbieten. Was die Wucherverbote der Bibel auszeichnet gegenüber denen anderer Stämme und Völker ist die stete Beziehung auf die Erhabenheit Gottes, der seinem Volke die Liebe des Bruders als vornehmstes Gebot empfiehlt. Wie alle Lehren und Vorschriften des Buches der Bücher sind auch diese nicht aus der Erfahrung oder der Betrachtung des Nutzens, sondern aus einer übermenschlichen Quelle abgeleitet, die alle in den Zusammenhang einer übermenschlichen Idee bringt und ihnen das Gepräge der Ewigkeit und Allgültigkeit verleiht. Es war nur natürlich, dass die ersten Christengemeinden das Wucherverbot des Alten Testamentes übernahmen und dass sie es in ihrem kleinen Kreise und ihren einfachen Verhältnissen durchführen konnten. Man sah in dem Entlehner einen Bedürftigen, dessen Notlage der bessergestellte Leiher in unsittlicherweise ausgenützt hätte, wenn er sich etwas über die geliehene Summe oder die geliehenen Lebensmittel hinaus hätte zurückgeben lassen. Von derselben Voraussetzung gingen die Kirchenväter aus; wie die Kirche überhaupt den Schutz der Armen und Schwachen als ihren hauptsächlichen Beruf auffasste, so wollten sie sie auch in dieser Beziehung vor Ausbeutung bewahren. Als wissenschaftlichen Unterbau des biblischen Gebotes nahmen sie den Grundsatz an, den Aristoteles vertreten hatte, dass das Geld unfruchtbar sei. Als Karl der Große das Zinsverbot aus den Gesetzessammlungen der Päpste in seine Gesetze hinübernahm, waren die Verhältnisse im Reich noch einfach; doch wurden bereits Geldgeschäfte gemacht, und zwar gerade von Seiten der Geistlichen, gegen die das Zinsverbot sich hauptsächlich richtete; erst später wurde es auch auf die Laien bezogen.
Den strengen, von der Kirche festgesetzten Standpunkt durchzuführen war möglich, solange die Christen eine kleine, abseits im Dunkel lebende Sekte waren; es wurde schwieriger im Maße, als das Christentum die herrschende Religion geworden war, als in den Städten Handel und Gewerbe zu blühen anfingen und sich nicht nur mehr Reiche und Arme im privaten Verhältnis gegenüberstanden, sondern Menschen verschiedenster Lebensbedingungen, die um ihre Nahrung kämpften. Trotzdem blieb die Kirche dabei, alles als Wucher zu bezeichnen, was der Gläubiger außer der geliehenen Sache oder dem geliehenen Kapital vom Schuldner empfange. Papst Urban III. erklärte sogar Kaufhandel und Wucher für gleichbedeutend, weil der Kaufmann teurer verkauft, als er eingekauft hat, überhaupt auf Gewinn hofft. Die Strenge der Wuchergesetze wurde nur durch einige Ausnahmen ein wenig gemildert: der Kaufmann sollte die Transportkosten in Anwendung bringen dürfen, und der Gläubiger konnte durch eine Vergütung entschädigt werden, wenn der Termin der Rückgabe des geliehenen Geldes versäumt wurde. Man unterschied das dammum emergens, den entstehenden Schaden, und das lukrum cessans, den entgangenen Gewinn, als Bedingungen einer Entschädigung. Bei vorhergehender Verständigung zwischen Gläubiger und Schuldner ließ sich auf diese Weise das Gesetz bis zu einem gewissen Grade umgehen. Übrigens aber bestand das Zinsverbot, von Friedrich I. und Friedrich II. übernommen, in aller Strenge fort. Laien wurden wegen Wuchers exkommuniziert, ebenso Fürsten, die Wucherer in ihrem Gebiet duldeten, Kleriker, die Wucherer bestatteten, streng bestraft. Da am Ende des 13. Jahrhunderts die päpstlichen Dekretalen in Deutschland Eingang fanden, und da auf den Universitäten zuerst mehr das kanonische als das römische Recht studiert wurde, verbreitete sich die kirchliche Auffassung eher mehr als weniger. Der Sachsenspiegel allerdings, nach dem sich das nördliche Deutschland richtete, kannte das Zinsverbot nicht. Nach altgermanischem Recht musste der Schuldner dem Gläubiger seine Schuld abdienen; er verfiel entweder auf Zeit oder lebenslänglich in Schuldknechtschaft. Allein die sächsische Rechtsmeinung wurde in den später dem Sachsenspiegel beigefügten Glossen zugunsten der kirchlichen zurückgestellt; auch drang der Schwabenspiegel, der von vornherein das kanonische Recht vertrat, allmählich nach dem Norden vor.
Dem kirchlichen Gesetz standen die Gesetze des wirtschaftlichen Verkehrs mit solcher Gewaltsamkeit entgegen, den Klerus selbst in den Strom hineinreißend, dass, wenn nicht eine Lösung des Widerspruchs, doch ein Ausweg gefunden werden musste; er fand sich darin, dass die Handhabung der Geldgeschäfte den Juden übertragen wurde, die dem christlichen Gesetz nicht unterstanden. Eine gewisse Neigung und Begabung der Juden für das Geldgeschäft kam dieser Regelung entgegen, die aber, wenn nicht hervorgebracht, doch dadurch unterstützt wurde, dass sie auf das Wohnen in den Städten und Erwerb durch Handel angewiesen waren. Im vermehrten Sachsenspiegel heißt es, von Gottes Recht solle kein Jude Wucher nehmen, doch sei ihre Ordnung anders als bei den Christen, weil sie hierzulande nichts Eigenes haben könnten, darum seien sie von Kaisern und Königen begnadet, dass sie sonderliches Recht hätten. Sie müssten wuchern, weil sie erblich Land und Boden nicht haben dürften und weil die Handwerker sie nicht in ihre Zünfte einließen. Man sagte auch geradezu, Juden müssten wuchern, weil die Christen es nicht dürften.
Die Übernahme der Geldgeschäfte durch die Juden hatte für Juden und Christen verhängnisvolle Folgen. Indem die Juden zu Gläubigern, die Christen zu Schuldnern wurden, entstand ein gespanntes Verhältnis mit der Neigung zu gewaltsamen Entladungen. Während der Glaubenshass eigentlich nur von der Kirche ausging, betraf der Schuldnerhass fast alle Kreise des Volkes, und der letztere war viel grimmiger, weil er auf der Not des Ausgepressten zu seinem Dränger beruhte. Die Klage der Christen, dass die Juden hohe Wucherzinsen forderten und sie dadurch erdrückten, war nicht unberechtigt. Es war üblich, Geld auf kurze Frist und zu erstaunlich hohen Zinsen auszuleihen. Die Höhe des Zinsfußes betrug im Jahre sechzig und siebzig Prozent; in Österreich stieg der Zins infolge besonderer Verhältnisse auf 174, sogar auf 304 Prozent im Jahr. Wenn nun aber die Juden gelegentlich auch über den gesetzlich erlaubten Zins hinaus ihre Schuldner auspressten, so waren sie dazu fast gezwungen durch die Forderungen, die an sie selbst gestellt wurden. Je spärlicher die regelmäßigen Einkünfte der Kaiser wurden, desto mehr nützten sie die Quellen aus, die ihnen zur Verfügung standen, und das waren außer den Abgaben der Reichsstädte die der Juden, die für die Gewährung des kaiserlichen Schutzes gewisse Zahlungen zu leisten hatten. Zu den regelmäßigen Leistungen kamen außergewöhnliche, wenn sich eine Gelegenheit bot. Waren die Judenerträgnisse vom Kaiser den Fürsten oder Städten übertragen, die Ansprüche an sie hatten, so wurden sie von diesen ausgesogen. Je mehr die Juden zu zahlen hatten, je mehr sie selbst ausgebeutet wurden, desto mehr mussten sie ihre Schuldner ausbeuten: es war ein hässlicher, unheilvoller Kreislauf. Bei dem ungeheuren Geldbedürfnis und Geldmangel des Mittelalters, hervorgerufen durch die steigenden Ansprüche auf der einen und den noch unentwickelten Verkehr auf der anderen Seite, waren alle Stände den Juden verschuldet: die Kaiser, die Päpste, der hohe und niedere Adel, die Handwerker. Wenn die Verschuldung einen bestimmten Grad erreicht hatte, so suchten die Schuldner sich aus der Schlinge, die sie erwürgte, gewaltsam zu befreien.
Es leuchtet ein, dass Hochgestellte eher die Möglichkeit hatten, sich Einnahmequellen zu verschaffen oder den Ansprüchen der Gläubiger sich zu entziehen, als das niedere Volk. Daraus erklärt es sich, dass dies die gerechte Handhabung des Judenschutzes durch Kaiser, Fürsten und Stadträte so beurteilte, als wären sie von den Juden bestochen. Sie waren es, insofern sie auf die hohen Gebühren, die sie von den Juden erzielten, nicht verzichten wollten; trotzdem geschah es auch aus Bildung, Einsicht und Pflichtgefühl, dass sie bei Judenverfolgungen durch den Pöbel hindernd und strafend einschritten. In dieser erhitzten Stimmung verschärfte sich teils der Glaubenshass, teils wurde er Vorwand. Ohnehin nahm im 13. Jahrhundert der Fanatismus der Kurie zu, sowohl in Bezug auf die Ketzer als auf die Juden. Innocenz III. erließ ein Gesetz, das den Juden eine bestimmte Tracht vorschrieb, die sie kenntlich und zugleich lächerlich machte. Die spitzen gelben Hüte gaben sie dem Hohn der Gasse preis.
Die Judenverfolgungen des 14. Jahrhunderts wühlten auf, was an bestialischen Trieben in den Untiefen des deutschen Volkes sich verbarg, und offenbarten den Heroismus, dessen die Juden fähig waren. So pflegt die ewige Gerechtigkeit Gewinn und Verlust zwischen Verfolgern und Verfolgten zu verteilen. Die Einsicht, dass die Deutschen in Bezug auf das Geldgeschäft oft schlechter als die Juden handelten, ohne dieselben Entschuldigungen zu haben, machte niemanden in seiner Wut wankend. Der Mönch von Winterthur, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Geschichte seiner Zeit niederschrieb, erzählt einmal, in Lindau sei bei den meisten Menschen Gottesfurcht und Nächstenliebe so verschwunden, dass sie gegen das ausdrückliche kanonische Gebot, verworfener als die Juden, hohen Zins verlangten. Sie wären in der Gewissenlosigkeit so verhärtet, dass sie den Minoriten Schuld gäben, weil sie, wie sie behaupteten, ihnen bei der Beichte keine Sünde daraus machten. Da sei ein wohlhabender Jude gekommen, habe um Aufnahme gebeten und versprochen, gegen geringen Zins wöchentlich Geld auszuleihen. Die Bürger hätten sich gefreut, und der Rat habe beschlossen, dass Christen künftighin keinen Wucher treiben dürften. Derselbe Mönch erzählt, dass in Überlingen Unwille gegen die Juden entstanden sei, weil sie einen Knaben ermordet hätten. Das Volk von Überlingen wünschte nun die Juden zu vernichten, ohne dass Kaiser Ludwig, von dem man wusste, dass er die Juden schützte, die Stadt bestrafte; man glaubte das zu erreichen, indem man die Juden überredete, zu ihrem Schutz in ein hohes steinernes Haus zu flüchten. Nachdem sie das getan hatten und alle darin eingeschlossen waren, zündete man das Haus unten an. Da sie nicht herauskonnten, flohen die Betrogenen immer höher hinauf, bis sie zuletzt auf dem Dach erschienen. In ihrem Zorn und ihrer Verzweiflung warfen sie Steine und Balken auf die Volksmenge, die sich gaffend unten angesammelt hatte. Dann versanken sie unter Gesängen in das in eine Flammenpyramide verwandelte Haus.