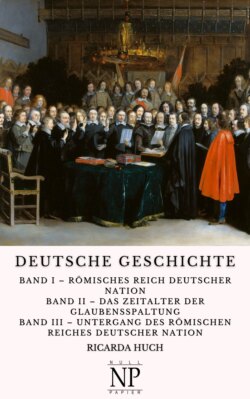Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Eidgenossenschaft
ОглавлениеAm Tage der Ungarschlacht im Jahre 955 erhoben sich die verschiedenen Abteilungen des königlichen Heeres bei Morgengrauen, alle gaben sich gegenseitig den Friedenskuss, schwuren erst ihrem Führer, darauf einer dem anderen treuen Beistand und zogen dann aus dem Lager dem Feind entgegen. Als die Vasallen des Königs Hettel von Hegelingen sich anschickten, übers Meer nach Irland zu fahren, um die Tochter Hagens für ihren Herren zu freien, schwuren sie einander mit gestabten Eiden treuen Beistand. Im Angesicht einer großen Gefahr pflegten germanische Männer ihr Zusammenwirken durch einen Schwur zu heiligen und nannten das eine Schwurgenossenschaft oder Eidgenossenschaft. Das taten auch einige Männer aus den kleinen Ländern Schwyz, Uri und Unterwalden an einem durch die Reuß gebildeten See im oberen Schwaben, als sie ihre Freiheit bedroht glaubten. Es war ein altgermanischer Brauch, den sie übten, und mit den alten Germanen hatte dies Bergvolk mehr Verwandtschaft als mit den kirchentreuen Christen ihrer Tage. Es ist bei ihnen nicht viel die Rede von Gebet, von Stiftung und Heiligtümern, und wenn sie sich beugen, tun sie es mit dem Vorbehalt trotzigen und ungestümen Widerstandes sowie die Gelegenheit es ermöglicht. Dass spätere Geschichtschreiber sie von den Schweden oder Sachsen ableiteten, mögen sie zum Teil im Gefühl für das Nordisch-Heidnische getan haben, das diesen bäuerlichen Heroen eigen war. Söhne des Gotthard waren sie, der selbst wie ein alter Gott über Bergen und Tälern lagert, das Haupt von Wolken und Winden umkreist, wohltätige Ströme den Menschen, die ihm dienen, herablassend. Wie mit einem Gott müssen die, die an seinem Fuße wohnen, mit ihm ringen, bevor er sie segnet; wenn sie sich verwegen und furchtlos erweisen, sind sie sein Volk und haben teil an seinem elementaren Wesen. Sie sind ein Geschlecht von Riesen, die der Lawinen und Blöcke, die ihr wilder alter Gott ins Tal rollt, nicht achtend über zackigen Granit schreiten und Feinde, die sich in ihren heimischen Bezirk wagen, mit geschleuderten Felsen vertreiben. Aber wenn sie Riesen waren, so waren sie doch nicht einfältigen oder plumpen Geistes; sie konnten ihre politische Lage mit jedem Vorteil und Nachteil beurteilen und die Umstände des Geschehens in Nähe und Ferne berechnen und benützen.
Die beiden Länder Schwyz und Uri waren überwiegend von Adligen und freien Leuten bewohnt, die sich nach altgermanischer Auffassung kaum vom Adel unterschieden. Das Ländchen Uri war ein Teil der Ausstattung, mit der im Jahre 853 König Ludwig der Deutsche seine Tochter Hildegard beschenkt hatte, als er in der Nähe der königlichen Pfalz auf dem Lindenhofe beim Orte Zürich ein Kloster gründete und sie zur Äbtissin desselben machte. Wie für alle Klöster wurde auch für die Abtei Fraumünster ein Vogt bestellt, der die hohe Gerichtsbarkeit über das klösterliche Gebiet führte; mit dem Ende des 11. Jahrhunderts kam die Schirmvogtei an die Herzöge von Zähringen. Der Umstand, dass die durch die Immunität aus dem Gesamtverbande gelösten Länder unter derselben Gerichtsbarkeit standen, dass die Bewohner Markgenossen an derselben Allmende waren, das Zusammengedrängtsein namentlich im selben Tale, das Umschlossensein von denselben Bergen nährte in den Leuten von Uri das Gefühl, ein Ganzes, eine Gemeinde auszumachen: im Beginn des 13. Jahrhunderts nannten sie sich die Universitas hominum vallis Uroniae. Das Aussterben der Zähringer im Jahre 1218 befreite die Gemeinde Uri von der Gefahr, Untertanen dieses Hauses zu werden; aber eine neue erhob sich, als Friedrich II. die Vogtei dem Grafen Rudolf dem Älteren von Habsburg verpfändete. Wenn schon die Vögte fast immer danach trachteten, das Land, dem sie als Richter vorstanden, in ihren erblichen Besitz zu bringen, so gab sich die Gelegenheit zu solcher Vergewaltigung vollends bei Verpfändungen. Die Urner suchten sofort sich der Schlinge zu entziehen, die ihrer Freiheit gelegt war, und sie hatten Glück: Heinrich VII., des Kaisers junger Sohn, den er zu seinem Stellvertreter in Deutschland ernannt hatte, erklärte ihren Boten zu Hagenau im Elsaß, dass er die Vogtei zurückgekauft habe und dass er die Männer des Tales Uri niemals dem Reich entfremden werde. Mit diesem Brief des unglücklichen jungen Königs erhielten die Urner die Beglaubigung ihrer Reichsfreiheit, die ihnen nie bestritten wurde. Die Vogtei wurde künftig von Amtmännern aus ihrer Mitte ausgeübt, die nach einiger Zeit Landammänner hießen. Seit dem Jahre 1243 gab das Land seiner Selbstständigkeit dadurch Ausdruck, dass es ein eigenes Siegel führte.
Auch Schwyz, das damals aus dem Flecken Schwyz und dem Dorf Steinen bestand, wurde hauptsächlich von Freien bewohnt; doch gab es dazwischen auch eigene Leute verschiedener Dynasten und Klöster. Die Gerichtshoheit über Schwyz hatten als Landgrafen vom Zürichgau die Grafen von Lenzburg und, nachdem diese ausgestorben waren, die Grafen von Habsburg. Von dieser Familie, die zu ihrem Eigenbesitz an der Aare verschiedene Güter des Grafen von Lenzburg hinzugeerbt hatte, war vorauszusetzen, dass sie versuchen würde, das landgräfliche Amt in eine Herrschaft umzuwandeln, die freien Schwyzer zu Untertanen zu machen. Das Beispiel von Uri wies den Schwyzern den Ausweg aus der sich bildenden Klammer: einzig die Reichsfreiheit gab Sicherheit vor der Unterwerfung unter eine Dynastie. Aus der anschwellenden Flut der Feudalität ragte der Kaiser als ein Fels der alten Volksfreiheit, er handhabte sein Zepter wie einen Zauberstab, mit dem er die Überschwemmung vor denen zum Stehen bringen konnte, die sich ihm ergaben, und die er annahm. Würde er die Männer von Schwyz begnaden, Friedrich II., der Rätselhafte, der Schreckliche, der eben seine ganze Kraft aufbot, um den Papst zu vernichten? In diesem Kampf, der das Abendland erschütterte, erspähten die aufmerksam beobachtenden Männer von Schwyz einen Anlass. Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg nämlich, der die Landgrafschaft innehatte, stellte sich auf die Seite des Papstes, wurde somit Feind des Kaisers, der gern dazu beitragen würde, den Abtrünnigen zu schwächen. Man weiß nicht, wie die Männer hießen, die den schicksalvollen Weg über das Gebirge antraten, um dem Kaiser ihr Anliegen vorzutragen. Es ist anzunehmen, dass sie vorher sich mit denen von Uri besprachen; dann stiegen sie mit festen langen Schritten die Schöllenen hinauf, an der tobenden Reuß entlang, über die stiebende Brücke, die seit einer Reihe von Jahren den Felsen umging, den jetzt das Urner Loch durchbohrt, und über den wilden Gotthard zum Süden hinunter. Vor Faenza fanden sie den Kaiser. Staunend betrachteten sie wohl die Mauern, die der Gewaltige hatte aufrichten lassen, um die tapfer sich wehrende Stadt abzusperren, die nie gesehenen Belagerungswerke und Untergrabungen, mit denen er ihr zusetzte. Vielleicht sahen sie die siebzig Leichen der Bürger von Faenza, die er im Angesicht der Stadt zur Drohung hatte aufhängen lassen. Inmitten der Schrecken hatten die von Schwyz Glück: Friedrich anerkannte ihre Reichsfreiheit, versprach ihnen seinen Schutz und die Fülle seiner Gnade, und dass er sie niemals dem Reich entfremden werde. Leichteren Herzens als sie abgereist waren, kehrten sie zurück, die Urkunde in der Hand, die ihnen verbriefte, was ihnen teurer als ihr Leben war, die Freiheit. Indessen wussten sie wohl, die politisch sehr gewitzigt waren, dass die Urkunde allein ihnen die Freiheit nicht sicherte. Zum Siegel des Kaisers, der wie eine Schachfigur bald auf diesem, bald auf jenem Brette stand, musste das Siegel des Blutes kommen, damit sie gültig werde.
Im Lager des Kaisers vor Faenza befand sich einer von seinen treuesten Vasallen, Graf Rudolf von Habsburg, damals, 1240, 22 Jahre alt, der Friedrichs Patenkind und ihm fast wie ein Sohn ergeben war. Er war der Neffe des Grafen Rudolf, der Landgraf im Zürichgau war, gegen dessen Interesse der Freiheitsbrief sich richtete, den die Schwyzer davontrugen; wenn er davon erfuhr, hielt ihn wohl die Ehrfurcht vor seinem kaiserlichen Herrn von einer Äußerung über die Angelegenheit zurück, die ihn im Augenblick nicht anging. Sein Oheim hingegen, Graf Rudolf der Ältere, erkannte das Geschehene nicht an, forderte vielmehr den Papst auf, alle diejenigen in den Oberen Landen, die sich dem Kaiser angeschlossen hätten, darunter Schwyz und Unterwalden, mit dem Banne zu belegen. In dieser Zeit allgemeinen Aufruhrs schwuren Männer von Schwyz und Uri, vielleicht auch solche von Unterwalden und Luzern, in einem etwaigen Kampfe um ihre Freiheit einander beizustehen, einer für alle, alle für einen. Nicht die Geschichte und nicht einmal die Sage meldet von diesem Schwur, man schließt aus dem, der später vollzogen wurde, auf einen, der ihm voranging. Es kann ihm kein Denkmal gesetzt werden, er ist an keine Stätte gebannt, er ist der Geist der Freiheit, der das hochgetürmte Land wie mit undurchdringlichen Flammen umgürtete.
Im Lande Unterwalden gab es wenig freie Leute, die meisten waren den Klöstern Murbach und Engelberg untertänig, deren Vögte die Habsburger waren. Sie bildeten infolgedessen keine Markgenossenschaft; was sie einigte, war die Gerichtshoheit der Vögte, denen sie gemeinsam unterstanden, und die geografische Nachbarschaft. Der Ort Luzern gehörte dem Kloster Murbach im Elsaß; auch dort gab es eine Partei, die Anschluss an den Kaiser suchte.
Fünf Jahre nachdem Friedrich II. den Schwyzern den Freiheitsbrief ausgestellt hatte, starb er; es folgte der Sturz der Staufer, der Sturz des Kaisertums. Jahre hindurch gab es keinen höchsten Richter mehr im Reiche, der Quell des Rechtes hörte auf zu fließen. Als dann im Jahre 1273 die Kurfürsten wieder einen König wählten, der allgemein anerkannt wurde, war das Ergebnis für die Orte im Oberen Lande Schwaben unheilvoll; König wurde der Graf von Habsburg, sodass nun der Dynast, dessen Machtstreben Schwyz und Uri sich entziehen wollten, und der Oberherr, bei dem sie vor ihm Schutz suchten, eine Person waren. Würde Rudolf, derselbe, der im Lager vor Faenza war, als Friedrich den Schwyzern die Reichsunmittelbarkeit verbriefte, ihnen gegenüber der Landgraf und Vogt oder würde er der König sein? Rudolf, der, bevor er König wurde, im Solde Straßburgs stand und auch als König den Städten manche Gunst erwies, war kein Despot und kein Eroberer; es war, obwohl es ihm an Zügen der Größe nicht fehlte, etwas Bürgerliches in seiner Natur, etwas von der bedächtig scharrenden Methode des Krämers in der Art, wie er seine Hausmacht ausbaute. Dass er es tat, war richtig, ohne einen sicheren Punkt unter den Füßen konnte er das königliche Amt nicht ausüben, und es war selbstverständlich, dass er die Gegend zu einem habsburgischen Reiche erweitern wollte, wo er bereits Güter und Rechte besaß. Dies Land war, scheinbar arm mit seinen Felsen, die kaum Ziegen ernährten, von unermesslicher Wichtigkeit als Zugang zur Gotthardstraße, die seit der Errichtung der stiebenden Brücke zu einem der meistbegangenen Pässe nach Italien wurde, wichtig für den König wegen seiner Beziehungen zur Lombardei und zu Rom, aber auch für jeden anderen Fürsten, der sich an den Zöllen des Handelsweges bereichern konnte. Als ein ehrenhafter Mann ging Rudolf nicht gewalttätig, nicht räuberisch vor: den Freiheitsbrief der Urner erkannte er förmlich an. Anders stellte er sich zu den Schwyzern, indem er überhaupt im Reiche den Grundsatz aufgestellt hatte, nur die Urkunden Kaiser Friedrichs aus der Zeit, bevor er im Banne war, gelten zu lassen. Trotzdem hinderte er nicht, dass die Schwyzer sich wie ein Reichsland selbst durch Landammänner verwalteten und ein eigenes Siegel führten. Ebensowenig griff er in die inneren Verhältnisse von Unterwalden ein. Dennoch breitete sich seine Macht allmählich aus, und er rückte den geängstigten Orten näher und näher. Die Besitzungen der Habsburg-Laufenburger Linie gingen auf ihn über, auch die Kiburger beerbte er, und am Ende des Lebens glückte ihm noch ein bedeutender Fang, indem er dem Kloster Murbach die zwischen Zürich und dem Gotthard gelegene Stadt Luzern abkaufte, in deren Nähe er bereits Besitzungen hatte. Als Rudolf am 12. Juli 1291 starb, atmeten die freiheitsliebenden Leute in den Oberen Landen auf, wie wenn eine Lawine, die sich auf sie herabzuwälzen schien, plötzlich abseits in einen Abgrund gestürzt wäre. Alle, die sich bedroht fühlten, eilten Bündnisse zu schließen; im August, nach der Überlieferung war es der erste, traten Männer von Uri, Schwyz, Unterwalden zusammen, um den Schwur zu erneuern, den sie früher in der Not geschworen hatten, einen Schwur, der ihre Personen nicht nur, sondern die Länder, die sie vertraten, auf ewige Zeit zu einer Genossenschaft verbinden sollte. Man kann annehmen, dass ein Herr von Attinghausen von Seiten Uris und ein Stauffacher von seiten der Schwyzer dabei waren, denn diese Namen erscheinen immer als diejenigen, die die Geschicke ihrer Länder leiteten. Sie verleugneten nicht den Charakter germanischer freier Bauern: ungestüm tapfer, wenn es zum Kämpfen kam, waren sie vorsichtig zurückhaltend in der Verantwortung des vorbereitenden Handelns, ganz und gar konservativ in der Gesinnung. Die ehrwürdige Urkunde, die die Bedingungen der Schwurgenossenschaft festsetzt, nennt den Feind nicht geradezu, gegen den sie sich richtet; es sollen, heißt es, die Rechtszustände wiederhergestellt werden, wie sie vor König Rudolfs Zeit waren. Das Wesentliche war der enge Zusammenschluss der Schwurgenossen: ihre Streitigkeiten sollen von einem Schiedsgericht entschieden werden. Die bestehenden Herrschaftsverhältnisse sollen nicht angetastet werden; die freien Männer von Schwyz und Uri hatten Hörige, wer Knecht war, sollte auch künftig Knecht bleiben. Was für bewundernswerte Politiker diese Bergbewohner waren, bewiesen sie einige Monate später, als sie den Kreis ihrer Bestrebungen durch einen kühnen Schritt erweiterten und mit der Stadt Zürich ein Bündnis abschlossen. Es war eins der vielen Bündnisse, die im Reich geschlossen wurden, bald auf ein Jahr, bald auf mehrere Jahre, die vorübergehenden Zwecken dienten und ohne Folgen blieben; aber es war einzig als Bündnis zwischen Bauernschaften und einer Stadt, als der Keim eines Staates, der im Abendlande ohnegleichen war.
Die Stadt Zürich, die im Laufe der Jahrhunderte neben der königlichen Pfalz und der Abtei Fraumünster herangewachsen war, gehörte mit dem Bischof von Konstanz, dem Abt von St. Gallen, Savoyen und Bern zu den Reichsgliedern, die sich durch die Bildung eines habsburgischen Staates in den Oberen Landen bedroht fühlten. Das gab den Anlass zu dem auf drei Jahre geschlossenen Bunde Zürichs mit Schwyz und Uri. Die Eidgenossen bildeten einen ständigen Rat von sechs Züricher Bürgern und sechs Vertretern der Länder: es waren für Uri Werner von Attinghausen, Bernhard Schüpfer und Konrad Herr von Erstfelden, für Schwyz Konrad ab Iberg, Rudolf Stauffacher und Konrad Huser. So hören wir endlich bestimmte Namen, und es sind Namen darunter, denen Sage und Dichtung edlen Erzklang verliehen haben. Über zwanzig Jahre später leitete Werner Stauffacher die Schwyzer, als sie wieder einmal das Kloster Einsiedeln überfielen, mit dem sie über ein zwischen ihnen liegendes Stück Land stritten. Ohne Scheu vor der gottgeweihten Stätte führten sie Mönche und Knechte des Klosters gefangen fort, nachdem sie das Kloster verwüstet hatten. Vielleicht war er ein Sohn der stolzen Stauffacherin, die ihrem verzagenden Manne den Rat gab, sich mit den Urnern zur Befreiung der Länder zu verschwören.
Der Bund mit Zürich ging bald wieder auseinander, weil die Politik der Reichsstädte in dieser Sache mehrfach wechselte. Die Männer am See dagegen hielten an ihrem Grundgedanken fest, dem unzerbrechlichen Zauberring, den sie um sich geschlossen hatten und wenn es nützlich schien und möglich war, ein wenig, nicht zu viel erweiterten. Dass die Verbindung gegen Habsburg zunächst eine Niederlage erlitt, focht sie nicht an. Die Schwyzer machten damals ein wichtiges Gesetz im Sinne der Freiheit: sie verboten jede Übertragung von Grundbesitz an Landfremde und Klöster und bestimmten, dass kirchliches und grundherrliches Gut im Lande steuerpflichtig sei. Übrigens fuhren sie fort, die Kaiserkämpfe auszunützen. Adolf von Nassauen, Feind der Habsburger, bestätigte willig den Urnern und Schwyzern ihre Freiheitsbriefe. Mit Albrecht, dem Sohne Rudolfs, erneuerte sich die Gefahr, bis ein früher, gewaltsamer Tod sie verscheuchte. Heinrich VII. bestätigte nicht nur den Urnern und Schwyzern, die sich ihm vorstellten, als er im Jahre 1309 sich in Konstanz aufhielt, ihre von den früheren Kaisern ausgestellten Privilegien, sondern auch den Unterwaldnern, die solche gar nicht besaßen, sodass nun die drei Waldstätte sich über ihre Reichsunmittelbarkeit ausweisen konnten. Die Söhne des ermordeten Habsburgers beruhigten sich dabei nicht; nachdem sie sich mit dem Kaiser versöhnt hatten, hielt Leopold ihm vor, dass die den Waldstätten erteilten Rechte gewissen Rechten ihrer Dynastie widersprächen, und erlangte von Heinrich das Versprechen, er werde die Habsburger Herrschaftsansprüche untersuchen lassen und dann die Entscheidung treffen. Das war im Jahre 1311, als er vor Brescia lag. Zwei Jahre später räumte wieder der Tod die den Waldstätten drohende Gefahr hinweg: der noch junge Kaiser starb. Die darauf erfolgende doppelte Königswahl war für die Waldstätte ein glücklicher Umstand, denn Ludwig der Bayer suchte natürlich alle Gegner Habsburgs an sich zu fesseln und lud sie selbst ein, sich ihm anzuschließen, hob auch die Reichsacht auf, der die Schwyzer wegen ihrer gegen das Kloster Einsiedeln verübten Übeltaten verfallen waren. So waren die kleinen Länder in die große Zwietracht hineingerissen, die das Reich zerteilte, die nur mit den Waffen ausgefochten werden konnte. Herzog Leopold beschloss, die Waldstätte, rebellische Bauern, endgültig seinem Hause wieder zu unterwerfen. Es war nicht anzunehmen, dass die unbedeutenden Täler dem österreichischen Herzog, wenn er einmal seine Kräfte sammelte, widerstehen könnten. Etwa 20 000 Mann brachte er zusammen, lauter in den Waffen geübte Ritter, österreichische Lehens- und Dienstleute, hauptsächlich aus den schwäbischen Landen. Während der Herzog diese gegen Schwyz führen wollte, leitete Graf Otto von Straßberg, Leopolds Stellvertreter in den burgundischen Gegenden, ein zweites Heer über den Brünig gegen Unterwalden. Hilfe hatten die Länder keine; Zürich hielt zu Österreich, mit Bern bestand noch keine Verbindung, Luzern war durch die österreichische Herrschaft gebunden. Von den Urnern indessen kam Zuzug nach Schwyz, denn man wusste dort, dass der Herzog beim Engpaß von Morgarten, als dem einzig unbeschützten Punkt, einzufallen beabsichtigte. Dort warteten die Bauern und schleuderten auf die Angreifer, die mit einem leichten Sieg rechneten, Felsblöcke herunter. Die entsetzten Ritter, die zurückweichen wollten, drückten auf die noch nichts ahnenden nachrückenden, und ein furchtbares Gedränge entstand; die nicht vom Feinde vernichtet wurden, ertranken in dem See, der die Flucht versperrte. Der Chronist verglich sie mit Fischen, die in einem Fanggarn gefangen werden. Es war der 15. November des Jahres 1315, als diese erstaunliche Schlacht stattfand, mehr eine Katastrophe als eine Schlacht. Die Kunde davon verbreitete solchen Schrecken, dass Graf Otto von Straßberg für besser fand, mit seinem Heer umzukehren, und so hastig flüchtete, dass er sich eine Verletzung zuzog, an der er starb. In den drei Ländern schlugen die Herzen hoch. In Strömen war das Blut der Ritter geflossen, das ihre hatten sie gespart für die Zukunft. Am 9. Dezember erneuerten sie bei Brunnen ihren Ewigen Bund. Er war diesmal in deutscher Sprache verfasst und nannte Österreich als den Feind, gegen den er sich richtete. Aufrecht standen sie da als bewährte Kämpfer und Sieger, gesättigt mit Ruhm und Ehren. Ludwig der Bayer lobte ihre Treue und beschenkte sie mit Gnaden, indem er, außer dass er ihre Reichsunmittelbarkeit bestätigte, den Habsburgern die Rechte aberkannte, die sie an den Waldstätten zu haben behaupteten. Zwei Jahre nach der Schlacht wurde der Landammann von Uri zum Reichsvogt von Urseren und Livinen und damit zum Aufseher über den Gotthardverkehr ernannt. So waren denn die Waldstätte dicht an den Berg hinangerückt, der ihres Schicksals Herr war; sie hatten, das fühlten sie, an seine Felsen angeklammert einen festen Stand, den menschliche Kraft nicht erschüttern konnte. Nun führten sie allmählich auch die urtümliche Germanenfreiheit wieder ein, die ihrem Sinn entsprach. Es hatte unter ihnen einen Adel gegeben, der sich nicht rechtlich über den Freien erhob, dem nur so viel Ehrerbietung und Gehorsam gezollt wurde, wie persönlicher Tüchtigkeit freiwillig gewährt wurde. Den Lehens- oder Dienst-Adel, der jetzt herrschte, machten seine Ansprüche und Übergriffe verhasst; weil sie keine Geschlechter aufkommen lassen wollten, die den freien Bauern unterdrückten, vertrieben sie die adligen Familien, die unter ihnen heimisch waren. Den Herrschaften, die Rechte in Uri hatten, wurden diese abgekauft. In Unterwalden wurden einzelne Familien, die Lehen von Österreich hatten, unfähig zur Bekleidung öffentlicher Ämter erklärt. Weder sollten Knechte noch sollten Edelleute der engen Verbundenheit aller zu gleicher Treue zur Heimat und Opferbereitschaft für die Freiheit eine Hemmung sein.
Dem demokratischen Gedanken fiel in Uri die Familie von Attinghausen zum Opfer, der, wie man annimmt, vorzüglich der großartige Aufschwung der eidgenössischen Politik zu danken war. Im Jahre 1358 wurde Hans von Attinghausen, nachdem er jahrzehntelang die Geschicke des Landes erfolgreich geleitet, sein Bündnis mit den Städten befördert hatte, durch einen Aufstand vertrieben. Seine Burg in der Nähe von Altdorf, deren Trümmer noch vorhanden sind, wurde zerstört. Ruhm und Erfolg hatten das Geschlecht höher getragen, als für den demokratischen Gedanken zulässig war. Es war der führende Stern, der, während das Volk, dem er in dunkler Zeit lange geleuchtet hat, sicheren Ganges in die Zukunft schreitet, tragischem Untergang verfällt. Man weiß nicht, wie und wo der letzte Attinghausen gestorben ist.
Von dem durch die Schlacht am Morgarten gewonnenen Standpunkt aus erweiterten die Länder ihren Ring, indem sie Bündnisse mit Luzern, mit Zürich und Bern schlossen, das bäuerliche Misstrauen gegen die Städte zurückstellend. Sie unterstützten Bern, das sich gegen die Bischöfe von Lausanne und Basel, gegen die Grafen von Kiburg und andere Dynasten wehren musste, und hatten Anteil an der Schlacht bei Laupen, durch welche die ritterliche Stadt ihre Gegner niederwarf. Obwohl mit Bern und Zürich nun ewige Bündnisse eingegangen wurden, waren diese doch nicht so zuverlässige Eidgenossen wie die Länder untereinander; denn da die beiden reichen und mächtigen Städte dem Hause Habsburg unabhängig gegenüberstanden, schien ihnen das Zusammengehen mit demselben zuweilen vorteilhaft, und sie waren dann unter Umständen bereit, die Freundschaft mit den Waldstätten einem von Österreich erhofften Gewinn zu opfern. Trotzdem war es gerade die Einbeziehung der Städte, die die Schwurgenossenschaft zu einem entwicklungsfähigen Staat machte; ohne sie wären die Heldentaten der Leute am Gotthardt zu einem Volkslied geworden, dem wir anteilvoll lauschten, hätten sie sich nicht als eine neue und große Idee in der Geschichte verwirklicht. Darin, dass ihre Bündnisse und Schlachten eine Folge hatten und eine Folge bezweckten, unterschieden sie sich von den heroischen Friesen und Sachsen an der Nordsee; denn die Entstehung der holländischen Republik im 16. Jahrhundert steht mit den mittelalterlichen Unternehmungen der Dithmarscher, Stedinger und Friesen nicht in unmittelbarem Zusammenhange. Gewiss waren die schweizerischen Eidgenossen begünstigt durch die Lage ihres Landes, dessen Berge und Ströme sie zur Einheit zusammendrängen, und an dem die mittelalterlichen Kaiser so lebhaften Anteil nahmen, wie sie ihn sonst wohl für eine noch so tapfere Bauernschaft nicht gehabt hätten; kamen sie doch den entlegenen Friesen bei ihren Freiheitskämpfen nicht zu Hilfe. Man muss aber auch glauben, dass die seltene Vereinigung von elementarer Kraft und besonnener Vernunft eine besondere Gabe des schwäbischen Stammes ist. Mit ihr erwarb er sich früh und lange dauernd eine hohe, sowohl politische wie literarische Kultur.