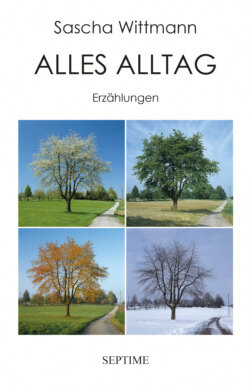Читать книгу Alles Alltag - Sascha Wittmann - Страница 11
ОглавлениеIch, Ratte
Ich bin eine Ratte. Niemand mag Ratten. Ratten sind Schädlinge. Sie übertragen Krankheiten, müssen daher ausgerottet werden. Die Krankheit, die ich übertrage, ist die Moral. Ich bemühe mich redlich, dass man mir meine Krankheit nicht ansieht, versuche, sie zu unterdrücken.
Doch es ist mir wieder nicht gelungen. Ich hätte meinen Mund halten sollen, so wie es alle anderen machen. Manche von ihnen sehen durchaus, was falsch läuft, aber sie sind eben still, schauen auf sich, nicht auf das große Ganze. Das haben sie mir gesagt. Zum Abschied. Als Rat mit auf den Weg gegeben: »Du musst nicht immer die Welt retten.« Aber ich bin eben eine Ratte.
Und Ratten haben auch Vorteile. Sie sind eklig, besonders der lange, nackte Schwanz. Man braucht kein Mitleid mit ihnen zu haben. Man kann alles Schlechte, Böse, Unerwünschte auf sie projizieren, sie vertreiben und dann guten Gewissens weiterleben in dem Gefühl, der Gemeinschaft einen Dienst erwiesen zu haben.
Ja, es stimmt, ich war bei den Verhandlungen um die Personalkürzungen, die im nächsten Jahr notwendig sein werden, nicht sehr geschickt. Wenn ich nur still gewesen wäre, im entscheidenden Moment den Mund gehalten hätte … Mein Posten stand ja gar nicht zur Diskussion. Es sollte noch nicht einmal die endgültige Entscheidung fallen, war nur einmal ein erstes Sondieren. Ich hätte mir den Vorschlag des Geschäftsführers, meine Sozialarbeiterin einzusparen, für sie bei anderen Organisationen ein gutes Wort einzulegen, nur ruhig anhören müssen, nur versuchen müssen, dem Argument, dass der neue Job für sie sogar eine Verbesserung sei wegen der kürzeren Wegzeit und eines schöneren Büros, etwas abzugewinnen. Ich hätte dafür ja auch die Sozialarbeiterin einer anderen Abteilung, die verkleinert werden muss, bekommen. Ich hätte nur verbindlich zu lächeln brauchen, etwas Gras über die Sache wachsen lassen und strategisch überlegen, wie ich weiter vorgehen würde, um diese Zumutung abzuwenden: Fakten dokumentieren, warum gerade meine Sozialarbeiterin unersetzlich für uns sei, Informationen sammeln, die die andere in einem schlechten Licht erscheinen ließen. Aber nein, nichts davon habe ich unternommen. Stattdessen begann ich, innerlich zu kochen. Offenbar war mir meine Aufregung auch anzusehen, denn der Geschäftsführer sprach mich ohne Umschweife darauf an, was ich denn von der vorgeschlagenen Lösung hielte. Und ich habe natürlich nicht erst einmal ausweichend geantwortet, um Zeit zu gewinnen. Nein, es ist einfach aus mir herausgesprudelt: dass meine Sozialarbeiterin immerhin schon achtundvierzig sei, also sicher nicht so leicht eine neue Stelle finde, wo sie doch gerade erst privat eine schwere Krise überstanden habe, was die Arbeitsleistung in keiner Weise geschmälert habe, nur brauche sie jetzt eine gewisse Zeit der Stabilität und nicht schon wieder einen Schlag, dass sie mit ihrem Migrationshintergrund eine wichtige neue Sichtweise in unsere Arbeit einbringe. Wahrscheinlich war es auch nicht gescheit, mit dem Leitbild zu argumentieren, in dem steht, dass ein respektvoller Umgang miteinander für uns selbstverständlich sei und wir uns selbst dazu verpflichteten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Benachteiligungen besonders zu fördern. Und immerhin habe meine Sozialarbeiterin eine leichte Gehbehinderung. Gänzlich ungeschickt war es natürlich zu erwähnen, dass die andere wesentlich jünger sei, was ihr bei der Jobsuche wohl einen gewissen Vorteil verschaffe. Außerdem sei sie unbestreitbar sehr hübsch und wisse dieses Privileg gut einzusetzen.
Nein, ich bin nicht gleich an diesem Tag gekündigt worden. Der Geschäftsführer hat mir in der Sitzung nur zugenickt und mit einem anderen Tagesordnungsthema weitergemacht. Aber eine Woche später wurde ich zu einem Gespräch gebeten. Auch hier ging es nicht um meine Kündigung, jedenfalls vordergründig nicht. Ich wirke in letzter Zeit sehr angespannt, gleichzeitig verbissen. Typische Anzeichen für Burnout. Ich solle mir ausgiebig Zeit für mich selbst nehmen. Man würde mich bei einem Antrag auf Bildungskarenz, am besten gleich ein Jahr, unterstützen. Und natürlich müsse ich mich nicht sofort entscheiden, aber ich solle auch an die Firma denken und mir nicht zu lange Zeit lassen.
Ich werde dieses Angebot annehmen, obwohl ich weiß, dass es eine Falle ist, nur im ersten Moment verlockend klingt. Der Geschäftsführer will mich loswerden – vielleicht wollen das auch einige Kolleginnen und Kollegen. Er will nichts mehr davon hören, für welche Werte der Verein einmal stand und wie deren Umsetzung in der täglichen Arbeit ausschauen sollte. Denn sonst könnten auch andere auf die Idee kommen, unser Leitbild ernst zu nehmen, könnten fragen, warum wo wie viel investiert wird, wie es sein kann, dass die Tochter des Obmanns gleich nach der Ausbildung eine Teamleiterinnenfunktion bekommen hat. Nein, so etwas darf nicht passieren.
Ich könnte versuchen, damit aufzuhören, eine Ratte zu sein. Ich könnte – wie viele andere – immer zuerst auf mich schauen. Aber es gelingt mir nicht, wie sehr ich mich auch bemühe. Ich werde das Angebot annehmen, obwohl ich weiß, dass so zur Mitte der Auszeit die Kündigung kommen wird. Oder erst unmittelbar nach der Karenz. Aber sie wird kommen, weil die Ratte verschwinden muss. Trotzdem werde ich das Angebot annehmen, nicht kämpfen, keine Szene machen.
Denn ich bin zwar eine Ratte, aber inzwischen bin ich eine müde Ratte.