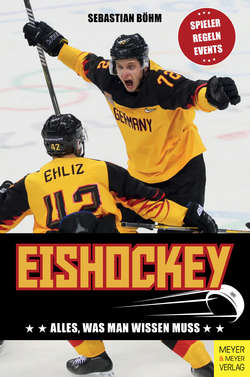Читать книгу Eishockey - Sebastian Böhm - Страница 20
Оглавление2
ERSTE DRITTELPAUSE
2.1 DIE NHL, DIE KHL, DAS IOC UND DER GANZE REST
Datsyuk auf Gusev auf Voynov, einer der besten, vielleicht sogar der beste Zwei-Wege-Stürmer passt auf einen Feinmechaniker, der den Puck an einen Weltklasseverteidiger weiterleitet. So weit, so normal für ein olympisches Eishockeyfinale. Oder? Nein, am Endspiel des Eishockeyturniers von Pyeongchang 2018 war nichts normal. Ganz so, wie es sich für olympische Eishockeyturniere gehört. Und warum? Es ist kompliziert.
Nero hatte die Olympischen Spiele noch nach Rom gebracht, im Jahr 60 nach Christus, einem Jahr, in dem zehn von 14 Stadtteilen von einem verheerenden Brand zerstört worden waren, einem Brand, den er wohl nicht gelegt haben kann, den er aber besungen haben soll – obwohl er sich gar nicht in Rom aufhielt. Es spielt keine Rolle, entscheidend ist, dass der römische Kaiser Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus ein Fan der Olympischen Spiele war – und später an seinen eigenen Spielen, den Neroneia, teilnahm. Nicht als Eishockeyspieler, sondern als Sänger. Zumindest das ist historisch unumstritten.
Theodosius I. aber schon konnte nichts mehr mit den heidnischen Riten anfangen, weshalb er die Plätze in Olympia schließen ließ. Theodosius II. verbot die Olympischen Spiele dann endgültig. Erdbeben zerstörten den Zeustempel. Was mit der prächtigen, aus Gold und Elfenbein gefertigten, 13 Meter hohen Zeus-Statue des Phidias passierte, man weiß es nicht. Aber nicht nur die Kaiser, auch die normalen Menschen waren der Olympischen Spiele wohl überdrüssig geworden, Leibesübungen wurden sowohl von Heiden als auch von Christen als eitel angesehen. Die Olympischen Spiele der Antike scheiterten am Größenwahn und an der Hybris. Selbst Zeus wandte sich ab.
Warum dieser historisch sehr wahrscheinlich äußerst fragwürdige Absatz in einem Buch steht, das alles vereinen soll, was man über Eishockey wissen muss? Weil man etwas weiter ausholen muss, um den Konflikt zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), der International Ice Hockey Federation (IIHF), der National Hockey League (NHL) und der Kontinental Hockey League (KHL) verstehen zu können und um die Frage zu beantworten, warum in Pyeongchang bis auf Südkorea keine Nationalmannschaft in Bestbesetzung hat antreten können.
In etwa zu genau der Zeit, in der sich in Kanada die Sehnsucht der Menschen manifestierte, auf dem Eis mit Schlägern aufeinander loszugehen, legten deutsche Archäologen auf der Peloponnes die Ruinen von Olympia frei. Plötzlich war die eigentlich nette Idee von einem fairen, völkerverbindenden, sportlichen und künstlerischen Wettstreit wieder en vogue.
Pierre de Coubertin sorgte sich derweil um den körperlich verheerenden Zustand der französischen Armee, den er für die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg (1870/1871) verantwortlich machte, und ein bisschen auch um die nationalen Egoismen im Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Der Baron aus Paris wurde zum Influencer, verbreitete den olympischen Gedanken. Im April 1896 ging es in Athen dann mit den Olympischen Spielen von Neuem los. Allerdings sieht es so aus, als hielte man beim zweiten Versuch nicht mehr ganz so lang durch.
Eigentlich von Beginn an überstrahlten die Geschichten von Fairness, der unendlichen Kraft des menschlichen Geistes und des menschlichen Körpers die Schattenseiten der Olympischen Spiele. Die unwahrscheinliche Freundschaft zwischen Jesse Owens und Luz Long, Zehnkämpfer Rein Aun, der seinen ins Ziel taumelnden Konkurrenten und Olympiasieger Willi Holdorf auffängt, nicht zuletzt das „Miracle on Ice“ einer US-amerikanischen Eishockeymannschaft 1980, all die Heldenleistungen überstrahlten Korruption, Manipulation, den Missbrauch einer zeitlos wunderbaren Idee und die offenbar systemimmanente Verlogenheit von Sportfunktionären. Die olympische Geschichte des Eishockeys passt da leider perfekt hinein.
1920 ging es los, eher spontan bei den Sommerspielen in Antwerpen, weil sich die Betreiber des Palais de Glace weigerten, die Eiskunstlaufwettbewerbe auszurichten, wenn nicht auch Eishockey ins Programm aufgenommen wurde. Eishockey profitierte selten von der Wirkung, den das Spiel auf die Massen hatte, sondern schon immer von der Leidenschaft, dem Geld und dem Einfluss Einzelner. Die Tschechoslowakei, die USA, Schweden, die Schweiz und Belgien entsandten Mannschaften.
Für Kanada nahmen die Winnipeg Falcons teil, eine Amateurmannschaft, die es im eigenen Land lange Zeit schwer hatte, weil sie ihre Spieler aus der isländischen Minderheit in Winnipeg rekrutierte. Konnie Johannesson und Frank Fredrickson aber machten die Falcons trotzdem zu einem Gewinnerteam. Das Finale in Antwerpen wurde nicht sehr spannend. Die Isländer aus Winnipeg gewannen 12:1. So erwartbar ging es weiter.
In Nordamerika entwickelte sich die NHL zu einem Geschäft und alle vier Jahre holten die Amateure von den Toronto Granites, den Toronto Varsity Blues, des Winnipeg Hockey Clubs und von den Ottawa RCAF Flyers Gold für ihr Heimatland. Lediglich 1936 gelang der Mannschaft von Großbritannien ein erstes Wunder auf dem Eis, als sie im Kunsteisstadion von Riessersee die Port Arthur Bearcats 2:1 besiegten. Neun der 13 Spieler, die das Vereinigte Königreich in Garmisch-Partenkirchen vertraten, hatten den Großteil ihres Lebens allerdings in Kanada verbracht – und waren nebenbei zu ordentlichen Eishockeyspielern herangereift.
Kanada dominierte also die Olympischen Spiele, bis man in Moskau auf die Idee kam, die noch immer junge Sportart Eishockey als Propagandainstrument zu missbrauchen. Keine vier Jahre brauchte Anatoli Tarasov, um die beste Nationalmannschaft der Welt zu entwickeln, zumindest die beste, die tatsächlich bei Turnieren antrat. 1960 deuteten die USA in Squaw Valley schon einmal an, auf eigenem Eis Wunder vollbringen zu können, die Kitchener Waterloo Dutchmen holten noch einmal Silber für Kanada, danach aber übernahm endgültig die rote Maschine.
Eine Rivalität auf dem Eis pflegte die Sowjetunion allein mit der Tschechoslowakei. Die Amateure aus Nordamerika waren dem perfekten Eishockey körperlich und spielerisch nicht mehr gewachsen. 1970 zog Kanada seine Teams aus offiziellen Wettbewerben des Weltverbands zurück – zum einen, weil die IIHF selbst den Einsatz von Halbprofis untersagte, zum anderen aus Protest gegen die Ungleichbehandlung.
Denn natürlich waren es keine Amateure, die die UdSSR und die CSSR bei Olympischen Spielen vertraten. Offiziell waren Anatoli Firsov, Boris Mikhailov, Valeri Kharlamov, Alexander Maltsev, Alexander Ragulin oder Vladislav Tretiak Soldaten der Roten Armee, tatsächlich aber waren sie Vollzeiteishockeyspieler. Soldaten mit Eishockeyschlägern statt Gewehren, die professioneller lebten und trainierten als Phil Esposito, Bobby Hull, Ivan Cournoyer, Stan Mikita, Bobby Orr oder Jacques Plante auf der anderen Seite des Atlantiks.
Es ist überflüssig, zu erwähnen, dass beide Eishockeygroßmächte davon überzeugt waren, die weltbesten Mannschaften aufstellen zu können. Daran konnten auch die Ergebnisse der Summit Series oder der Canada-Cup-Turniere nichts ändern. Das galt insbesondere für das selbsternannte Mutterland des Sports. 50 Jahre ohne Olympiasieg, 33 Jahre ohne WM-Titel konnten das kanadische Selbstvertrauen nicht erschüttern. Wichtig war die National Hockey League. Sonst nichts.
Die NHL war da aber schon lange keine kanadische Liga mehr, die Profis kamen noch immer aus Saskatchewan, Ontario und aus den Northwest Territories, sie spielten aber mittlerweile auch in Tampa Bay, San Jose, Miami und Anaheim. Nashville und Atlanta sollten die nächsten NHL-Franchises bekommen. Das Fernsehpublikum im Süden der USA aber war noch nicht bereit für die raue Sportart aus dem Norden. Für Olympische Spiele konnte es sich hingegen erwärmen, doch für Olympische Spiele wollte die NHL ihren Spielbetrieb noch immer nicht unterbrechen. Das Spiel aber sollte wachsen, erst bis nach Florida und Kalifornien, dann nach Asien.
Gegen anfängliche Proteste der NHL-Profis beschlossen die Liga und die Spielergewerkschaft, an den Spielen in Nagano 1998 teilzunehmen, was dem jungen Tschechien neue Feiertage bescherte. Aus Sicht von Team USA und Team Canada hätte man in der Nachbetrachtung besser bis zu den Spielen in Salt Lake City 2002 gewartet. Die Frage, warum Coach Marc Crawford den großen Wayne Gretzky nicht am Penaltyschießen im Halbfinale gegen den unglaublichen Dominik Hašek antreten ließ, wird Kanada wohl ewig beschäftigen. Und in den USA schämte man sich noch am wenigsten für das lustlose 1:4 im Viertelfinale gegen Tschechien.