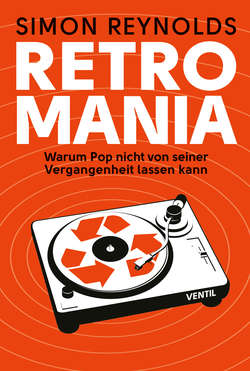Читать книгу Retromania - Simon Reynolds - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE VERGANGENHEIT SPIELT VERRÜCKT
ОглавлениеPunk verachtete die Vergangenheit und sah deshalb das Museum als Feind. Bei Rave sollte seine Zukunftsbesessenheit eigentlich dafür gesorgt haben, dass er mit verstaubten Archiven nichts anfangen kann. Besonders der strenge Minimalismus des frühen Techno – Musik, die auf ihren Rhythmus und ihre Struktur reduziert wird, die wahre Klangkunst – erinnert an den Geist der italienischen Futuristen um etwa 1909 bis 1915. So sehr ich die Geschichte und das Nachdenken über die Vergangenheit auch schätze, wird ein Teil von mir immer begeistert dem futuristischen Manifest zustimmen, das die Rückwärtsgewandten mit Hohn und Spott überschüttet: Antiquare, Kuratoren, der Tradition verhaftete Kunstkritiker. Der italienische Futurismus war die Antwort auf das intellektuelle Hemmnis, in einem Land aufzuwachsen, das den Weg für den Tourismus als Zeitreise bereitet hatte (es ist schließlich fast immer die Vergangenheit eines Landes, in der man Urlaub macht, zumindest in der alten Welt), ein Land, das mit protzigen Ruinen, ehrwürdigen Kathedralen, prachtvollen Plätzen und Palästen und den monumentalen Überresten aus zwei goldenen Zeitaltern übersäht ist, dem Römischen Reich und der Renaissance.
Im Gründungsmanifest von F. T. Marinetti, dem Begründer des Futurismus, heißt es: »Wir wollen dieses Land von dem Krebsgeschwür der Professoren, Archäologen, Fremdenführer und Antiquare befreien. Schon zu lange ist Italien ein Markt von Trödlern. Wir wollen es von den unzähligen Museen befreien, die es wie zahllose Friedhöfe über und über bedecken … Museen; Friedhöfe! … Wahrlich identisch in der unheilvollen Promiskuität von vielen Körpern, die einander nicht kennen.« Er schimpft weiter in dieser sexuellen Metaphorik: »Ein altes Bild bewundern heißt, unsere Sensibilität in eine Aschenurne schütten, anstatt sie weit und kräftig ausstrahlen zu lassen in Schöpfung und Tat.« Kunstwerke aus der Vergangenheit zu verehren, sei wie seinen Élan vital mit etwas Leblosem und Verfaultem zu vergeuden; wie eine Leiche zu ficken.
Marinetti malte sich aus, »Feuer an die Regale der Bibliotheken« zu legen und die Kanäle umzuleiten, »um die Museen zu überschwemmen«, so dass die »ruhmreichen Bilder zerfetzt und entfärbt« auf dem Wasser treiben. Was würde Marinetti, der das 1909 geschrieben hat, über die Situation der westlichen Kultur 100 Jahre später denken? In den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben wir etwas erlebt, was Andreas Huyssen einen »Memory-Boom« genannt hat, in dem der Zuwachs an Museen und Archiven nur ein Aspekt der Obsession für Gedenkveranstaltungen, Dokumentation und Konservierung ist, der die gesamte westliche Kultur erfasst hat. Beispiele sind die Restaurierung alter Stadtzentren oder die Museumsdörfer, in denen Menschen in Kostümen, die an die Kleidung vergangener Zeiten erinnern, traditionelles Handwerk vorführen; die Popularität von Möbelimitaten und Retro-Dekor; die weit verbreitete Manie, sich selbst mit Kameras zu dokumentieren – und, da Huyssen seinen Essay bereits 2002 verfasst hat, müssen mittlerweile auch Handykameras, Blogs, YouTube etc. dazu gezählt werden; die Zunahme von Dokumentations- und Geschichts-Kanälen im Fernsehen; die Masse von Gedenkartikeln und Sonderausgaben von Magazinen (40 Jahre »Summer of Love«, die Mondlandung oder solche, die schlicht 20 Jahre oder die hundertste Ausgabe des Magazins selbst feiern).
Huyssen bezieht sich auf Hermann Lübbes Konzept der »Musealisierung« – archivarisch zu denken durchströmt alle Bereiche der Kultur und des Alltags – und stellt die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts der zweiten Hälfte gegenüber, wobei er eine Verlagerung von der Beschäftigung mit der »gegenwärtigen Zukunft« zu einer »gegenwärtigen Vergangenheit« feststellt. Im größten Teil des letzten Jahrhunderts waren die Schlagworte Modernität und Modernisierung, der Akzent lag darauf, voranzuschreiten, der entschlossene Blick lag auf allem, was in der Gegenwart »die Welt von Morgen« verkörperte. Dieser Blick verschob sich seit den frühen 70ern zunächst schleichend, dann aber in zunehmendem Maße hin zu einer Beschäftigung mit den Hinterlassenschaften der Vergangenheit in der Gegenwart; eine gewaltige kulturelle Veränderung, die den Aufstieg der Nostalgie-Industrie mit ihrer Retro-Mode und ihren Revivals, das postmoderne Potpurri aus vergangenen Stilen und die spektakuläre Zunahme an dem, was als kulturelles Erbe klassifiziert wird, umfasst.
Die Idee eines kulturellen Erbes kann bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Zu der Zeit wurde in Großbritannien der National Trust gegründet, um »Orte von historischem Interesse oder Naturschönheiten« zu schützen. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der Impuls zu, jenseits des antiquarischen und aristokratischen Ursprungs zu konservieren. Es gab Kampagnen für die Bewahrung der Dampflok oder herrschaftlicher Anwesen und einen Kult um die Restaurierung von Kanalbooten. Zu einer Massenbewegung wurde die Bewahrung des kulturellen Erbes aber erst in den 80ern. 1983 wurden das National Heritage Act, eine Kommission für historische Bauten und antike Monumente, gegründet, besser bekannt als English Heritage. Das Sammeln von Antiquitäten war nun nicht mehr nur eine vornehme Beschäftigung, sondern ein Zeitvertreib der Mittelklasse, der von einer erweiterten Definition des Begriffs Antiquität bestärkt wurde, der neben Handgefertigtem auch profane, häufig maschinell erzeugte Artefakte wie originelle alte Flaschen, Emailleschilder, Teekästen etc. einschloss. Ebenso wie die massenproduzierten Objekte bekamen auch die Orte, an denen diese Dinge hergestellt worden waren, eine idyllische und bezaubernde Aura: Das führte zur Zunahme von Industrie-Museen (Minen, Brennöfen, Pumpstationen, sogar viktorianische Kläranlagen). Ein klassisches Beispiel für dieses Phänomen der Ästhetisierung von Dingen, die nicht mehr mit der Produktion assoziiert werden, sind Kanalboote, die als pittoresk gelten, seit sie nicht mehr Kohle schiffen oder andere industrielle Materialien zu Fabrikstädten transportierten. Was einmal ein schwimmender Slum war, der auf trostlose Weise Arbeitsplatz und Zuhause kombinierte, wurde zu einer Binnengewässerversion von Reihenhäusern, deren Mischung aus vergangenem Charme und Exzentrizität die weniger angepassten Teile der Bourgeoisie ansprach.
Ende der 90er war die Bewahrung von Kultur in Großbritannien zu einer derart vorherrschenden Kraft geworden, dass Julian Barnes mit England, England einen satirischen Roman darüber schrieb. Darin wird die gesamte Isle of Wight mit einer Themenpark-Version des Landes bebaut, die sich hauptsächlich auf die touristischen Klischees von Britishness stützt (strohbedeckte Häuschen, Melonenhüte, Doppeldeckerbusse, Cricket etc.).
In ganz Großbritannien sind einzig die Chavs gegen die Romantik des Antiquierten immun – Chav ist eine abwertende Bezeichnung für Angehörige der weißen Arbeiterklasse, die sich mit der Musik und dem Stil des schwarzen Amerika identifizieren, wo er am protzigsten und materialistischsten daherkommt. Obwohl die Gegner der Chavs sich über deren Mangel an Geschmack und deren Vulgarität beschweren – der pompöse Schmuck, die grellen Trainingsanzüge, »Spaceship«-Turnschuhe –, steht im Subtext dieser Anfeindungen aber, dass die Chavs an alten Dingen wie Antiquitäten, Kulturgütern, Kostümfilmen nicht interessiert und damit unbritisch sind. Diese Abneigung gegen Vintage, das Gebrauchte und Abgetragene aus zweiter Hand, haben ethnische Minderheiten auf beiden Seiten des Atlantiks und die traditionelle weiße Arbeiterklasse gemeinsam.
In Großbritannien sind die Chavs selber eine Art ethnische Minderheit. Die breite konservative Mittelschicht ist den mittelmäßigen Reizen des Altmodischen erlegen. In den 80ern hat dort ein Gesinnungswandel stattgefunden, der zweifelsfrei auf die gleichen sozialen und kulturellen Ursachen zurückzuführen ist wie die Gründung des National Heritage Act 1983. Wie der Architektur-Blogger Charles Holland gezeigt hat, empfehlen Einrichtungsund Heimwerkerbücher bis weit in die 70er das Verdecken von Täfelungen, das Herausreißen von Kaminen mit eisernem Gitterrost, das Überstreichen von Mauerwerk an der Fassade und das Kaschieren von hohen Räumen mittels Zwischendecken. Der moderne Haushalt kam in den 50ern in Mode, der goldenen Zeit der Design-Messen, Weltausstellungen und Verbraucherschauen mit Titeln wie This Is Tomorrow. Resopal und Chrom, Leuchtstoffröhren und das rigorose Entfernen von dekorativem Plunder wie Gesims und Stuck waren in jedem Mittelklassehaushalt unerlässlich. In den 80ern veränderte sich all das allerdings: Eingezogene Decken wurden entfernt, Kamine wieder freigelegt und Plastik-Türklinken durch die originalen aus Messing ersetzt. Fliesen und Holzdielen kamen wieder in Mode und alle möglichen Absonderlichkeiten wurden von Maklern und Kaufinteressenten als »originale Ausstattung« betrachtet. Darauf folgte ein wahrer Boom an Restaurierungen und architektonischen Rettungsaktionen – altmodische Emaille-Bäder und andere Armaturen wurden aus vom Abriss bedrohten Häusern, Schulen und Hotels geborgen – und es gab immer mehr »altertümelnde Marotten« (ein Begriff von Samuel Raphael) wie die Liebe zu artifizieller Abnutzung von Möbeln oder Baustoffen, künstlich gealterte Ziegel, die russfleckig oder durchlöchert aussahen.
Angesichts dieser konservatorischen Haltung, die unsere gesamte Kultur durchzieht, überrascht es nicht, wenn eine ganze Industrie entsteht, in der Rock als Kulturgut bewahrt wird. In diesem Zusammenhang ist es vollkommen logisch, beinahe unausweichlich, dass die Abbey-Road-Studios in Nordlondon per Beschluss des Kulturministerums erhalten werden oder dass zum 30. Todestag von Ian Curtis ein Stadtrundgang durch Macclesfield angeboten wird. »Rock gehört genauso zur Vergangenheit wie zur Zukunft«, sagt James Miller in seinem Buch Flower in the Dustbin, das seinen Titel einem Sex-Pistols-Song entlehnt, und in dem er behauptet, Rock habe bereits 1977 alle wesentlichen Bewegungen, Archetypen und Wege der Selbsterneuerung durchlaufen, so dass alles, was seither kam, entweder Recycling oder der Gang über ausgetretene Pfade sei. Ich würde nicht ganz so weit gehen. Aber wenn Huyssen die rhetorische Frage stellt »Warum bauen wir Museen, als gäbe es kein Morgen?«, frage ich mich, ob die Antwort lautet, dass wir uns das Morgen einfach nicht mehr länger vorstellen können.