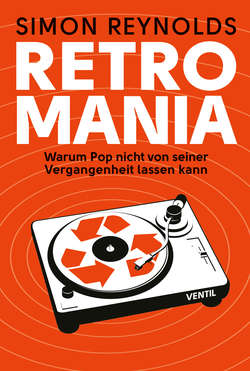Читать книгу Retromania - Simon Reynolds - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DEM ARCHIV VERSCHRIEBEN
ОглавлениеDer Titel eines Buches von Jacques Derrida, »Dem Archiv verschrieben« (im Original »Mal d’archive«), bezeichnet sehr gut den heute herrschenden dokumentarischen Fieberwahn, der nicht nur Institutionen und professionelle Historiker befallen hat und das Internet zu einem explosionsartig anwachsenden Amateur-Archiv macht. Bei all dieser Aktivität stellt sich ein Gefühl der Ekstase ein; es ist, als würden die Leute den Kram – Informationen, Bilder, Zeugnisse – in einer wahnwitzigen Raserei »dort hinein« schleudern, bevor unsere Gehirne simultan stillgelegt werden. Nichts ist zu banal, zu belanglos, um weggeworfen zu werden; jeder popkulturelle Schrott, jeder Trend und jede Mode, jeder nahezu in Vergessenheit geratene Künstler oder jede Fernsehsendung wird kommentiert und verurhebert. Das Ergebnis ist, wie überall im Netz zu beobachten, dass das Archiv zu einem Anarchiv verkommt: ein kaum überschaubares Durcheinander an Datenmüll und Erinnerungsschrott. Damit ein Archiv irgendeine Form von Seriosität bewahren kann, muss es gesichtet und sortiert und manche Erinnerungen dem Vergessen überlassen werden. Die Geschichte braucht einen Mülleimer, sonst wird sie zu einem Mülleimer, einer gigantischen, wuchernden Müllkippe.
Eine Mainstream-Erscheinungsform dieses Anarchivs ist die I Love the …-Reihe, die in den 2000ern extrem populär war. Ursprünglich die Idee des Produzenten Alan Brown für BBC2, wurden die Lizenzrechte an VH1 nach Amerika verkauft und ebenso inspirierten sie Channel 4 zu den Top 10-Sendungen. Die seichten und schnelllebigen I Love …-Sendungen boten eine Reihe zweitklassiger Comedians und unbedeutender Prominenter, die über die massenkulturellen Trends und Torheiten eines bestimmten Jahrzehnts witzelten: Soap-Operas, Kassenschlager, Popsongs, Frisuren und Mode, Spielzeug und Spiele, Skandale, Slogans und Redensarten. In den USA begann die Reihe 2002 mit den 80ern, machte einen Schritt zurück zu I Love the ’70s, ging dann über zu I Love the ’90s und Spin-Offs wie I Love Toys oder I Love the Holidays. Die zwanghafte Logik dieses Archivierungswahns beschleunigte die Serie so weit, dass die US-Version die Nullerjahre bereits 2008 in der Serie I Love the New Millennium zusammenfasste.
»Diese Sendungen wurden bis zum Erbrechen gespielt«, sagt Mark Cooper, der als kreativer Leiter der Musikabteilung des BBC-Fernsehprogramms im letzten Jahrzehnt die treibende Kraft hinter dem Boom von qualitativ hochwertigen Rockdokumentationen auf BBC2 und besonders auf BBC4 war. »Anfangs war schön, dass es noch darum ging, einen gewissen Sinn für Nostalgie zu erzeugen, aber es ging ihnen nicht ums Hinterfragen oder Verstehen. Sie wollten nur eine Kostprobe davon haben, nur mal schnuppern. Es ging meistens nur um ein ›Erinnert ihr euch an diese Frisur?‹ Nach einiger Zeit wurde die Sendung inhaltsleer, die von den Produktionsteams mehr als Show denn als Dokumentation betrachtet wurde. Die Vergangenheit wurde nicht als Geschichte, sondern als reine Nostalgie betrachtet.«
Geschichte ist eine Form, Realität zu bearbeiten. Damit eine historische Erzählung funktioniert, bedarf es eines Filters, ansonsten überschwemmt der Informationsmatsch den Erzählstrom. Die Dokumentationen, die Cooper für die BBC betreut, und besonders die »Britannia«-Reihe auf BBC4 (Folk Britannia, Blues Britannia, Prog Britannia, Synth Britannia etc.), sind das Gegenteil all der Shows, die einfach nur alles auflisten. »Sie rücken die Musikgenres von den 50ern bis in die Gegenwart in den Fokus und versuchen die Geschichte der britischen Musik als Suche nach einer Identität zu erzählen«, sagt Cooper. »So haben Jazz, Blues und Soul dazu beigetragen, uns von den 50ern zu emanzipieren.« In manchen Fällen passiert es, dass die Erzählungen mit der offiziellen Geschichtsschreibung brechen oder sie anzweifeln. Beispielsweise sagt Cooper, dass die Prog Britannia-Dokumentation mit dem »Klischee brach, alles vor Punk, vor 1976 sei langweilig und Mist gewesen. Diese ›offizielle‹ Sichtweise, dass die erste Hälfte der 70er Brachland war. Prog Britannia versuchte anhand der musikalischen Landschaft nach Sgt Pepper’s nachzuvollziehen, dass es einen Begriff von Musik gab, der über den Dreiminuten-Popsong hinausging. Kann sein, dass dieser Versuch schlussendlich misslang, aber vieles an diesen Bestrebungen war lobenswert.« Der springende Punkt ist, dass diese Dokumentationen versuchen, eine Geschichte zu erzählen, statt nur eine per Zufallsmodus generierte Anordnung kollektiver Erinnerung zu präsentieren: Sie bieten keine enzyklopädische Sammlung, sondern eine Gegenerzählung.
Die Britannia-Reihe und viele andere von Cooper initiierte BBC-Dokumentationen, haben in den Nullern zu einem wahren Boom von Rockdokus geführt, angefangen mit Julien Temples Punk-Trilogie (über die Pistols, Joe Strummer und Dr Feelgood) bis zu der erfolgreichen und preisgekrönten Geschichte über eine völlig untalentierte Metal-Band, Anvil! The Story of Anvil. Ein Grund für diesen Boom ist die Wirtschaftlichkeit. Mit kleinen Crews und einem geringen Budget (keine Drehbücher, keine Schauspieler, Kostüme, Requisiten und Effekte) lassen sich diese Filme billig produzieren. Bei vielen Rockdokus kostet das Archivmaterial am meisten. Cooper erzählt, dass sich sein Budget pro Sendung zwischen 120.000 und 140.000 Pfund bewege – und davon ginge meist ein Viertel für Archivmaterial drauf. »Wir haben hier zwei Leute, die mit dem Beschaffen des Archivmaterials beschäftigt sind«, sagt er und erklärt, dies erfordere oft die Zusammenarbeit mit kommerziellen Archiven und Agenturen, die Filmmaterial erwerben und lizensieren. Laut Cooper »realisiert die Industrie inzwischen die Bedeutung der Archivare. Es gibt erst seit Kurzem eine Auszeichnung für Archivare, die beim Fernsehen arbeiten, den Focal Award.« Er führt aus, dass die BBC selbst mit der Lizenzierung ihres Archivs eine Menge Geld verdient und gerade die Möglichkeit auslotet, ihr ganzes Archiv ins Netz zu stellen. Intern wird darüber diskutiert, ob das Archiv kommerziell oder frei zugänglich sein soll. Die BBC könnte von »Leuten Geld verlangen, weil sie Sachen runterladen« oder sie könnte die Sachen frei zur Verfügung stellen wie das Britsh Library Sound Archive, das kürzlich große Teile seiner Sammlung ins Netz gestellt hat.
Ein weiterer Grund für die Zunahme an Dokus sind die stetig wachsenden Möglichkeiten, sie zu zeigen und zu sehen. Dabei ist das nicht so oft in Kinos der Fall – wenn auch die hochkarätigsten Rockdokus wie Anvil! oder die Metallica-Dokumentation Some Kind of Monster auf der Leinwand mit großem Erfolg liefen –, sondern es liegt vor allem am Boom von Kabel- und digitalen Fernsehkanälen. Auch wenn die Dokus manchmal nur als Programmfüller gesendet werden, sorgen sie dafür, dass Sender wie BBC4 und Channel 4 in Großbritannien und Sundance sowie VH1 Classic in den USA sowohl die Babyboomer-Generation als auch ein junges Publikum ansprechen. Erstere genießen es, die klassische Rock-Ära, die sie selbst erlebt haben, immer und immer wieder durchgekaut zu bekommen; letztere genießen es, die klassische Rock-Ära, die sie nicht selbst erlebt haben, immer und immer wieder durchgekaut zu bekommen.
Das Ergrauen der Babyboomer-Generation – und damit auch das der Punk-Generation – ist eine weitere Erklärung für diesen Boom. Der Großteil der Rockdokus dreht sich um die 60er und 70er, eine Zeit, die scheinbar ein unerschöpfliches Potential birgt, wieder und wieder aufgewärmt zu werden. »Ich denke, das liegt daran, dass wir nicht genug Kriege erlebt haben«, scherzt Mark Cooper. Er schätzt, dass die goldene Zeit des Rock – von Dylan und den Beatles bis hin zu Glam und Punk – ein kollektives Bedürfnis nach Sinn befriedigt. Diese Idee wird von dem Nostalgie-Forscher Fred Davis gestützt, der über die »Gegenwärtigkeit« von Epochen voller Dramatik, in denen die Menschen mit drastischen Veränderungen zu kämpfen hatten, geschrieben hat. Diejenigen, die die Depression oder den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, schauen mit paradoxer Wehmut auf »die besten Jahre ihres Lebens« zurück, die Gefahren, die Entbehrungen und ignorieren dabei den Verlust von Angehörigen und andere Schicksalsschläge. »Die Leute sagen immer, dass ihre Eltern nie vom Krieg erzählt hätten«, sinniert Cooper. »Wir dagegen erzählen immer und immer wieder von unseren ›Kriegs‹-Erlebnissen. Vor allem die Sixties-Generation, die 60er waren so eine turbulente Zeit, in der es so viele Veränderungen gab. Es ist ein sehr lebendiges Jahrzehnt, politisch, sozial und kulturell. Ich denke, dass Popkultur einfach eine Variante der Frage ›Was hast du im Krieg gemacht, Papa?‹ ist.«