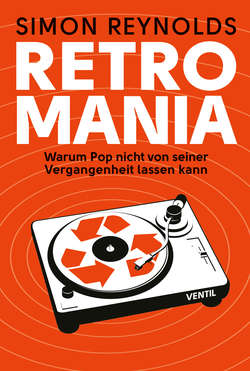Читать книгу Retromania - Simon Reynolds - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DER AUSVERKAUF DER GEGENWART
Оглавление»Popmusik ist heute viel flüchtiger«, sagt der für den Einzelhandel zuständige Billboard-Redakteur Ed Christman. Ich habe Christman kontaktiert, weil ich herausfinden wollte, ob die Konsumenten heutzutage mehr alte Musik kaufen. Er erklärte mir, dass die Industrie bei Veröffentlichungen zwischen »aktuell« (die Zeitspanne vom Erscheinungstermin bis 15 Monate nach VÖ) und »Katalog« (ab dem 16. Monat nach VÖ) unterscheidet. Aber auch der Katalog wird in zwei Kategorien unterteilt: in jene, die noch relativ aktuell ist, und Dinge, die aus den »Tiefen« des Katalogs stammen, wozu Musik drei Jahre nach der Veröffentlichung zählt. Christmans Wahrnehmung war, dass der relativ aktuelle Katalog (Veröffentlichungen, die zwischen 15 Monaten und drei Jahren alt sind) »nicht so gut geht wie früher«. Außerdem sind die Karrieren von Bands kürzer geworden, auf erfolgreiche Debüts folgen Flops, der größte Teil von Bands, die Bestand haben, sind Überbleibsel aus den 60ern, 70ern und 80ern.
Als wir auf mein Hauptinteresse zu sprechen kamen – das relative Verhältnis zwischen dem Verkauf alter Musik und dem Verkauf neuer Musik –, grub Christman ein paar Statistiken aus. Im Jahr 2000, erklärte er, waren 34,4 Prozent aller Albenverkäufe in den USA die Katalogverkäufe (wozu der jüngere und der ältere Katalog gerechnet wurde), während die aktuellen Produktionen bei 65,6 Prozent standen; bis zum Jahr 2008 war der Katalogverkauf auf 41,7 Prozent angestiegen, während die aktuelle Rate bei 58,3 lag. Das scheint keine so dramatische Veränderung zu sein, aber laut Christman ist diese beständige Verschiebung Jahr für Jahr hin zur Backlist während der 2000er sehr bezeichnend. Sie widerspricht einem völlig stabilen Verhältnis von Aktuellem und Katalog, wie es die gesamten 90er über Realität war. Frühere Zahlen liegen nicht vor.
Was diesen Anstieg noch beachtlicher macht, ist der Umstand, dass es für die Konsumenten aufgrund des himmelschreienden Niedergangs des Musikeinzelhandels tatsächlich schwerer geworden war, an nicht-aktuelle Veröffentlichungen zu kommen. »Alle alteingesessenen Plattenläden verfügten über diese Backlist-Sachen, aber viele von ihnen mussten ihr Geschäft aufgeben«, sagte Christman. Diejenigen, die überlebten, waren gezwungen, Non-Music Produkte wie etwa Spiele in ihr Sortiment aufzunehmen, was dazu führte, dass sie das Angebot an Musiktiteln auf Lager drastisch reduzierten. Borders hatte im Jahr 2000 noch 50.000 Titel im Programm, bis 2008 war diese Zahl auf unter 10.000 gesunken, so Christman.
Aber wenn die Masse der Klassiker aus den Plattenläden verschwunden ist, deren Zahl selbst immer weiter abnahm, wirft das eine Frage auf: Wie konnten die Verkäufe alter Musik im letzten Jahrzehnt zunehmen? Teilweise lässt sich das durch den Erfolg von Online-Händlern wie Amazon erklären, die aufgrund günstiger Einkäufe und Lagerhallen große Mengen vorrätig halten können. Es gab auch bestimmte Katalogtitel, die als »heißer Scheiß«, wie Christman es ausdrückt, wieder veröffentlicht wurden: Jubiläumseditionen und Deluxe-Doppel-CDs, die wie Neuerscheinungen aufgemacht und beworben und in den Plattenläden entsprechend ausgestellt wurden. Schließlich gab es noch den Anstieg der digitalen Verkäufe: Die iPod-Explosion erweckte bei vielen Musikfans die erloschene Begeisterung für Musik wieder, da sie zum ersten Mal in der Lage waren, einzelne Tracks anstelle ganzer Alben zu kaufen – einiges davon war alte Musik, ein Katalog-Boom, der mit den CD-Wiederveröffentlichungen klassischer Alben seit Mitte der 80er vergleichbar ist. Christman erklärte, 2009 sei »das erste Jahr gewesen, in dem Soundscan bei ihren digitalen Verkäufen zwischen Katalog und aktuellen unterschied«, was zeigte, dass der Katalog »die Mehrheit der digitalen Track-Verkäufe ausmachte, 64,3 Prozent gegenüber den 35,7 Prozent des Aktuellen«. Ich vermute, dass es einen vergleichbaren Trend zu alter Musik bei illegalen Downloads gibt. Das leuchtet ein: Die Vergangenheit kann gar nicht anders, als die Gegenwart zu übertrumpfen, nicht nur bezüglich der Quantität, sondern auch qualitativ. Nehmen wir einmal an, nur hypothetisch, jedes Jahr würde durchschnittlich gleichviel großartige Musik produziert werden (ohne die Schwankungen in speziellen Genres). Das würde bedeuten, dass die brillante Ernte eines Jahres mit einer immer umfangreicher werdenden Halde, angefüllt mit Großartigkeit, konkurrieren müsste. Wie viele Platten von 2011 sind für einen neuen Hörer so erwerbenswert wie Rubber Soul, Astral Weeks, Closer oder Hatful of Hollow?
Die Idee des Backkataloges ist zentral für Chris Andersons viel diskutierte und an machen Stellen widersprüchliche Long-Tail-Theorie. Die Argumentation kennen wir aus technologischen Utopien, die im Wired so oft zu lesen waren, wo Andersons Artikel ursprünglich erschienen sind, bevor daraus der Bestseller The Long Tail. Nischenprodukte statt Massenmarkt – Das Geschäft der Zukunft wurde. Er argumentiert, die durch das Internet entstandene Handelsstruktur habe das Verhältnis zugunsten des kleinen Mannes gewendet (der einzelne mutige Unternehmer, die kleinen Independent-Verlage und -Labels, die Nischen-Künstler), im Gegensatz zu den großen Unterhaltungsindustrie-Konglomeraten, die mit ihren riesigen Startverkäufen und teuren Werbekampagnen nur auf Blockbuster und Megastars fixiert sind.
Der faszinierende Subtext der Long-Tail-Theorie zeigt, dass die Landschaft der neuen Medien auch das Gleichgewicht zugunsten der Vergangenheit und zu Ungunsten der kulturellen Gegenwart verschiebt. Gleich am Anfang seines Artikels für Wired im Oktober 2004 berichtet Anderson von Bestseller-Memoiren übers Bergsteigen (In eisigen Höhen. Das Drama am Mount Everest), deren Erfolg die Käufer unmittelbar auf ein viel älteres Buch zu dem gleichen Thema von einem anderen Autor (Sturz ins Leere. Ein Überlebenskampf in den Anden) aufmerksam gemacht hat – mit Hilfe des »Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch …«-Algorithmus von Amazon und den Empfehlungen anderer Leser. Das Anden-Buch war bis dahin nur mäßig erfolgreich und stand kurz davor, nicht mehr lieferbar zu sein, aber dank In eisigen Höhen wurde es wieder aufgelegt und zum Bestseller. Anderson beschreibt, wie Amazon »das Sturz-ins-Leere-Phänomen durch die Kombination von unendlichem Lagerraum und Echtzeit-Informationen über Verkaufs-Trends und die öffentliche Meinung erzeugt hat«, und charakterisiert die »daraus resultierende Nachfrage für ein obskures Buch« als Sieg der Marginalisierten über den Mainstream, einen der Qualität über den marktführenden Einheitsbrei. Aber wenn Anderson frohlockt, dass »die Verkaufzahlen von Sturz ins Leere mehr als doppelt so hoch sind wie bei In eisigen Höhen«, beschreibt er tatsächlich einen Fall, bei dem die Vergangenheit die (damalige) Gegenwart schlägt – 1988 lässt 1999 alt aussehen.
Die zentrale These der Long-Tail-Theorie lautet, dass »die Tyrannei des physischen Raumes« durch das Internet überwunden wird. Einzelhändler waren vor der Netz-Ära auf die Anzahl an Käufern beschränkt, die den Laden physisch erreichen konnten. Außerdem war die Lagerkapazität beschränkt – je näher an dicht besiedelten Gegenden, desto teurer der Lagerraum. Aber das Internet ermöglicht es Firmen, in abgelegenen Gegenden für wenig Geld Lagerhäuser mit einem großen Fassungsvermögen in noch nie dagewesenem Ausmaß für ihren Bestand zu mieten. Sie können auch ein geografisch weit verteiltes Nischen-Publikum erreichen, und damit das Problem »eines Publikums, das so verstreut ist«, dass es praktisch »keins ist«, überwinden. Aber Long-Tail behauptet auch einen Sieg über die Tyrannei der Zeit: die Herrschaft des Aktuellen und Brandneuen im Einzelhandel. Im herkömmlichen Handel werden Lager- und Ladenraum über die Einnahmen finanziert, darum lohnt es sich, in einem Plattenladen eine aktuelle CD oder in einer Videothek eine DVD im Regal besonders hervorzuheben; an einem bestimmten Punkt muss man die älteren Sachen reduzieren oder loswerden. Wenn der Lagerraum drastisch billiger wird, weil eine niedrige Miete bezahlt wird, oder durch die Digitalisierung fast auf Null sinkt (das Online-Repertoire von Netflix an Filmen und Fernsehserien, digitale Musikfirmen wie iTunes und eMusic), resultiert daraus eine massive Ausweitung des Bestands. Wenn die Auslagen des Geschäfts online und virtuell sind, gibt es auch überhaupt keinen Grund, die älteren, sich nur schleppend verkaufenden Sachen schnell los zu werden, um Platz für neuere Waren zu schaffen.
»Von DVDs bei Netflix über Musikvideos bei Yahoo! … bis hin zu Songs im iTunes Music Store und Rhapsody«, freut sich Anderson, »wühlen die Leute tief im Katalog, durchsuchen die endlose Liste verfügbarer Titel viel weiter als die Angebote bei Blockbuster Video, Tower Records und Barnes & Noble«. »Viel weiter« heißt viel weiter in die Vergangenheit, kann aber auch heißen, jenseits des Mainstream, hin zu abseitiger Independent-Label-Kultur und exotischen Importen. Da bei den verschwindend geringen Mieten wenige Verkäufe über einen langen Zeitraum immer noch als Gewinn gelten, glaubt Anderson, dass Long-Tail es mit sich bringe, »große Teile des Archivs« zum kleinen Preis verfügbar zu halten. Er rät der Musikindustrie ausdrücklich, »den gesamten Backkatalog so schnell wie möglich« wieder zu veröffentlichen – »ohne Skrupel, automatisch und im großen Stil«. Dies ist auch im letzten Jahrzehnt mehr oder weniger passiert und hat bereis in den 90ern begonnen, von den Labels selbst oder von spezialisierten Unternehmen initiiert, die die Backkataloge von älteren und größeren Labels nach den Soloalben von Bassisten berühmter Bands, den Nebenprojekten, Aufnahmen vor dem Durchbruch oder nach dem Ruhm durchsuchten.
Das Ergebnis war eine stärkere Hinwendung zu älteren Produktionen. In gewisser Weise stand die Vergangenheit kulturell betrachtet immer schon in Konkurrenz zur Gegenwart. Aber das Feld hat sich in den späten 90ern und frühen 2000ern peu à peu zum Vorteil der Vergangenheit verschoben, vor allem dank neuer Entwicklungen wie dem Internetradio und der mit dem Internet verbundenen »unendlichen Jukebox«, die es den Usern erlaubt, auf mehr als zwei Millionen Lieder zuzugreifen.
Diesen jüngsten Erfindungen liegt der grundsätzliche Wechsel von analog zu digital zugrunde: Von Aufnahmen, die auf analogen Wellenformen basierten (Vinyl, Magnetbänder) hin zu Aufnahmen, die mit dem Kodieren und Dekodieren von Informationen arbeiten (CD, MP3s). Diese Revolution war von der Musikindustrie in den 80ern vorangetrieben worden und hat dabei offensichtlich die eigene Achillesferse getroffen: Es ist viel einfacher, Ton und Video zu kopieren, wenn sie als Daten gespeichert sind. Eine analoge Vinyl-Platte kann nur in Echtzeit überspielt werden, die magnetisch gespeicherte Information auf einer Ton- oder Videokassette kann nur mit gering erhöhter Geschwindigkeit überspielt werden, sonst ist der Qualitätsverlust zu hoch. Die digitale Kodierung ermöglicht ein viel schnelleres Kopieren mit minimalem Qualitätsverlust. Die Kopie einer Kopie einer Kopie ist im Prinzip das Gleiche wie das Original, weil die digitale Information, die nur aus Nullen und Einsen besteht, reproduziert wird.
Die Folgen dieses Paradigmenwechsels traten sehr bald nach der Einführung einer Software zum Dekodieren von MP3s im Juli 1994 auf, ein Jahr später gab es den ersten MP3-Player (WinPlay3). MP3 war vom Fraunhofer-Institut mit dem Ziel entwickelt worden, ein weltweites Standardmedium für die digitale Ton- und Video-Unterhaltungsindustrie zu liefern, und es verbreitete sich in den späten 90ern immer weiter. Aber richtig los ging es erst mit der Verbesserung der Bandbreite und dem großen Erfolg der Peer-to-Peer-Filesharing-Netzwerke und -Anbieter (Napster, BitTorrent, Soulseek etc.). Der Wesenskern von MP3 ist die Komprimierung. Raum (die klangliche Tiefe einer Aufnahme) wird mit einem viel geringeren Materialaufkommen als bei einer Vinylschallplatte, einer analogen Tonkassette oder selbst der laserbeschriebenen CD reduziert, während die Zeit ähnlich komprimiert wird, da es viel schneller geht, eine Kopie zu erstellen oder ein Musikstück im Internet zu übermitteln, als die tatsächliche Dauer der musikalischen Erfahrung anhalten würde.
Jonathan Sterne, Experte für Musiktechnik, erklärt, Fraunhofer habe die MP3 entwickelt, indem »ein mathematisches Modell des menschlichen Hörspektrums« ausgearbeitet wurde, um herauszufinden, welche Daten sie entfernen könnten, weil der Durchschnittshörer in der durchschnittlichen Hörsituation sie nicht bemerken würde. Die technischen Abläufe sind komplex und schwer verständlich (beispielsweise werden Teile des Frequenzspektrums in Mono konvertiert, während andere – der Bereich des Hörspektrums, den die meisten Hörer wahrnehmen – Stereo bleiben). Das Ergebnis dieses Prozesses ist die charakteristische Flachheit des Klangbildes und die dünne Struktur, an die wir uns durch das ständige Hören von MP3s gewöhnt haben. (Natürlich fällt die Verkleinerung des klanglichen Reichtums nur denen unter uns auf, die alt genug sind, um auch noch Vinyl oder CD gehört zu haben, während für viele junge Hörer, die MP3 und Musik über Computerboxen und iPods hören, das einfach der Klang von Musikaufnahmen ist.) Der Komfort der MP3s hinsichtlich des einfachen Teilens, der Anschaffung und der Portabilität (was die Industrie »Place-Shifting« nennt, das Bewegen der Musik zwischen verschiedenen Abspielgeräten und Abspielen in verschiedenen Zusammenhängen) hat dazu beigetragen, dass wir den qualitativ schlechteren Sound akzeptiert haben. Abgesehen davon sind die meisten Musikfans keine Audiophilen, die der bloßen Klangwiedergabe und vagen Qualitäten wie »Präsenz« verfallen sind. Audiophile sind für gewöhnlich Analog-Fanatiker, die auf 180-Gramm-Vinyl und Plattenspieler stehen, die extrem teuer sind. Tatsache ist jedoch, dass es selbst im Bereich der digitalen Musik einen riesigen Unterschied zwischen MP3 und der CD gibt. Ab und an bekomme ich die CD-Version eines Albums, das ich großartig finde und bisher nur als Download kenne, und ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich mit den verschiedenen Dimensionen und der Räumlichkeit der Musik, der klaren Form des Schlagzeugs, der Lebendigkeit des Sounds konfrontiert bin. Der Unterschied zwischen CD und MP3 ist vergleichbar mit frisch gepresstem Orangensaft und Saft, der aus Konzentrat hergestellt wurde. (Bei diesem Vergleich wäre Vinyl wahrscheinlich frisch gepresster Saft.) Das Konvertieren der MP3s ähnelt diesem Konzentrationsprozess, und wird auch aus dem gleichen Grund gemacht: Es ist viel billiger, das Konzentrat zu transportieren, da es ohne Wasser viel weniger Platz braucht und weniger wiegt. Den Unterschied schmecken wir aber alle.