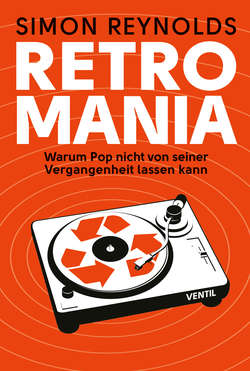Читать книгу Retromania - Simon Reynolds - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
SURFEN UND SKIPPEN
ОглавлениеDie Erfinder der MP3 bauten darauf, dass die meisten Menschen nicht so genau hinhören und nicht unter idealen Bedingungen hören. Laut Sterne war die MP3 in der Annahme entwickelt worden, dass die Hörer entweder eigentlich anderen Aktivitäten nachgingen oder sich in einer lauten Umgebung befänden, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto, an einer vielbefahrenen Straße. »Die MP3 ist für den massenhaften Tausch, beiläufiges Zuhören und massenhafte Anhäufung entworfen worden«, erörtert er. Genauso wie Konzentrat nicht für den Geschmack gemacht ist, sind gezippte und wieder entpackte Sounddateien nicht für den besonderen Hörgenuss geeignet. Die MP3, das Ton-Äquivalent zu Fast Food, ist das ideale Format für ein Zeitalter, in dem man immer mit der gegenwärtigen Musik, mit all ihren wechselnden Mikro-Trends und endlosen kostenlosen Podcasts und DJ-Mix-Sets Schritt halten möchte.
Daher haben viele der konsumentenfreundlichen Entwicklungen der digitalen Ära mit dem Zeitmanagement zu tun; die Freiheit, während einer Fernsehsendung unaufmerksam zu sein oder unterbrochen zu werden (Pause, Zurückspulen), die Fernsehzeit auf einen regnerischen Tag aufzuschieben (bespielbare DVDs, TiVo). Das Auftauchen der CD-Player Mitte der 80er vermittelte einen ersten Eindruck davon, wie Musik durch Digitalisierung beeinflusst werden würde. Anders als Plattenspieler und die meisten Kassettendecks verfügten CD-Player üblicherweise über eine Fernbedienung. Ein Plattenspieler ist ein unhandliches, mechanisches Gerät, mit dem man Klangwellen, die in Vinylrillen geritzt sind, anhören kann, der CD-Player ist eine Maschine, mit der Daten decodiert werden und es lässt sich daher viel leichter pausieren, von einem Track zum nächsten springen etc. Der CD-Player führte uns in Versuchung, das Musikhören zu unterbrechen; um an die Haustür oder auf die Toilette zu gehen, um zu seinen Lieblingsliedern vorzuspringen oder auch bloß zu der Lieblings-Stelle eines Tracks. Die CD-Fernbedienung, im Wesentlichen das gleiche wie eine TV-Fernbedienung, unterwarf die Musik der Macht des Zappens.
Damit brach eine neue digitale Epoche in der Wahrnehmung von Zeit an – die uns mittlerweile völlig vertraut ist. Und mit jedem Gewinn zugunsten der Bequemlichkeit der Konsumenten geht ein Verlust der Macht der Kunst einher, unsere Aufmerksamkeit zu beherrschen, um schließlich eine ästhetische Kapitulation einzuleiten. Das bedeutet, dass unser Gewinn gleichermaßen unser Verlust ist. Es wird außerdem deutlich, dass die zerrüttete Zeiterfahrung unseres Netzwerk-Alltags nicht gut für die Gesundheit ist; wir werden ruhelos, es zerfrisst unsere Fähigkeit, uns auf den Augenblick zu konzentrieren. Wir unterbrechen uns ständig selbst, kappen den Wahrnehmungsstrom.
Nicht nur unser Umgang mit Zeit ist davon beeinflusst, sondern auch der mit Raum. Die Einheit des »Hier« ist genauso zerstückelt wie die Einheit des »Jetzt«. Forschungen von Ofcom, der britischen Medienaufsichtsbehörde, haben ergeben, dass sich zwar Familien noch im Wohnzimmer treffen, um fernzusehen, aber nur teilweise anwesend sind, da sie SMS schreiben oder im Netz surfen. Sie sind mit sozialen Netzwerken verbunden, während sie sich an den Busen der Familie schmiegen, ein Syndrom, das »Connected Cocooning« getauft wurde. Genauso wie das Internet die Gegenwart durch Wurmlöcher in die Vergangenheit zerbröckeln lässt, wird der intime Raum der Familie durch telemetrische Informationsströme der Außenwelt kontaminiert.
In den letzten Nullerjahren gab es eine Flut von Artikeln über den gefährlichen Einfluss des Internets auf unsere Konzentrationsfähigkeit und, damit einhergehend, Geständnisse von Leuten, die ihre Internetsucht überwinden wollten, indem sie permanent offline gingen. In seinem berühmten Essay für Atlantic, »Is Google Making Us Stupid?«, beklagte Nicholas Carr 2008 seine De-Evolution von »einem Taucher in einem Meer aus Wörtern« hin zu jemandem, der »auf der Oberfläche entlangschwirrt wie auf Jet-Skiern«, und er zitierte das traurige Eingeständnis des Pathologen und Medizin-Bloggers Bruce Friedman, er habe den Eindruck, dass sein Denken eine »Stakkato«-Qualität angenommen habe: »Ich kann Krieg und Frieden nicht mehr lesen, ich habe die Fähigkeit dazu verloren. Selbst ein Blog-Eintrag mit mehr als drei oder vier Absätzen ist zu viel, um es aufzunehmen, ich überfliege das nur.«
Carrs Essay, den er 2010 zum Buch Wer bin ich, wenn ich online bin … und was macht mein Gehirn solange? Wie das Internet unser Denken verändert ausbaute, provozierte eine Vielzahl von Kommentaren, in manchen wurde er erwartungsgemäß als Technikfeind beschimpft, aber häufiger wurde ihm zugestimmt: Unsere vernetzte Existenz beeinträchtigt die Fähigkeit zu konzentriertem Arbeiten und erfüllender Versunkenheit. Im Webzine Geometer griff Matthew Cole Carrs Argument über Hyperlinks auf (»anders als Fußnoten … verweisen sie nicht nur auf ähnliche Arbeiten, sie treiben dich zu ihnen hin«), um das Leben als »einen permanenten Zustand der Beinahe-Entscheidung« zu beschreiben: als unschlüssigen Aufschub des Überspringens und Überfliegens, der »die Illusion von Aktivität und Entscheidung« suggeriert, aber in Wirklichkeit nur eine heimtückische Lähmung ist.
In vielerlei Hinsicht ist dieses flatterhafte Stadium der Ablenkung die angemessene Reaktion auf den Überfluss an Angeboten. Die für einen Autor schreckliche Memo »tl dr« (too long, didn’t read) wurde bisher noch nicht um »tl dl« und »tl dw« (too long, didn’t listen; too long didn’t watch) ergänzt, aber das kann nur eine Frage der Zeit sein, da viele von uns bestätigen können, dass wir bei einem YouTube-Video vorwärts scrollen. Der Name für diesen Zustand lautet Aufmerksamkeitsdefizitstörung, aber wie so viele Leiden und Dysfunktionen liegt diese Störung weder im Patienten, noch ist sie seine oder ihre Schuld; sie wird von der Umgebung ausgelöst, in diesem Fall von der Datenlandschaft. Unsere Aufmerksamkeit ist zerstreut, gereizt, gequält. Bisher gibt es in der Musik kein Äquivalent zum Querlesen; man kann das Zuhören selbst nicht beschleunigen (freilich kann man vorwärts skippen oder in der Mitte abbrechen). Aber man kann hören, während man andere Dinge tut; ein Buch oder eine Zeitschrift lesen oder im Internet surfen. Die Untiefen bei Carr beziehen sich auf die Oberflächlichkeit, mit der Musik oder Literatur beim Multitasking erfahrungsgemäß rezipiert werden, auf den blasseren Eindruck, den sie in unseren Köpfen und Herzen hinterlassen.
Die Umgestaltung von Zeit und Raum in der Internet-Ära schlägt sich auch in der Selbstwahrnehmung wieder, man fühlt sich ausgedehnt und vollgestopft. Der Dramatiker Richard Foreman gebrauchte das Bild von den »Pfannkuchen-Menschen«, um zu beschreiben, wie »breit und platt gewalzt« es sich anfühlt, »durch einen bloßen Mausklick mit dem gewaltigen Netzwerk aus Information verbunden zu sein«. Er stellt dem die reichhaltigen Tiefen eines gebildeten Selbsts gegenüber, das durch eine vorwiegend literarische Kultur geformt wurde, wo die Identität komplex und »kathedralen-artig« ist. Auch während ich hier vor dem Computer sitze, fühle ich mich gestresst und angespannt. Mein Selbst und der Bildschirm werden eins, die verschiedenen Seiten und Fenster, die gleichzeitig offen sind, führen zu einer »permanenten Teil-Aufmerksamkeit« – der Begriff wurde von der Microsoft-Managerin Linda Stone geprägt, um das zersplitterte Bewusstsein zu beschreiben, das durch das Multitasking entsteht. Die »Gegenwart«, die ich bewohne, fühlt sich ziemlich plattgewalzt an, ein Hier-und-Jetzt ist von unzähligen Pforten in ein Anderswo und Anderswann durchbohrt.
Vor einiger Zeit erfasste mich eine seltsam schmerzhafte Nostalgie nach Langeweile, einem Gefühl absoluter Leere, mit dem ich als Teenager, als Student oder als arbeitsloser Faulenzer in meinen frühen Zwanzigern so vertraut war. Diese große gähnende Kluft aus Zeit, die man mit wirklich gar nichts füllen konnte, war ein so intensives fast schon spirituelles Gefühl der Langeweile. Das war vor dem digitalen Zeitalter, als es in Großbritannien gerade einmal drei oder vier Fernsehsender gab, auf denen meist nichts lief; nur eine Handvoll gerade so erträglicher Radiosender; keine Videotheken oder Läden, in denen man DVDs kaufen konnte; kein E-Mail, keine Blogs, keine Webzines, keine sozialen Medien. Um die Langeweile zu vertreiben, verließ man sich auf Bücher, Zeitschriften, Platten, alles beschränkt auf das, was man sich leisten konnte. Man hat sich vielleicht auch ins Verderben gestürzt, in Drogen oder Kreativität geflüchtet. Es bestand eine kulturelle Ökonomie des Mangels und der Verzögerung. Als Musikfan wartete man, bis irgendetwas erschien oder gesendet wurde: ein Album, die Ausgaben der Weeklys, Peels Radiosendung um zehn Uhr abends, Top of the Pops am Donnerstag. Es gab lange Zeitspannen, die die Erwartungen schürten, und wenn man die Sendung, Peel oder ein Konzert verpasst hatte, dann waren sie unwiederbringlich verloren.
Heute verhält es sich mit der Langeweile anders. Sie ist mehr Übersättigung, Zerstreuung, Ruhelosigkeit. Ich langweile mich oft, aber das liegt nicht am fehlenden Angebot: tausende Fernsehsender, die Unerschöpflichkeit von Netflix, zahllose Internetradiosender, unzählige ungehörte Alben, ungesehene DVDs und ungelesene Bücher, das labyrinthische Archiv von YouTube. Bei der heutigen Langeweile geht es nicht um Hunger als Antwort auf die Entbehrungen; es geht um den Verlust des kulturellen Appetits als Reaktion auf die Übersättigung unserer Ansprüche bezüglich unserer Aufmerksamkeit und unserer Zeit.