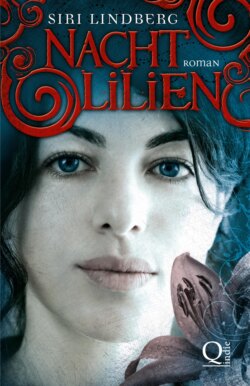Читать книгу Nachtlilien - Siri Lindberg - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Fluch
ОглавлениеDie ganze Situation kam Jerusha unwirklich vor. Bei einem flüchtigen Blick durchs erleuchtete Fenster der KiTenaros hätte man denken können, dass hier Großmutter, Mutter und Tochter spät in der Nacht vertraut am Esstisch beisammen saßen. Erst auf den zweiten Blick wäre demjenigen vielleicht aufgefallen, wie verkrampft ihre Haltung war.
„Der Fluch ist meine Schuld“, sagte Jerushas Großmutter. Ihr Gesicht war verzerrt wie durch einen in ihrem Inneren wütenden Schmerz, und ihre Hände krümmten sich auf der Tischplatte wie Klauen. „Ich habe ihn über uns gebracht, vor langer Zeit, als deine Mutter noch ein Kind war.“
„Aber wie kann das sein?“ flüsterte Jerusha. „Ich dachte, Flüche seien wie ein Gewitter – Blitz und Donner und dann wieder blauer Himmel. Harte Worte, die nichts weiter bedeuten und höchstens die Seele verletzen.“
„Das dachte auch ich. Aber es gibt Flüche, die sehr mächtig sind. Und so stark, dass sie von der Mutter auf die Tochter und die Enkeltochter übergehen. Ich habe es selbst nicht geglaubt. Bis ich es erlebt habe.“
„Also bin auch ich verflucht?“
„Ja. Dich wird es treffen. Und Liri. So wie es bisher alle Frauen der KiTenaros getroffen hat.“
„Was bedeutet das?“ Jerusha merkte, dass ihre Stimme laut geworden war, doch es war ihr egal. „Was soll das heißen, Verrat? Meinst du damit, dass ich meinen Mann betrügen werde? Völlig irrsinnig. Das kann ich nicht glauben!“
„Es ist nicht irrsinnig“, sagte ihre Mutter müde. „Schieb es nicht weg. Das wird dir auch nicht helfen.“
Jerusha starrte sie an und begann zu ahnen, warum ihre Mutter nur noch in Gleichgültigkeit dahindämmerte. War dieser Fluch für das Zerwürfnis zwischen ihren Eltern verantwortlich gewesen? Das Ergebnis jedenfalls, das kannte sie. Ganz plötzlich war es vorbei gewesen mit dem Glück in der Familie, als habe eine riesige Hand es einfach weggewischt, während Jerusha mit Kianna am Teich spielte. Schon kurz darauf war ihr Vater fortgegangen, und alle schwiegen und sahen sich seltsam an, wenn Jerusha verstört fragte, wieso.
„Erzähl mir, was passiert ist“, sagte Jerusha zu ihrer Großmutter und zwang sich dabei zu einem ruhigeren Ton. „Wie hast du den Fluch über uns gebracht? Vielleicht ist es ja nur Zufall, dass unserem Clan so viel Schlimmes geschehen ist. Pech. Schicksal. Kann das nicht sein?“
„Ich berichte dir, wie alles begann. Dann urteile selbst.“ Die Stimme ihrer Großmutter klang brüchig, und Jerusha ging zum Wasserfass, um ihr und ihrer Mutter etwas zu Trinken zu holen. Nach einem Schluck wirkte Kala wieder etwas kräftiger. „Damals hatten wir eins der prächtigsten Gasthäuser von Benaris, die Faunenmühle. Fenvar – dein Großvater, du kanntest ihn ja noch – und ich. Die KiTenaros waren ein mächtiger Clan damals, und mein Vater war sein Oberhaupt, der Earel; einmal im Jahr versammelten sich alle unsrigen in der Faunenmühle, vier Dutzend Menschen aus der ganzen Gegend.“
Schon jetzt wunderte sich Jerusha. Wieso in Benaris? Stammen die KiTenaros von dort? Aber warum leben sie dann jetzt im Fürstentum Kalamanca, südlich von Benaris? Neu war ihr auch, dass ihr Clan einmal groß und mächtig gewesen war. Sie kannte kaum ein Dutzend Verwandte, und keiner von ihnen besaß auch nur einen Hauch von Reichtum oder Macht. Seit vor einem Jahreslauf Jerushas Großonkel Barmín gestorben war, hatten die KiTenaros nicht einmal mehr einen Earel, und das war wirklich eine Schande.
„Zwei Tage vor diesem Ereignis war ich natürlich sehr beschäftigt damit, alles vorzubereiten, Speisen und Getränke zu beschaffen und so weiter. Und Fenvar dachte, wie so oft in dieser Zeit, nicht daran, mitzuhelfen – er ging in die Berge und ich musste mit meinen Kindern, dem Koch, einem Stallknecht und einer Magd alles alleine schaffen. Kurz, ich war nicht in bester Stimmung.“ Ihre Großmutter seufzte. „Doch es lag nicht nur an mir. Auch dieser Fremde im grauen Umhang war von Anfang an sehr schwierig. Er behauptete, der Wein sei saurer als Essig und das Essen ein Fraß für die Hunde. Gleichzeitig war er sehr galant zu mir, machte mir Komplimente zu meinem Aussehen und küsste sogar meine Hand. Es war mir unangenehm, aber ich tat das alles mit einem Scherz ab und ließ neuen Wein bringen, den besten im Keller. Doch der Fremde war nicht zufrieden und meinte, vermutlich seien die Gästezimmer unbewohnbar und voller Läuse. Da wurde ich wütend und sagte ihm, wenn es ihm hier nicht passe, dann könne er ja weiterziehen, wir bräuchten ihn und seinesgleichen nicht.“
Jerusha ahnte, worauf das alles hinauslief. Doch sie wollte ihre Großmutter nicht unterbrechen. Auch ihre Mutter hörte schweigend zu, sie hielt die Augen geschlossen, als sei sie tief in sich versunken.
„Nein, sagte er, es sei schon spät, er wolle nicht weiterziehen, vielleicht würde es sich hier ja doch aushalten lassen. Hätte ich es nur dabei bewenden lassen, hätte ich nur!“ Das Gesicht ihrer Großmutter verzerrte sich. „Doch jetzt war ich schon wütend und sagte, mein Mann komme bald heim, und dann würde er den Fremden aus dem Gasthaus jagen wie einen räudigen Kater. Als der Fremde einfach sitzenblieb, ohne mich noch weiter zu beachten, rief ich den Koch und den Stallknecht und sagte ihnen, sie sollten den Kerl rauswerfen. Sie versuchten, den Mann an den Armen zu packen, und dabei fiel der Blauwein um, der Umhang des Fremden war über und über besudelt. Jetzt geriet der Fremde in Wut. Er schleuderte Lundis und Mik zu Boden, einfach so, und dann wandte er sich mir zu.“
Die Lampe auf dem Tisch flackerte, und Ruß schlug sich auf dem Glas nieder. Doch keine von ihnen bewegte sich, um den Docht herunterzudrehen.
„Jetzt war der Fremde wieder ruhig, gefährlich ruhig“, erzählte Kala. „Er sagte, ich würde noch bereuen, was geschehen sei. Mir sei nicht klar, wie mächtig er wäre, aber das sei keine Entschuldigung. Ich erwiderte – bei Shimounah, hätte ich nicht einfach schweigen können! Ich erwiderte ...“ Ihre Großmutter stockte, fuhr dann fort. „Mein Mann Fenvar KiTenaro sei auch sehr einflussreich, und würde ihm schon noch zeigen, wie man sich in einem Gasthaus benehme. Da lächelte der Fremde auf eine ganz seltsame Art und sagte: `Richte deinem Mann einen schönen Gruß von mir aus! Fortan wird es das Schicksal aller Frauen deiner Familie sein, die Männer zu verraten, die sie lieben. Und du selbst wirst den Anfang machen.´“
„Und was dann?“
„Dann ging er, ohne zu bezahlen. Er schwang sich auf sein Pferd – es war ein prächtiger Schimmel, das weiß ich noch – und war schon nach kurzer Zeit im Dunkel verschwunden. Ich habe nie erfahren, wer er war. Vielleicht ein Magier, ich weiß es nicht.“
Eine Weile herrschte düstere Stille in dem kleinen Wohnraum. Draußen war es windig; ein Zweig wurde immer wieder ans Fenster geweht, es klang so, als klopfe jemand. Schließlich ertrug Jerusha es nicht mehr, sie stürmte nach draußen, knickte den Zweig ab und warf ihn in die Dunkelheit. Sie hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Sie lehnte sich gegen den rauen Putz des Hauses und fühlte ihr Herz gegen die Rippen hämmern. Am liebsten wäre sie nicht wieder hineingegangen, doch sie wusste, dass sie sich den bitteren, traurigen Schluss der Geschichte anhören musste. Denn diese Geschichte war schon lange auch die ihre, ohne dass sie es je geahnt hätte.
Ein paar Atemzüge später saß sie wieder ihrer Großmutter gegenüber und hörte schweigend zu.
„Natürlich tat ich die Worte des Fremden ab, ärgerte mich nur eine Weile und hatte wieder mehr als genug mit dem Betrieb der Faunenmühle zu tun. Zum Glück kam Fenvar schon am nächsten Tag zurück, und das Clantreffen verlief so gut, als hätte Alicanda es gesegnet. Um ganz ehrlich zu sein, ich fürchtete den Fluch auch deshalb nicht, weil es zwischen Fenvar und mir nicht gut lief. Hätten wir uns getrennt, ich hätte zu dieser Zeit nur mit den Achseln gezuckt. So dumm war ich! Denn wir lieben ja nicht nur unsere Gatten.“
Von den Schlafräumen oben kam ein leises Geräusch, und Jerushas Mutter zuckte zusammen, hob wachsam den Kopf. Sie und Jerusha tauschten einen Blick. War Liri wach geworden, machte sie etwa lange Ohren, um mitzubekommen, was sie besprachen? Jerusha war nicht sicher, ob das so schlecht wäre. Vielleicht hat sie ebenso ein Recht darauf, es zu hören, wie ich. Nein, sie hat gerade einmal zwölf Sommer gesehen, vielleicht ist sie tatsächlich zu jung dafür.
Ihre Mutter ging die knarrende Stiege hoch, sah kurz nach Liri. Und gab dann lautlos Entwarnung: Das Mädchen schlief.
„Ich hatte nicht an meinen Sohn Thimmes gedacht“, fuhr ihre Großmutter fort. „Gerade achtzehn Sommer zählte er damals, und er war mir eine große Freude. Zu dieser Zeit hatte er gerade Ärger. Er hatte sich mit ein paar Gleichgesinnten zusammengetan und wütete gegen die Tyrannei der Fürsten AoWestas; er fand, sie gäben dem Volk zu wenige Freiheiten und beuteten es aus, wo sie nur könnten. Und wirklich, es war schlimm damals, viel schlimmer als heute. Thimmes und seine Freunde hatten einen Protest formuliert, in dem sie einen Neuanfang forderten, und das Ganze an die Tür eines Zunfthauses genagelt. Wenn diese Freiheiten nicht gewährt würden, solle das Volk die AoWestas stürzen, hatten sie geschrieben. Wild und stark und jung und manchmal ohne jede Vernunft waren er und seine Freunde damals!“
„Ich kann mir vorstellen, dass die AoWestas nicht begeistert waren“, sagte Jerusha gepresst.
„Nicht begeistert? Sie waren außer sich. Und als sie nach den Urhebern des Protests forschten, klopften sie auch an unsere Tür. Als sie fragten, ob unser Sohn damit etwas zu tun habe, ob er es ausgeheckt habe, hörte ich mich ´Ja´ sagen, ich weiß heute noch nicht, was mir dieses Wort entrissen hat. Die Soldaten sahen mich seltsam an, sie konnten wohl kaum glauben, dass ich das so einfach zugeben würde. Ich versuchte noch, die Tür zuzuschlagen, aber nun zögerten sie nicht länger, drängten mich beiseite und stürmten unser Haus.“ Kalas Mund bebte, und es dauerte einen Moment, bis sie weitersprechen konnte. „Thimmes wehrte sich verzweifelt, aber die Soldaten schlugen mit Eisenstangen auf ihn ein und brachen ihm schließlich beide Arme, um seinen Widerstand zu überwindenbrechen. Sein Gesicht, seine Kleidung, alles war voller Blut. Ich weinte und weinte, und am Schlimmsten war Thimmes´ Blick, als er – noch als sie ihn mitnahmen – erfuhr, dass ich ihn verraten hatte. Das werde ich nie vergessen. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Er wurde erst gefoltert und dann hingerichtet.“
Tränen rannen aus den Augen ihrer Großmutter, zogen glänzend feuchte Spuren über ihre Wangen, tropften auf den Tisch. Jerusha nahm ihre zitternde Hand, hielt sie fest. Und blickte unwillkürlich hinüber zu ihrer Mutter. Wie alt war sie gewesen, als sie das miterlebt hatte? Kein Wunder, dass sie heute nur noch ein grauer Schatten war.
Ich hatte also mal einen Onkel, ging es Jerusha durch den Kopf. Warum haben sie nie von ihm gesprochen? Wäre es zu schmerzhaft gewesen?
Ein paar Mal setzte ihre Großmutter zum Sprechen an, doch ihre Lippen bebten so stark, dass sie kein Wort mehr herausbrachte. Schließlich stand sie vom Tisch auf, ging zu der Holzbank unter dem Fenster und setzte sich dorthin, die Hände im Schoß gefaltet, den Blick auf den Boden geheftet. Jerusha ging zu ihr, legte ihr den Arm um die Schultern, doch ihre Großmutter ließ nicht einmal erkennen, ob sie das überhaupt bemerkte.
Schließlich kehrte Jerusha an den Tisch zurück und setzte sich ihrer Mutter gegenüber. Als sie den Kopf hob, trafen sich ihre Blicke, und das Lampenlicht ließ die braunen Augen ihrer Mutter einen Moment lang aufglühen. Sie saß aufrechter als zuvor, und einen flüchtigen Moment lang wirkte sie stolz und selbstbewusst. Jerusha bekam eine Ahnung davon, wie sie früher gewesen sein musste. Wieder war sie erschrocken darüber, wie ähnlich sie sich sahen. Sieht Mutter ein jüngeres Ich in mir, wenn sie mich so anblickt?
Einen Moment lang maßen sie sich schweigend. Dann begann ihre Mutter Myrial zu erzählen.
„Ich mache es kürzer“, sagte sie hart. „Es ist traurig genug. Ich wusste nichts von dem Fluch; als er ausgesprochen wurde, war ich gerade im Vorratskeller der Faunenmühle und schleppte zwei Krüge Wein nach oben. Und Mama – deine Großmutter Kala – erzählte uns nichts davon. Aber wir drei Töchter spürten ihn alle: Sarial, Rikiwa – die kleine Rikki nannten wir sie meistens – und ich.“
Jerusha nickte. Ihre Tante Sarial war die Zwillingsschwester ihrer Mutter gewesen. Irgendwann hatte Jerusha erfahren, dass sie gestorben war, doch über die Ursache war nie geredet worden. Von Rikiwa hatte ihre Mutter noch seltener gesprochen.
„Wir waren alle hübsche, lebhafte Mädchen und heirateten jung“, fuhr ihre Mutter fort. „Aber das Ende kam bald. Sarial ließ sich mit einem fahrenden Sänger ein, obwohl ihr Mann ihre große Liebe war. Ihr Gatte ertappte sie, tötete den Sänger und verstieß Sarial. Sie brachte sich um. Kalas Schwester und meinen Cousinen erging es ebenfalls schlecht, eine von ihnen verlor durch das, was der Fluch ihr antat, den Verstand, die anderen das Herz.“
So ist das also gewesen. Und du? Was ist mit dir und Vater geschehen? Jerusha wollte es fragen, doch ihr Mund fühlte sich staubtrocken an und ihre Zunge lag so starr in ihrem Mund, als sei sie aus Holz geschnitzt.
Nein, ihre Mutter weinte nicht. Doch auf einmal waren ihre Augen wieder so tot und leer wie zuvor. So, wie Jerusha es kannte. „Dein Vater Josuan war der Mann, den ich liebte, Jerusha. Der Einzige – es gab keinen anderen für mich. Wir waren glücklich. Und doch habe ich versucht, ihn umzubringen. Gerade auf der Welt war Liri damals, als es passierte, und du warst neun. Ich habe das nicht gewollt, und ich kann es mir nicht erklären. Es wird dich sicher nicht wundern, dass Josuan mir nicht glaubte. Er ging davon, sobald er wieder gesund genug war, und von meinem Leben ist nicht viel geblieben.“
„Wie? Wie hast du es versucht?“, fragte Jerusha, und sie hörte selbst, dass ihre Stimme kraftlos klang, kaum hörbar. „Ihn zu töten?“ Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie ihre Mutter mit einem Messer in der Hand auf ihren Vater einstach. Hatte sie versucht, ihn zu ersticken? Oder ihm Gift ins Essen gemischt?
Doch ihre Mutter schüttelte stumm den Kopf, verweigerte die Antwort.
Immerhin, Jerushas Vater hatte überlebt. Einmal im Jahreslauf – immer dann, wenn Jerushas Mutter gerade Verwandte besuchte – kam er noch immer in Loreshom vorbei. Groß und blond war er und Liriele so ähnlich, dass es wehtat. Und so war es auch immer Liri, mit der er zusammen lachte und spielte, die er an sich drückte und herumwirbelte. Woran dachte er, wenn er das kleine dunkel gelockte Mädchen anblickte, das sich höflich im Hintergrund hielt? Daran, wie ihre Mutter auf ihn losgegangen war?
Mühsam versuchte Jerusha, ihre Gedanken zu ordnen und gleichzeitig ihre Tränen zurückzuhalten. „Als du ihm von dem Fluch erzählt hast, hat er es auch dann nicht geglaubt?“
„Nein.“ Das bittere Lachen, das ihre Mutter ausstieß, ließ Jerusha schaudern wie ein kühler Luftzug in ihrem Nacken. „Er glaubt ja nicht mal daran, dass es noch Drachen oder Greifen gibt. Ich aber habe welche gesehen, nicht nur einmal, und ich habe ihm auch davon erzählt. Doch die Wahrheit hat ihren eigenen Geschmack. Wem sie nicht mundet, der verschmäht sie einfach.“
Jerusha hatte das Gefühl, jetzt nichts Weiteres mehr ertragen zu können. Ihr Herz fühlte sich an, als müsste es jeden Augenblick in einem klebrigen, dunklen Sumpf untergehen. Nichts wie weg hier. Sie musste jetzt allein sein, und nachdenken. Jerusha stand auf, ging mit festen Schritten zur Tür und spürte den Boden kaum, über den sie ging. Doch dann fiel ihr noch etwas ein, und sie zögerte, drehte sich um. „Und was ist aus meiner dritten Tante geworden?“, wollte sie fragen, doch einen Moment lang musste Jerusha in ihrem Gedächtnis nach dem Namen suchen, den sie noch nicht oft gehört hatte. „Rikiwa?“
„Sie ist die Einzige, die verschont geblieben ist“, sagte ihre Mutter, und fügte trocken hinzu: „Was vielleicht daran liegt, dass sie keine Männer liebt, sondern Frauen.“
Jerusha hatte sich nur schnell einen Umhang übergeworfen, aber nicht daran gedacht, eine Laterne mitzunehmen. Blindlings, ohne bestimmtes Ziel, taumelte sie durch die Dunkelheit, die schwach von einem Halbmond erhellt wurde. Kein Zweifel, den Fluch gibt es wirklich. Gnädige Shimounah, ich muss es Dario sagen! Er muss es wissen, und zwar bald. Vielleicht lacht er nur darüber. Vielleicht bekommt er Angst. Unsere Hochzeit? Vielleicht gibt es keine. Und wir können unseren Freunden nicht mal sagen, warum. Niemand darf es wissen. Ich könnte die Blicke nicht ertragen, und das Mitleid, und ich müsste ohne Liebe leben bis zu meinem Tod, weil kein Mann wagen würde, sich mit mir einzulassen.
„Lady Jerusha. Eine gute Nacht wünsche ich Euch.“
Jerusha erschrak, ihr Gedankenstrom stockte und entglitt ihr. Vor ihr löste sich eine Gestalt aus der Dunkelheit und kam langsam auf sie zu; der herbe Geruch von Eichenteer stieg Jerusha in die Nase. Doch auch ohne diesen hätte sie schon gewusst, wer da kam. Nur Gorias redete sie mit Lady und Ihr an, und so mancher im Dorf machte sich darüber lustig. Gorias war für die Eichen verantwortlich, die in den Sümpfen etwas außerhalb des Ortes gediehen, und ritzte ihre fast schwarze, zerfurchte Rinde an, um ihren Saft zu gewinnen. Auch jetzt konnte sie im Licht des Mondes erkennen, dass er in jeder Hand einen der schweren, klebrigen Teereimer trug, selbst in der linken, die verkrüppelt war, als sei sie ihm irgendwann verdorrt.
„Bringt Ihr die Ernte ein, jetzt noch?“ Jerusha versuchte ein Lächeln. Sie mochte Gorias, seine Gelassenheit und die Art, wie er oft zum Mond und zu den Sternen hochblickte, völlig versunken in den Anblick, der sich ihm bot. Lange hatte sie selbst sich nicht für das interessiert, was am Himmel vorging, und auf den Sternguckausflügen, die ihr Lehrer Laristus für seine Schüler organisierte, war sie nur durch ihr Gähnen aufgefallen. Doch während ihrer Lehre hatte sie einmal bis spätabends an einer Figur gearbeitet, um sie zu vollenden. Als sie heimgehen wollte – als Letzte – war sie in eine Grube auf dem Baugelände gefallen, aus der sie aus eigener Kraft nicht herauskam. Nachdem sie ihre schlechten Augen ausgiebig verflucht hatte und die erste Panik vorbei war, hatte sich die ganze Sache als gar nicht so schlimm erwiesen. Jerusha hatte sich auf den Rücken gelegt und die Sterne betrachtet, auf einmal fielen ihr deren Namen wieder ein. Und sie sah nicht mehr langweilige verstreute Lichtpünktchen dort oben, sondern ein gewaltiges Bild, das einen Sinn ergab, das voller verborgener Muster steckte. Ein Bild purer Schönheit.
„Wieso sollte ich nicht auch jetzt die Ernte einbringen? Es ist doch eine herrliche Nacht.“ Gorias lächelte. In manchen Momenten wirkte er wie ein Jüngling, obwohl er sicher schon vierzig Sommer gesehen hatte. „Und Ihr?“
„Ich ...“ Jerusha wollte irgendwas sagen, doch die Worte blieben in ihrem Hals stecken und auf einmal stürzten Tränen aus ihren Augen. Verlegen wandte sie sich ab und wollte weiterhasten, doch Gorias legte ihr eine nach Teer riechende Hand auf den Arm.
„Es ist schlimm, nicht wahr?“
Jerusha nickte und schaffte es nicht, ihm ins Gesicht zu sehen.
„Nichts ist endgültig, Lady Jerusha. Nichts, bis auf den Tod.“ Jerusha wunderte sich, warum Gorias auf einmal so eindringlich sprach.
„Ich werde daran denken“, sagte Jerusha trotzdem, und anscheinend war Gorias damit zufrieden, denn mit einem vollendet höflichen Gruß wanderte er weiter in die Dunkelheit, in Richtung seiner Kate.
Jerusha beschleunigte ihre Schritte, denn jetzt wusste sie, wohin sie wollte. In den Craunenwald, zu dem Hügel, den sie seit einigen Jahresläufen Fir Evarn nannten, den Hügel der Gesichter. Dort würde sie garantiert niemand stören, und dafür war Jerusha verantwortlich. Als Mädchen hatte sie auf der Kuppe des Hügels sechs Bäume entdeckt, die sich im Kreis gegenüber standen. Begeistert hatte sie in jeden Baum auf Schulterhöhe ein Gesicht geschnitzt, Männer und Frauen, deren Züge ihr gerade so in den Sinn kamen. Es ergab einen schönen Effekt, wie die Gesichter sich anblickten, fast sah es so aus, als hielten die Bäume dort auf dem Hügel eine Versammlung ab. Doch die Bewohner von Loreshom hatten sich entsetzt gezeigt, die Baumgesichter waren ihnen unheimlich. Nur knapp war Jerusha einer Anklage wegen schädlicher Hexerei entgangen.
Es fiel ihr auch in der Dunkelheit nicht schwer, den Weg zu finden, sie kannte den Craunenwald gut. Sie war oft hier unterwegs und schleppte abgefallene Äste heim – das harte, gelbliche Holz der Craunen brannte hervorragend. Auch im Wald Kulmesnüsse zu sammeln war ein Jedermannsrecht und im Herbst immer ein großer Spaß für Liri und sie.
Da waren sie schon, ihre Bäume. Sie waren gewachsen in den letzten Jahresläufen, und jetzt schienen die Gesichter auf Jerusha herabzublicken. Jerusha ließ ihre Hand voller Zuneigung über das verwitterte Holz gleiten, breitete dann ihren Umhang auf dem Boden aus und setzte sich; mit dem Rücken lehnte sie sich gegen einen der Stämme. Von den Hügeln wehte ihr ein kühler Wind, der nach Regen roch, ins Gesicht – doch sie spürte es kaum.
Muss ich einfach lernen, damit zu leben? Nein, nein, nein – es muss einen Ausweg geben! Irgendein Magier wird wissen, wie man diesen Fluch unschädlich machen kann. Wenn nötig gebe ich ihm alles, was ich habe. Sonst wird Liri, mich und unsere Kinder nur Schmerz und Tod und Leid erwarten.
Dieser Fremde. Wer war er gewesen? Wieso hatte er die Macht, einen solch starken Fluch auszusprechen? Ihre Großmutter hatte recht, er musste ein Magier sein, einer der Zauberer aus Uskaja vielleicht. Und ein edles Pferd hatte er gehabt. Das deutete auf einen wohlhabenden, einflussreichen Mann hin.
Jerusha fröstelte und schlang die Arme um ihren Körper. Hilfloser Zorn wallte in ihr auf. Nur ein Bastard der übelsten Art spricht wegen einer solchen Lappalie wie einem Streit im Wirtshaus einen Fluch aus, der über Generationen reicht! Nichts habe ich diesem Kerl getan, nichts! Ich will einfach nur hierbleiben und Dario heiraten und eine Menge Skulpturen erschaffen.
Jerusha wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sie schließlich aus ihren düsteren Gedanken auftauchte und merkte, dass sie völlig durchgefroren war. Sie wunderte sich, dass Grísho noch nicht aufgetaucht war. Vielleicht hatte er gemerkt, dass etwas nicht stimmte, und wollte sie nicht stören. Sonst begrüßte er sie oft, wenn sie allein unterwegs war; hatte sie Gesellschaft, hielt er sich fern. Denn er wusste, was die meisten Menschen von Schattenspringern wie ihm hielten. Es hieß, sie raubten einem die Seele. Und da es in dieser Ecke von Kalamanca aus irgendeinem Grund viele Schattenspringer gab, waren die meisten Leute ohnehin nervös genug in der Dämmerung.
„Grísho?“ rief Jerusha leise, doch als keine Antwort kam, beschloss sie, sich auf den Heimweg zu machen. Aus ihren verworrenen Gedanken hatte sich schließlich ein einziger herausgeschält: Sie musste sich auf den Weg machen und versuchen, Hilfe zu finden. Es ging nicht, einfach hierzubleiben und abzuwarten, was geschehen würde. Doch Jerusha wusste, dass es ein schwerer Weg war, den sie gehen musste. Würde Dario überhaupt mitkommen wollen? Im schlimmsten Fall musste sie ohne ihn auskommen und alleine reisen, wahrscheinlich mehrere Monde lang. Zum Tempel konnte sie vorerst nicht zurück, ein anderer Bildhauer würde sich über den Marmorblock freuen, aus dem der Xatos erstehen sollte. Gleich morgen früh musste sie Goram TeRulius Bescheid geben, dass sie nicht mehr zur Arbeit kommen würde. Sie mochte sich kaum vorstellen, was für ein schrecklicher Schwall von Flüchen über den Tempelbau hereinbrechen würde.
Es kostete sie Überwindung, zum zweiten Mal an diesem Abend an die Tür der WiTaneks zu klopfen. Als sich im Haus nichts rührte, packte Jerusha auf einmal namenlose Angst, und sie begann, mit der flachen Hand und aller Kraft gegen die Tür zu hämmern. War er etwa nicht da? Aber er musste da sein, sie musste mit Dario sprechen! Jetzt und sofort! Und nichts wünschte sie sich mehr, als von ihm in den Arm genommen zu werden.
Nach einer endlos langen Zeit spähte Dario verschlafen und mit verstrubbeltem Haar aus dem Fenster des oberen Stockwerks. „Ach, du bist es. Was bei allen Göttern ist los?“
„Ich muss mit dir reden“, sagte Jerusha und hörte, wie ihre Stimme schwankte.
Dario war ärgerlich, dass sie ihn geweckt hatte, das merkte sie an der kurzen Umarmung und der Art, wie er sich gleich darauf umdrehte und voranging, die Treppe hinauf in den Wohnraum. „In Ceraks Namen, jetzt sag mir, was los ist!“
Es fiel Jerusha unglaublich schwer, ihm von dem Fluch zu berichten. Mit unbewegtem Gesicht hörte Dario zu, als Jerusha wiederholte, was ihr Mutter und Großmutter erzählt hatten. Als sie geendet hatte, seufzte er und meinte: „Was für eine Karrenladung Schweinedung! Du wirst mir also Unglück bringen? Bestimmt kann man das verhindern.“ Er überlegte. „Und ich weiß auch schon, wie. Ich habe nämlich gerade einen Spiegel für Xiranthar gefertigt. Kennst du ihn?“
Jerusha schüttelte den Kopf. Auf einmal fühlte sie sich bleiern müde, die wilde Energie von vorhin war verschwunden. „Wer ist das?“
„Ein Magier aus Uskaja. Einer der Besten. Vielleicht schafft er es sogar selbst, den Fluch zu lösen. Und wenn nicht – er kennt viele Leute. Möglicherweise auch denjenigen, der eurem Clan geschadet hat. Ich wette, der Bastard hat längst vergessen, dass er mal in eurem Wirtshaus schlecht gespeist hat und ist bereit, den Fluch wieder zu lösen.“
„Falls er überhaupt noch lebt“, wandte Jerusha ein. „Vergiss nicht, es ist alles lange her.“ Sie wusste nicht, ob sie beeindruckt oder erschrocken sein sollte, dass ihr Verlobter für solche mächtigen Magier arbeitete. Doch eher beeindruckt. Und froh, dass vielleicht alles nicht so schlimm war wie gedacht. Jerusha fühlte, wie ihre aufgewühlten Gedanken sich beruhigten und so etwas wie Frieden in ihren Geist einkehrte.
„Wie bald kannst du diesen Kerl fragen?“
„Ich schicke ihm gleich morgen eine Botschaft. Hoffentlich ist der Preis für seine Hilfe nicht zu hoch, aber ich bin ja schließlich nicht arm. Und jetzt mach dir bitte keine Sorgen mehr und geh ins Bett, du siehst aus, als würdest du jeden Moment zusammenbrechen. Willst du hierbleiben?“
Seit sie verlobt waren, konnte niemand mehr dagegen Einwände erheben, wenn sie die Nacht zusammen verbrachten. Doch an diesem Abend spürte Jerusha, wie sich etwas in ihr dagegen sträubte. „Nein, lieber nicht. Meine Mutter wird sich Sorgen machen, wenn ich nicht zurückkomme. Nach all dem, was sie und Großmutter mir erzählt haben.“ Außerdem zog etwas sie zurück zu Liri. Sie wollte bei ihrer kleinen Schwester sein, ihren ruhigen Atem hören, während sie schlief. Sicher sein, dass ihr nichts geschah. Etwas, vor dem eine ruhige Hand und ein guter Bogen sie nicht beschützen konnten.