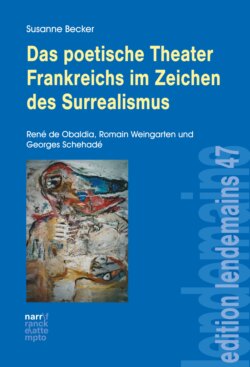Читать книгу Das poetische Theater Frankreichs im Zeichen des Surrealismus - Susanne Becker - Страница 25
2.7 Die Avantgarde im 21. Jahrhundert
ОглавлениеAngesichts der zahlreichen Avantgardemodelle kann man wohl mit Ionesco sagen: „L’avant-garde, c’est la liberté.“1 Es ist schwer, die Avantgarde auf eine Formel zu bringen. Der Avantgardebegriff ist ein pluralistischer, verschiedene Denkfiguren sind möglich, um ihn zu erfassen. Und auch die Bewertung der Beziehung zwischen historischer und Neo-Avantgarde hängt vom (geographischen und ideologischen) Standpunkt ab und steht damit zur Debatte.
Ergibt es also im 21. Jahrhundert noch Sinn, von der Avantgarde zu sprechen? Oder, wie Asholt jüngst in einem Essay titelte: „Brauchen wir noch eine Avantgarde-Theorie?“2 Für Philippe Dagen3 etwa hat das Avantgardekonzept in unserer globalisierten Welt nicht nur ausgedient, es hindert auch daran, die aktuelle Kunst in angemessenen Kategorien zu denken. Dagegen ist die Avantgarde für Gilcher-Holtey4, die deren Echo in den globalisierungskritischen Bewegungen des 21. Jahrhunderts erkennt, durchaus noch aktuell. Diese divergenten Meinungen zeigen, dass es immer noch Klärungsbedarf gibt.
Die Avantgardeforschung hat im 21. Jahrhundert neue Forschungsfelder erschlossen. Nachdem historische Avantgarde und Neo-Avantgarde mittlerweile beide historisch geworden sind, widmet sich die Forschung nun dem Altern der Avantgarde, d.h. den Problemen und Widersprüchen einer alternden, aber dennoch gerontophoben und auf Jugendlichkeit ausgerichteten Avantgarde. Einerseits will die alternde Avantgarde ihren einstigen revolutionären Intentionen treu bleiben und blendet dabei ihr Altern aus, wodurch sie riskiert, sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Andererseits tendiert sie zu konservativen Lebensformen und sieht sich dem Vorwurf des Verrats ihrer früheren umstürzlerischen Absichten ausgesetzt. Hier steht eine „linke Avantgardenvergreisung einem rechten Greisenavantgardismus“5 gegenüber. Ein Beispiel dafür, welche Themen von alternden Avantgardisten heute besetzt werden, liefert der Ex-Kommunarde und Alt-68er Rainer Langhans: er macht sich nun Gedanken über das „Sterbenlernen“ und das Überleben des physischen Todes, zuletzt im 2014 erschienenen Dokumentarfilm Good luck finding yourself6 von Severin Winzenburg über Langhans, die krebskranke Jutta Winkelmann und weitere Mitglieder des „Harems“ auf ihrer spirituellen Reise nach Indien.
Mit den neuen Medien hat sich ein weiteres Feld für die Avantgardeforschung aufgetan. Mit dem Erfolg des kommerziellen Internet seit den 1990er Jahren und den sich daraus entwickelten interaktiven Möglichkeiten haben traditionelle Medien ein potentes neues Werkzeug für die Umsetzung avantgardistischer Aspirationen an die Seite gestellt bekommen. Dabei stellt sich die Frage, ob die neuen Medien der ohnehin längst ausdifferenzierten Avantgarde lediglich weitere Techniken geliefert haben: Internet, Videospiele, Musikvideos, Werbeclips, Smartphones, Videoplattformen, soziale Netzwerke etc. sind vielleicht nur einige von vielen künstlerischen Mitteln der Avantgarde, deren einstige Radikalität sich nun nicht mehr nur in der Ästhetisierung, sondern auch in der Digitalisierung der Lebenswelt totgelaufen hat. Oder konnte die Avantgarde ihr Potential etwa erst durch die neuen Medien, die unsere Seh- und Handlungsgewohnheiten auf so grundlegende Weise verändert haben, entfalten? Manche betrachten die Digitalisierung unserer Gesellschaft als zweiten medialen Bruch, der – ein halbes Jahrhundert nach Benjamins Überlegungen zur Wirkung neuer Reproduktionstechniken wie Film und Photographie für die Kunst7 – eine Neubewertung der Avantgarde erforderlich macht.
Im Theaterbereich koexistieren das dramatische und das postdramatische Theater im 21. Jahrhundert weiter. Ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung seiner Studie über das postdramatische Theater hat Lehmann neue Schwerpunkte am Theater unter anderem im Dialog des Theaters mit der Gesellschaft, im Gruppencharakter und im wieder erstarkenden Trend hin zum Sprechakt identifiziert.8 Es fällt auf, dass die Theorie, die ja eigentlich bestimmte Phänomene ex post beschreiben soll, oftmals die Theaterpraxis beeinflusst hat. So hat das im Jahr 1982 von Andrzej Wirth gegründete und von Lehmann maßgeblich mitgestaltete Institut für Angewandte Theaterwissenschaft der Universität Gießen zahlreiche postdramatische Gruppen (z.B. Rimini Protokoll, SheShePop, Showcase Beat Le Mot) und Regisseure (z.B. René Pollesch) hervorgebracht.
Es gibt also noch immer Betätigungsfelder für die Avantgardeforschung. Dabei darf sich der Blick nicht nur auf diejenigen avantgardistischen Anstrengungen verengen, die die Überführung der Kunst in Lebenspraxis zum Ziel haben, sondern muss auch Praktiken und Techniken der Avantgarde miteinschließen. So hat beispielsweise die Leiterin der Documenta 13, Carolyn Christov-Bakargiev, in Interviews einerseits ihr Interesse für „surrealistische Strategien einer künstlerischen Praxis“9 bekundet und andererseits erklärt, sie verstehe den Surrealismus als eine sich besonders in Krisenzeiten manifestierende innere Freiheit, „die in die reale Welt geht“10. Damit spricht sie zwei unterschiedliche – aber komplementäre –Perspektiven auf die Avantgarde an: erstens die Avantgarde als Erneuerung des Repertoires ästhetisch-formeller Verfahrensweisen (Kunst als Zweck/Material/Verfahren), zweitens die Avantgarde als gesellschaftliche Revolution (Kunst als Mittel/Revolution). Diese zwei Kategorien muss man im Blick haben, wenn man die Avantgarde als Ganzes erfassen will. Während Theorien, die die Avantgarde in der Tradition der Moderne sehen, den Fokus eher auf künstlerische Verfahrensweisen legen, betonen Theorien, die die Avantgarde als Bruch konzipieren, eher ihr revolutionäres Potential.
Die Avantgarde bleibt in Alltag, Kunst und Wissenschaft somit bis heute ein permanenter Bezugspunkt und ein „Gespenst […], das immer wieder und in immer anderen Erscheinungsformen in Kunst und Literatur herumspukt“11. Schließlich sollte man den Avantgardediskurs vielleicht mit Bru12 im Sinne eines Praktischwerdens von Wissen betrachten, das wir uns über Kunst und Literatur aneignen und das auch die jenseits der Kunst liegenden Bereiche unseres Lebens informiert und bereichert. In ihrem Bestreben, Kunst in Lebenspraxis zu überführen, positioniert sich die Avantgarde innerhalb der von Ottmar Ette angestoßenen Diskussion um das Praktischwerden literaturwissenschaftlichen Wissens mit dem Ziel, „Kunst und Literatur als Erlebenswissen, als Überlebenswissen und als Zusammenlebenswissen“13 zu begreifen. Es gilt, die herrschende Diskrepanz zwischen den gesellschaftsrelevanten „Life Sciences“ und den autonomen, selbstreferentiellen „Humanities“ zu überwinden und die Bedeutung von Literatur und Kunst für das Leben in den Fokus zu rücken. Jede Wissenschaft, auch die Literaturwissenschaft, muss ihr Wissen in die Gesellschaft tragen. Literatur, so Ette, „vermittelt stets ein spezifisches Wissen davon, wie man lebt oder leben könnte – und […] auch ein Wissen davon, wie man nicht (über-)leben kann“14. Aufgrund ihres performativen Charakters kann die Avantgarde somit zur „introduction to right living“15 werden. Asholt hält deshalb dazu an, die Avantgarde
als ein besonderes Experiment mit Lebenswissen zu verstehen. […] Literatur und Kunst hätten demzufolge die Funktion, mehr und vor allem anderes vom Leben zu wissen, als das Wissen der Life Sciences. Dieses Wissen, so wissen wir seit den Avantgarden, sollte, gerade weil es gegenüber dem Lebenswissen exzessiv ist, sich nicht im als autonom in Anspruch genommenen Raum seiner Exzessivität einrichten, sondern […] 'praktisch' werden und versuchen, das besondere Lebenswissen von Kunst und Literatur, man könnte auch sagen, das Wissen um die Möglichkeiten eines anderen Lebens, in die Lebenspraxis zurückzuführen.16