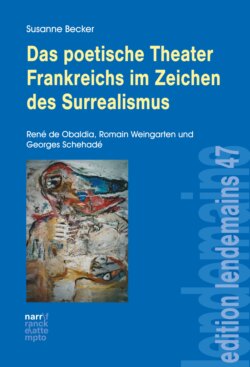Читать книгу Das poetische Theater Frankreichs im Zeichen des Surrealismus - Susanne Becker - Страница 33
3.4.3 Juxtaposition von Realität und Wunderbarem
ОглавлениеDas surrealistische Leben spielt sich nicht in einem von der Realität abgekoppelten Traumbereich ab, sondern ist immer in der objektiv wahrnehmbaren Wirklichkeit verwurzelt. Realität und Irrealität, Wachzustand und Traum, Luzidität und Delirium, Alltag und Wunderbares stehen sich nicht als voneinander getrennte Sphären gegenüber, sondern kommunizieren miteinander. Das Unbekannte ist immer im Bekannten verwurzelt. Bereits in L’Esprit nouveau et les poëtes (1917) hat Apollinaire das Alltägliche als Ausgangspunkt für die poetische Kreation bestimmt: „On peut partir d‘un fait quotidien: un mouchoir qui tombe peut être pour le poëte le levier avec lequel il soulèvera tout un univers.“1
Die Handlungsorte in den surrealistischen Stücken sind meist konkret und verweisen auf real existierende Orte, vor allem auf Paris mit seinen Straßen, Cafés, Plätzen, Hotellobbys, Bars und bourgeoisen Intérieurs. Wähnt sich der Zuschauer anfangs noch in einer ihm vertrauten Welt, wird seine Wahrnehmung aber bald irritiert durch eine Verzerrung des vermeintlich Bekannten ins Seltsame, Wunderbare und Überraschende. So wird das Zimmer des Protagonisten Maxime in Desnos‘ La place de l’étoile (1927 entstanden) von einer Seesterninvasion heimgesucht, und bei einem Hausbrand bleibt nur Maximes Zimmer verschont. Hunderte von Orangen kullern in Vitracs Poison (1923 veröffentlicht) plötzlich aus einem Küchenschrank, Soldaten klettern aus einem Spiegelschrank, ein Maler zieht an einem Seil, an dem ein scheinbar leichter Gegenstand befestigt ist, der sich schließlich als Ozeandampfer entpuppt. Realität und Irrealität stehen in den surrealistischen Stücken ständig im Austausch miteinander. Mantchéva2 unterscheidet hier zwischen dem „réel sémantique“, d.h. der empirischen und konkreten Realität, und dem „réel esthétique“, also einer poetischen Wirklichkeit. Diese Realitäten korrespondieren miteinander wie Bretons berühmte „vases communicants“.
Die Surrealisten knüpfen eine neue Beziehung zu ihrer Umwelt, die vom Wunderbaren geprägt ist: „il est certain que le merveilleux naît du refus d’une réalité, mais aussi du développement d’un nouveau rapport, d’une réalité nouvelle que ce refus a libéré“3. Aragon stellt die These auf, dass das „merveilleux“ in der Antike noch Teil des täglichen Lebens gewesen sei. Mit der Ausbreitung des Christentums sei es aber von der Kirche in eine Parallelwelt von Dämonen, Feen und Riesen verbannt worden. Nach der Rückkehr des Teufels auf die Erde in der Gestalt von de Sade, Rimbaud, vor allem aber Lautréamont, sei das „merveilleux“ schließlich wieder in den Alltag eingezogen, wo „il s’assied au café à côté de nous, il nous demande poliment de lui passer le sucre.“4 Die neue Beziehung, die die Surrealisten mit der Realität eingingen, ermöglichte ihnen den Zutritt zu einer wahrhaftigen Welt, in der das, was bisher als selbstverständlich gegolten hatte, erschüttert wurde. Das Wunderbare ist nun die Richtschnur der surrealistischen Schöpfung: „le merveilleux est toujours beau, n’importe quel merveilleux est beau, il n’y a même que le merveilleux qui soit beau.“5 Jeder kann zum Wunderbaren Zugang erhalten, es ist keiner inspirierten Elite vorbehalten: „Le merveilleux doit être fait par tous et non par un seul“6, schrieb Aragon, der hier ein Zitat der surrealistischen Galionsfigur Lautréamont, dem Initiator des „merveilleux moderne“7, entlehnt.