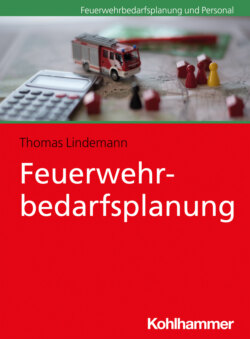Читать книгу Feuerwehrbedarfsplanung - Thomas Lindemann - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Umfang und Detailtiefe eines Feuerwehrbedarfsplans
ОглавлениеWelche Detailtiefe ein Feuerwehrbedarfsplan aufweisen sollte, hängt von den Bedürfnissen der jeweiligen Kommune ab. In der Praxis ist festzustellen, dass die Bandbreite von dem, was als der jeweilige kommunale Feuerwehrbedarfsplan bezeichnet wird, von einem »bloßen Fahrzeugkonzept« bis hin zu einem »umfassenden Organisationshandbuch der Feuerwehr mit mehreren hundert Seiten« reicht.
Generell müssen in einen Feuerwehrbedarfsplan alle notwendigen Angaben und Analysen Eingang finden, die zur umfassenden Bewertung und Ableitung eines SOLL-Konzepts und den dazu notwendigen Handlungsmaßnahmen notwendig sind (vgl. Nachvollziehbarkeit von Feuerwehrbedarfsplänen, Kapitel 3.3). Auf der anderen Seite ist darauf zu achten, nur die tatsächlich relevanten Aspekte in den Feuerwehrbedarfsplan aufzunehmen und diesen inhaltlich nicht zu überfrachten. Der Bedarfsplan ist in erster Linie ein strategisches Dokument, dessen Ziel es ist, die übergeordnete »strategische Ausrichtung der Feuerwehr« zu entwickeln, als politischen Willen festzulegen und nachvollziehbar darzustellen. Die Adressaten des Bedarfsplans, zu denen insbesondere die politisch Verantwortlichen als Entscheidungsträger für die aus dem Bedarfsplan resultierenden Maßnahmen zählen, müssen sich in dem Dokument »zurechtfinden« und die für sie bzw. für eine konkrete Entscheidung relevante Informationen extrahieren können. »Unnötiger Ballast« und »ausschmückende Prosa« lenken von den wesentlichen Kernpunkten ab.
Ein zu großer Bedarfsplanumfang kann für den politischen Diskussions- und Abstimmungsprozess nachteilig sein kann, da potenziell strittige Detailfragen von den strategisch und politisch wichtigen Aspekten ablenken können. So sind Entwurfsvorlagen von Feuerwehrbedarfsplänen schon des Öfteren in den jeweiligen politischen Gremien abgelehnt worden, da beispielsweise die Anzahl der stadtweit vorzuhaltenden Atemschutzgeräte, eine zu frühzeitige konkrete Standortfestlegung oder bedarfsplanunabhängige personelle Mehrbedarfe im (grundsätzlich daher nicht in den Bedarfsplan aufzunehmenden) Stellenplan zu Streitfragen mit erweiterten Klärungs- und Diskussionsnotwendigkeiten avancierten, die zu unnötigen Verzögerungen oder gar zur Ablehnung des Gesamtkonzepts führten.
Aus diesem Grund gilt der »Grundsatz der planerischen Zurückhaltung« (vgl. Kapitel 4.2). Die Detailplanung zur Umsetzung der im Feuerwehrbedarfsplan festgelegten Ziele und Maßnahmen erfolgt in einigen Punkten erst nach dem politischen Beschluss zur strategischen Ausrichtung. Konkrete Festlegungen zum Betriebs- und Dienstablauf oder technische Detailausstattungen, wie etwa die Anzahl der notwendigen Schläuche oder der Meldeempfänger, gehören damit nicht zu den Inhalten eines Feuerwehrbedarfsplans, der niemals den Anspruch haben kann, als globale und abschließende Einkaufs- und Beschaffungsliste der Feuerwehr zu fungieren. Angelegenheiten von Detailausstattungen fallen ohnehin als »Geschäft der laufenden Verwaltung« in den Verantwortungsbereich der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung und des Leiters der Feuerwehr. Dieser hat im gesetzlichen Auftrag für die innere Organisation und ständige Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Sorge zu tragen. Damit genießt er eine Art »Vertrauensvorschuss« seitens des politischen Gremiums in Hinblick auf die zweckmäßige Organisation der Feuerwehr in seinem politisch festgelegten Rahmen.
Als Faustregel kann daher festgehalten werden, dass grundsätzlich höchstens Geräte und Ausstattungen, deren Wert oberhalb der in der Kommune festgelegten Wertgrenze für Geschäfte der laufenden Verwaltung liegen, im Bedarfsplan aufgeführt werden sollten (Beispiel: Einsatzfahrzeuge).
| Als »Geschäft der laufenden Verwaltung« gelten alle Rechtsgeschäfte, die in mehr oder weniger regelmäßiger Wiederkehr in der Kommune vorkommen, nach Umfang der Verwaltungstätigkeit sowie der finanziellen Auswirkungen von sachlich weniger erheblicher Bedeutung sind und deren Erledigung nach feststehenden Grundsätzen erfolgen. Hierzu sind in der Regel auch Wertgrenzen definiert, die je nach Kommune von 20.000 bis 120.000 Euro reichen. |
Wert- oder aufwandsmäßig geringe Maßnahmen sind nur dann in den Feuerwehrbedarfsplan aufzunehmen, wenn sie der strategischen Zielerreichung dienen oder sich die Politik und Verwaltung demonstrativ mit den jeweiligen Sachverhalten beschäftigen und dazu positionieren soll. So zielt zum Beispiel der Beschluss von teilweise finanziell geringfügigen personalfördernden Maßnahmen für die Freiwillige Feuerwehr (vgl. Kapitel 9.5) auf ein aktives Bekenntnis der Stadt- oder Gemeindeverantwortlichen zu ihrem Ehrenamt ab, das auch entsprechende politische und motivierende Signalwirkung in der Öffentlichkeit entfaltet.
| Kein Inhalt eines Feuerwehrbedarfsplans:Nicht in den Feuerwehrbedarfsplan gehören grundsätzlich21 Ausweisung des hauptamtlichen Personalbedarfs (Stellenplan) Rückwärtiger Dienst (»Büro- oder Innendienst« bzw. »Tagesdienst«) Leitstellenbemessung Rettungsdienst Beschaffungsreihenfolgen/-listen |
Der (stellenwirksame) rechnerische Personalbedarf von hauptamtlichen Mitarbeitern ist grundsätzlich nicht im Feuerwehrbedarfsplan selbst, sondern in einem separaten Papier, in der Sitzungsvorlage für das politische Gremium oder als Anlage zum Feuerwehrbedarfsplan aufzuführen. Der Personalbedarf ist von der im Bedarfsplan aufgeführten einsatztaktischen Funktionsbesetzung (vgl. Kapitel 7.4), vom Dienstmodell22 sowie von den personalwirtschaftlichen Parametern des Mitarbeiterstamms (vgl. Kapitel 9.4.3) abhängig, wobei letztere regelmäßigen Schwankungen unterliegen (im Gegensatz zum festgelegten Funktionsbesetzungsplan). Im Bedarfsplan ausgewiesene Veränderungen des Personalbedarfs könnten fälschlicherweise auf eine bedarfsplanerische Anpassung des Versorgungsniveaus zurückgeführt werden anstatt auf die tatsächlich ursächlichen Veränderungen im Bereich der Personalausfallzeiten, die sich völlig unabhängig von den bedarfsplanerischen Festlegungen ergeben. Die Überprüfung der notwendigen Personalausstattung sollte daher auch in kürzeren Zeitabständen erfolgen als eine Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans (empfohlenermaßen mindestens jährlich). Würde der Personalbedarf direkt im Bedarfsplan festgeschrieben, würde bei jeder personalwirtschaftlichen Änderung erneut ein politischer Beschluss über den Feuerwehrbedarfsplan erforderlich werden.
Die notwendigen Leitstellen sind selbstverständlich integraler Bestandteil der Feuerwehrstrukturen. Die Dimensionierung von Leitstellen unterliegt jedoch anderen Bemessungsmethoden und -grundsätzen und bezieht sich auf einen separaten Planungsbereich. Durch die Leitstelle bedingte Defizite (z. B. verlängerte Dispositionszeiten) dürfen sich nicht auf die Bemessung der operativen Feuerwehrstruktur auswirken (z. B. auf die Standortstruktur der im Versorgungsbereich der Leitstelle befindlichen Feuerwehren), weshalb die Leitstellen außerhalb des Feuerwehrbedarfsplans bemessen werden sollten. Ohnehin werden Leitstellen in der Regel nur von Berufsfeuerwehren in kreisfreien Städten betrieben, während für kreisangehörige Gemeinden der Träger der Leitstelle der Landkreis oder regionale Leitstellenverbünde sind. Daher fällt die bedarfsplanerische Auslegung der Leitstelle in den meisten Fällen auch gar nicht in den Verantwortungs- und Kompetenzbereich der Kommunen.
Da die Feuerwehrbedarfsplanung »im klassischen Sinne« nur den operativen Teil einer Feuerwehr (Einsatz- bzw. Ausrückedienst) umfasst, bleibt hierbei die Bemessung des rückwärtigen Dienstes (personell besetzte Abteilungen, Sachgebiete, Werkstätten usw.) unberücksichtigt und bedarf einer separaten Organisationsuntersuchung. Auch wenn tiefgreifende Schnittstellen zum Einsatzdienst vorliegen, ist die hierbei anzuwendende Untersuchungsmethodik vielmehr der klassischen Bemessung einer öffentlichen Verwaltung zuzuordnen (Bundesministerium des Inneren/Bundesverwaltungsamt, 2016) als der risikoanalytischen Ansätzen Feuerwehrbedarfsplanung.
Auch die rettungsdienstliche Versorgung ist nicht Teil eines Feuerwehrbedarfsplans, da sie dem Rettungsdienst- und nicht dem Feuerwehrrecht zuzuordnen ist, sie in der Regel in unterschiedlicher Trägerschaft liegt (außer bei kreisfreien Städten, die häufig auch Träger des Rettungsdienstes sind) und für sie eine eigene Bedarfsplanung mit abweichender Methodik erstellt wird.