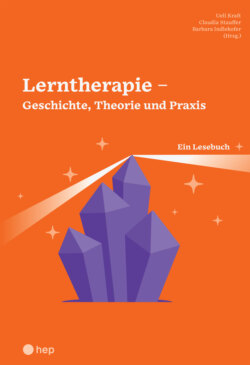Читать книгу Lerntherapie – Geschichte, Theorie und Praxis (E-Book) - Ueli Kraft - Страница 31
2.7 Praktische Implikationen für die Lerntherapie
ОглавлениеWelche Implikationen hat die Bindungstheorie für die Lerntherapie? Lernen setzt Beziehung voraus – von Beginn des menschlichen Lebens an und über die gesamte Lebensspanne. Das in Abbildung 1 dargestellte Gleichgewicht zwischen dem Grundbedürfnis nach emotionaler Sicherheit und dem Lern- und Leistungsbedürfnis von Individuen kann in der Lerntherapie eine zentrale Rolle spielen oder nur latent im Hintergrund wirken. Veranschaulicht wird dies durch die Resultate einer Experimentalstudie mit Kindern im Alter zwischen 11 und 13 Jahren (Zemp, Bodenmann & Beach, 2014). Die Kinder sahen durch zufällige Zuteilung eine von drei kurzen Filmszenen im Forschungslabor: (1) einen Konflikt eines Ehepaars, (2) eine Sequenz aus einem Actionfilm für Kinder oder (3) eine ruhige Tierszene aus einem Naturdokumentarfilm. Unmittelbar vor und nach der Videodarbietung wurden die Aufmerksamkeitsleistung mittels eines Aufmerksamkeitstests sowie das emotionale Befinden der Kinder erfasst. Zusätzlich wurde während der Filmexposition die kindliche Hautleitfähigkeit als physiologischer Stressmarker gemessen. Die Resultate zeigten, dass der Paarkonflikt die Kinder emotional am stärksten aufwühlte, jedoch löste der Actionfilm höhere physiologische Erregung aus als der Paarkonflikt und der Naturfilm. Bemerkenswert war der Befund, dass die Konfliktszene die Aufmerksamkeitsleistung der Kinder stärker beeinträchtigte als der Actionfilm. Darüber hinaus zeigte sich, dass Kinder aus konfliktreichen Familien (d.h. Kinder, die zu Hause häufig ungelöste Konflikte zwischen den Eltern erlebten), die zudem physiologisch stark auf den Paarkonflikt reagierten, besonders starke Aufmerksamkeitsprobleme nach dem Konfliktvideo aufwiesen (Zemp, Bodenmann & Cummings, 2014). Beachtenswert ist, dass es sich bei diesen Ergebnissen um die Effekte einer einmütigen Filmszene mit einem Schauspielerpaar handelte. Es ist anzunehmen, dass reale Paarkonflikte im Familienalltag stärkere Auswirkungen haben, weil sie in der Regel länger dauern, häufig thematisch das Kind betreffen und beängstigender sind, weil es sich um dessen eigene Eltern handelt.
Die Studienresultate weisen darauf hin, dass das Erleben von häufigen Paarkonflikten zu Hause das elementare Bedürfnis von Kindern nach emotionaler Sicherheit in der Familie bedrohen kann. Sie sorgen sich um ihr eigenes und das Wohl der Eltern und sind verunsichert über die zukünftige Stabilität der Familie. Diese Bedrohung und Besorgnis können das Kind so nachhaltig beschäftigen, dass sie auf Kosten seiner Aufmerksamkeits- und Konzentrationsleistung gehen. Das Verarbeiten dessen, was zu Hause vor sich geht, hat Priorität gegenüber dem Lernen und den Schulaufgaben und braucht mentale Kapazität, was den gesunden neuropsychologischen Funktionen abträglich sein kann. Die Relevanz dieser Befunde dürfte auch im Erwachsenenalter noch gegeben sein, da beispielsweise gut bekannt ist, dass Partnerschaftskonflikte häufig in den beruflichen Kontext überschwappen und das Leistungsverhalten der Partner im Job beeinträchtigen. Vice versa zählt beruflicher Alltagsstress zu den wichtigsten Ursachen für Partnerschaftskonflikte und Trennungen/Scheidungen (Bodenmann, 2000, 2016b).
Aus dieser Forschung lässt sich eine wichtige praktische Implikation für die Lerntherapie ableiten: Konflikte in sozialen Beziehungen (familiäre, partnerschaftliche, freundschaftliche, berufskollegiale etc.) verdienen bei der Diagnostik und Therapie von Lernschwierigkeiten besondere Beachtung durch die Fachperson. Es erscheint notwendig, dass in der Praxis insbesondere bei Kindern gründlich erfragt und berücksichtigt wird, ob familiäre Spannungen (bspw. elterliche Partnerschaftskonflikte oder Eltern-Kind-Konflikte) bestehen, unter denen das Kind nicht zur Ruhe kommen kann oder von denen es kognitiv und emotional in Anspruch genommen wird (Zemp & Bodenmann, 2015).
Gelingendes Lernen findet sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene in tragfähigen sozialen Beziehungskontexten statt. Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten gehen auch eine Form von Beziehung zu ihrer Klientel ein. Diese Beziehung kann zwar nicht als Bindungsbeziehung verstanden werden, dennoch stellen die Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten innerhalb des professionellen Rahmens verlässliche, unterstützende und wertschätzende Bezugspersonen dar. Die Qualität dieser therapeutischen Beziehung wird von multiplen Faktoren beeinflusst: Alter, Geschlecht, Bedürfnisse und Ziele der Klientin oder des Klienten, Mandat der Lerntherapie, Persönlichkeitseigenschaften der Klientin oder des Klienten und der Lerntherapeutin oder des Lerntherapeuten sowie deren gegenseitige Passung, Dauer der lerntherapeutischen Begleitung, Frequenz der Sitzungen et cetera. Basierend auf der Grundannahme der Bindungstheorie, dass das menschliche Bindungsverhalten durch die inneren Arbeitsmodelle gesteuert wird, kann davon ausgegangen werden, dass Kinder und Erwachsene, die eine unsichere Bindung entwickelt haben, die gleichen Erfahrungen in neuen Beziehungen (persönliche sowie therapeutische) erwarten. Aus diesem Grund setzen Individuen selbst in diesen Beziehungen die gleichen, aufgrund ihrer Lebenserfahrung bewährten und über die Jahre tief verfestigten Bindungsstrategien ein. Jede neue Bezugsperson wird an diese bestehenden Schemata angepasst, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese wiederum die erwarteten Reaktionen zeigt. Zum Beispiel löst das vermeidende Bindungsverhalten eines Kindes (Typ A) häufig eher abweisende oder distanzierende Reaktionen durch die Umwelt (Gleichaltrige, Lehrkräfte, Eltern, Therapeutinnen und Therapeuten) aus, da kein Zugang zum Kind möglich erscheint. Dies verstärkt erneut die Erwartung des Kindes, dass es Zurückweisung erfährt und es bei Bedarf keine Unterstützung erhält. Es ist eine Form der «selbsterfüllenden Prophezeiung», da häufig unbewusst in neuen Beziehungen gleiche Erfahrungen provoziert werden, mit der Folge eines ungünstigen, sich aufrechterhaltenden Kreislaufs (Stabilität der unsicheren Bindungsmuster nimmt zu).
Das Durchbrechen dieses Kreislaufs erfordert neue Beziehungserfahrungen. In der Psychotherapie setzt man diese Möglichkeit der Veränderung aktiv ein, indem gegenüber der Patientin oder dem Patienten komplementäres, grundbedürfnisorientiertes Therapeutenverhalten gezeigt wird. Dieses soll die individuellen (Bindungs-)Bedürfnisse und Ziele der Patientinnen und Patienten (z.B. Anerkennung, Unterstützung, Zuwendung) erfüllen, um ihnen neue, korrektive Erfahrungen zu ermöglichen (Grawe, 2000). An dieser Stelle ist die Abgrenzung der Lerntherapie von der Psychotherapie hervorzuheben: Nie ist es das Ziel der Lerntherapie, unsichere Bindungserfahrungen oder Bindungsstörungen zu behandeln, wozu in der Regel eine langjährige Psychotherapie indiziert ist. Sehr wohl können die bindungstheoretischen Kenntnisse aber das Verständnis von Lerntherapeutinnen und Lerntherapeuten für die individuellen Lernschwierigkeiten und Schulleistungsprobleme ihrer Klientel erhöhen und ihre therapeutische Haltung und methodischen Zugänge beeinflussen. Die Qualität der therapeutischen Beziehung gehört zu den stärksten allgemeinen Wirkfaktoren der Psychotherapie (Grawe, 2000). Analog dürfte die Qualität der Beziehung zwischen Klientin oder Klient und Lerntherapeutin oder Lerntherapeut massgeblich zum nachhaltigen Erfolg der Lerntherapie beitragen.