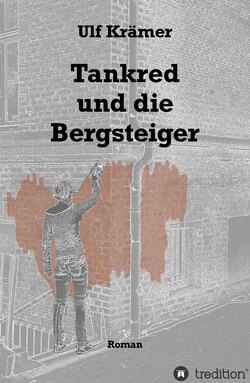Читать книгу Tankred und die Bergsteiger - Ulf Kramer - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1991
Kurz vor den Weihnachtsferien stapfte ich mit einer eingebildeten Teenagerdepression nach Hause. Das war zu dieser Zeit so etwas wie mein Markenzeichen. In der Schule quälte mich meine Klassenlehrerin, zuhause mein großer Bruder. Meine kleine Schwester, an der ich meinen Frust hätte auslassen können, verbrachte ein Schuljahr in den USA. Außerdem war schlechtes Wetter, meine Schuhe drückten und als wäre das alles nichts, gingen die anderen aus meiner Klasse am Nachmittag zum Eislaufen. Dann hielten Mädchen und Jungen Händchen, während sie zu Phil Collins im Kreis schlitterten. Andere rauchten heimlich hinter der Eishalle, die besonders Harten tranken dazu Bier. Die festen Pärchen trafen sich im Gebüsch, um zu knutschen oder Sachen zu machen, von denen ich trotz meiner fünfzehn Jahre bisher ausschließlich theoretische Kenntnisse hatte. Bei einigen Dingen hinkte ich hinterher. Außerdem hasste ich Phil Collins.
Aus Trotz machte ich einen Abstecher zu Andis Plattenladen, der sich praktischerweise im Vorderhaus der Bonner Straße 42 befand. Andi war einer der besten Freunde meiner Mutter. Die beiden kannten sich seit Studententagen. Mir machte das manchmal Sorge, denn Andi war ein echter Freak. Sein Leben bestand aus Vinyl. Er kannte so ziemlich jede Band und jeden Musiker dieses Planeten – zumindest aus den Genres Rock, Metal und Punk. Man hätte ihn als eine Art lebendes Musikkompendium beschreiben können. Dabei schien er allerdings vergessen zu haben, Gesellschaftskonformitäten wie Frau, Kind, Haus, Auto, Hund und Rentenversicherung auf die Reihe zu bekommen. Ab und zu tat er mir fast Leid, wenn ich an seinem Laden vorbei nach Hause ging und ihn einsam hinter seinem Tresen stehen sah. An diesem Tag suchte ich ihn auf, um mich davon abzulenken, dass meine Altersgenossen Madonna und Phil Collins hörten. Gut, ich selbst war eine Weile in Madonna verliebt gewesen – oder in ihr Bild auf der Single von Material Girl. Aber das war in den Achtzigern gewesen, ich ein orientierungsloses Kind und Madonna eine Frau, die mit Sex und Popmusik dabei war, die ganze Welt um den Finger zu wickeln. Andi schwärmte von der neuen Platte einer Gruppe namens Nirvana, von der ich noch nie gehört hatte. Ich hatte keine Lust auf eine weitere Hippieband nach Andis Geschmack und sah zu, nach Hause zu kommen. Der Tag würde nichts Gutes hervorbringen, das ließ sich mühelos prognostizieren.
Vor unserer Wohnung fand ich einen an die Tür geklebten Zettel. Unser Nachbar bat darum, bei ihm zu klingeln. Es sei wichtig. Das war keine gute Nachricht. Herr Lörich erfüllte alle Voraussetzungen eines eigenartigen Kauzes. Er hatte mit irgendeinem neuartigen Computerkram extrem viel Geld verdient und vor ein paar Jahren die Wohnung im Stockwerk über uns sowie die beiden Ladenlokale im Vorderhaus gekauft. Seitdem schien er keiner echten Beschäftigung nachzugehen. Stattdessen spielte er den netten Onkel aus der zweiten Etage, Hausmeister ehrenhalber, Smalltalkpartner für alle Lebenslangen und solche Sachen. Dabei war er noch gar nicht so alt, ich schätzte ihn auf dreißig oder vierzig.
Ich schloss die Tür auf, ging in die Küche, erinnerte mich daran, dass meine Mutter erst nachmittags wiederkommen würde, schleuderte frustriert meine Tasche in die Ecke, kehrte um und stiefelte die Treppe hinauf bis zu Herrn Lörichs Wohnung. Ich wollte nicht schuld sein, geschah am Ende irgendetwas Schlimmes, weil ich einen Zettel ignoriert hatte. Kaum war das aufdringliche Rappeln der Klingel verstummt, öffnete Herr Lörich die Tür. Er wirkte wie immer wie aus dem Ei gepellt und lachte mich vergnügt an. Ich murmelte eine unhöfliche Begrüßungsfloskel nach dem Motto: was stehlen Sie meine Zeit, Sie Schrat. Immerhin war ich ein schwer beschäftigter Teenager.
»Mein guter Tankred, komm, komm«, rief Herr Lörich völlig ungerührt. »Ich habe eine tolle Überraschung.«
Er zog mich mit sich in seine akkurat aufgeräumte und klinisch reine Küche. Ich sträubte mich und war kurz davor, ihm vors Schienbein zu treten, als ich das Mädchen erblickte. Es lehnte gegen den Geschirrspüler und schaute mich missbilligend an. Mit den schwarzen langen Haaren, die ihm zottelig und schmutzig über die Schultern fielen, den abgewetzten Klamotten und Militärstiefeln, einem alten Rucksack auf dem Rücken und einer lächerlichen grünen Sonnenbrille auf der Nase – es war Winter und wir befanden uns in Herrn Lörichs Wohnung – löschte dieses Mädchen für einen Augenblick meine schlechte Laune, meinen Groll auf die Malaisen des Lebens sowie meinen Frust über die Weigerung meiner Mitmenschen, mich endlich zu verstehen. Dieses Mädchen löschte alles. Ich dachte nicht einmal mehr, war aber noch.
»Das ist Lejla«, erklärte Herr Lörich. »Deine Mutter wird sie bei euch aufnehmen, bis in ihrem Heimatland kein Krieg mehr herrscht. Davon weißt du doch sicher?«
Ich schüttelte verdattert den Kopf.
»Ist ja auch egal. Sie ist ein bisschen früher als geplant angekommen. Ich habe sie heute Morgen im Innenhof aufgegabelt. Bei euch war keiner da. Deshalb der Zettel. Aber sie ist recht eigenwillig. Hat sich geweigert, ihren Rucksack abzunehmen.«
Lejla schaute Herrn Lörich finster an. »Ich kenne dich nicht. Kann sein, dass ich wegrennen muss.«
»Also vor mir brauchst du keine Angst zu haben«, brachte ich mühsam hervor.
Sie lächelte mitleidig. Anscheinend glaubte sie mir sofort. »Tut mir leid, dass ich dich störe.«
»Macht ja nichts. Ich hatte ohnehin nichts vor.«
»Die Betreuer im Flüchtlingsheim sind Arschlöcher«, sagte sie. »Die haben mich heimlich hübsche Hure genannt. Ich würde ordentlich die Beine breit machen, damit ich in Deutschland bleiben könne. Die Idioten haben gedacht, ich würde sie nicht verstehen. Deshalb bin ich da abgehauen.«
Mir wurde schwindelig. Sie sprach für einen Flüchtling in der Tat erstaunlich gut Deutsch. Dieser Umstand machte sie beinahe verdächtig, zumindest solange man dem Vorurteil folgte, dass Menschen aus anderen Ländern höchstens radebrechen. Zugleich wunderte ich mich über ihre Wortwahl.
»Unser junger Gast hat seine Kindheit in Wien verbracht, musst du wissen«, sagte Herr Lörich, als könnte er meine Gedanken lesen. »Lejlas Eltern führten dort ein Restaurant.«
»Aha.«
»So viel habe ich schon herausbekommen.« Er grinste Lejla an, die daraufhin schnell wegschaute.
»Ich weiß auf jeden Fall nichts davon, dass wir jemanden aufnehmen«, sagte ich unsicher, weil ich keine Ahnung hatte, wie das hier weitergehen könnte.
»Eigentlich sollte sie erst nächste Woche zu euch kommen«, sagte Herr Lörich und strahlte dabei über das ganze Gesicht, als habe er etwas ganz Wunderbares zu berichten. »Vielleicht hat deine Mutter dir deshalb noch nichts von ihr erzählt.«
Lejla stapfte ungeduldig von einen Fuß auf den anderen. Anscheinend hatte sie genug von unserem Nachbarn. Wir verabschiedeten uns von Herrn Lörich und gingen ein Stockwerk tiefer in unsere Wohnung. Hier legte sie ihr Gepäck und die Sonnenbrille ab. Ich servierte ihr Apfelsinensaft und Nussschokolade von Aldi, von der ich mir nicht sicher war, sie zu mögen oder nicht, so seltsam schmeckte sie.
»Woher kommst du denn?«, fragte ich, um ein Gespräch zu entwickeln. Schweigen ist bekanntlich schwieriger, als belangloses Zeug zu labern.
Sie nahm ein Stück Nussschokolade und betrachtete es misstrauisch. »Dubrovnik.«
Das hatte ich schon einmal gehört, konnte es aber nicht einordnen. Alles, was nicht umgehend mein Interesse weckte, pflegte ich wieder zu vergessen. So halten sich Jugendliche Hirnkapazität für die wichtigen Dinge im Leben frei. Dubrovnik hätte folglich alles sein können, ein Putz- oder Brechmittel, eine Automarke aus dem noch unbekannten Ostteil unseres Kontinents, der niedliche Hund einer isländischen Zeichentrickserie oder ein griechisches Folterinstrument.
Lejla erklärte mir, um die Stadt würde seit einigen Monaten gekämpft und ihre Eltern hätten sie fortgeschickt, um sie in Sicherheit zu bringen. Ich kannte die Bilder des Jugoslawienkriegs aus dem Fernsehen. Für mich befand sich das alles in einem anderen Universum, denn was sich dort ereignete, erschien mir vollkommen surreal. Menschen, die anderen Bomben auf den Kopf werfen, gehörten nicht zu meiner Lebenswirklichkeit. Ich holte einen Atlas aus meinem Zimmer und ließ mir von Lejla zeigen, wo sich ihre Heimatstadt befand. Sie erklärte mir, aus der jugoslawischen Teilrepublik Kroatien zu stammen, die sich für unabhängig erklärt habe. Dubrovnik lag ganz im Süden an der Adria gegenüber von Italien. Ich war sofort neidisch, denn ich hätte zu gern direkt am Meer gelebt. Wasser in ozeanischen Mengen ist etwas Besonderes. Allerdings schien es 1991 in Dubrovnik nicht besonders idyllisch, denn die von den Serben geführte jugoslawische Armee beschoss laut Lejla die Stadt von einem hohen Berg mit Granaten und anderen Schweinereien.
Wir rechneten die Luftlinie von hier nach Dubrovnik aus. Ich kam zu dem Schluss, Lejlas Heimatstadt sei 130.000 Kilometer entfernt, was mir zwar ungeheuer weit vorkam, aber im ersten Moment durchaus plausibel, denn Krieg musste weit weg sein. Lejla fing herzhaft an zu lachen. Ihre Fröhlichkeit erstaunte mich. Ich hätte nicht gedacht, dass Menschen, in deren Land Krieg herrschte, so sein konnten.
»130.000 Kilometer sind ein Drittel der Distanz zum Mond«, sagte sie. »Ich bin aber nicht mit dem Raumschiff gekommen.«
Ich wunderte mich, woher Lejla die Entfernung zum Mond kannte, denn die erschien mir reichlich abstrakt. Ich rechnete erneut und kam diesmal auf 1.300 Kilometer. Wir fuhren regelmäßig in den Urlaub nach Südtirol, die Strecke von hier betrug 900 Kilometer.
»Wieso kennst du die Distanz zum Mond?«, fragte ich.
»Ist doch gut zu wissen, wie weit er weg ist. Dann erscheint hier auf der Erde Vieles näher«, antwortete sie.
Ich sparte mir eine Antwort, da ich fürchtete, mich vor ihr lächerlich zu machen. Stattdessen rechneten wir noch ein bisschen. Von hier nach Wien waren es 750 Kilometer. Nach Toronto 6.200 Kilometer. Von Dubrovnik nach Sydney 15.800 Kilometer. Dubrovnik London 1.700 Kilometer und so weiter. Dann kam mein Bruder nach Hause und machte sich über uns lustig, was wir doch für kranke Spacken seien und was ich da für eine neue Pennerfreundin mitgebracht habe. Er befand sich in einer schwierigen Phase, da er sich mit seinen zwanzig Jahren für total erwachsen hielt, sich aber nicht so benahm.
»Das ist Lejla«, erklärte ich ihm. »Sie kommt aus Dubrovnik. Da ist Krieg und es ist ungefähr 1.300 Kilometer entfernt.«
»In deinem Hirn ist auch Krieg oder warum laberst du so einen Scheiß?«
Linus absolvierte gerade den Zivildienst und plante, anschließend BWL zu studieren, um eines Tages richtig Schotter zu machen. Zumindest behauptete er das. Nachdem auch meine Mutter heimgekommen war und Lejla überschwänglich begrüßt hatte, berief Linus eine Krisensitzung in der Küche ein. So etwas hatte es in unserer Familie noch nie gegeben, aber mein Bruder faselte etwas von Demokratie, gleichen Rechten für alle und mangelhafter Informationspolitik seitens meiner Mutter, da sie uns Lejlas Ankunft verschwiegen habe. »Wir haben nicht gemeinsam darüber abgestimmt, also muss die weg«, sagte er energisch.
Lejla saß eingeschüchtert am Ende des Tisches und spielte an ihrer Teetasse herum. In eine fremde Familie zu kommen und dann eine Diskussion über die eigene Abschiebung anhören zu müssen, war sicher nicht schön.
»Das ist meine Wohnung«, erklärte meine Mutter glücklicherweise. »Wir haben genügend Geld und Platz, leben in Frieden und besonders ihr, meine lieben Söhne, in übertriebenem Wohlstand. Wir sollten uns in Grund und Boden schämen, nähmen wir dieses arme Mädchen nicht bei uns auf.«
Damit war die Sache geklärt. Für mich brach eine neue Zeitrechnung an und ich lernte die Spannweite des Lebens zwischen Himmel und Hölle kennen. Sie reichte weiter als eine Reise nach Dubrovnik.
Ich weihte Lejla nach und nach in das Leben der Familie Deutsch ein. Sie lernte Andis Plattenladen kennen, die Bäckerei der Gebrüder Bellof, Tante Yildiz’ staubige Schneiderei und natürlich das Kettmanns, die beste Pommesbude der Stadt, wahrscheinlich sogar des Universums. Ich liebte das Kettmanns. Die Pommes waren goldgelb, sie waren knusprig und nie matschig, die Mayo gab es in einem mächtigen, glänzenden Haufen obendrauf, so dass man zu Beginn ein Verhältnis von fünfzig Prozent frittierter Kartoffel zu fünfzig Prozent Mayofett im Mund hatte, bis man sich allmählich zum Boden der Pappschale durchfutterte und der Pommesanteil stieg. Am Bahnhof hatten Anfang der Neunziger einige türkische Läden aufgemacht, die Döner verkauften, das zog einen Teil der Kundschaft weg vom Kettmanns, aber ich schwor mir, meiner Pommesbude treu zu bleiben, denn Fleisch mit Salat in Brot klang zwar ganz nett, aber ordentlich in Fett zubereitete Kartoffelstreifen konnten es mit Hammel am Spieß jederzeit aufnehmen. Bei Kettmanns gab es dazu Wurst in allen Variationen und natürlich Schnitzel und Hähnchen, die auch nicht schlecht waren. Ich persönlich bevorzugte neben den Pommes die Frikadellen, die geheimnisvoll nach mehr als Hack schmeckten. Döner wurde in der besten Pommesbude des Universums nie serviert und das gefiel mir, weil Schuster bei ihren Leisten bleiben sollten, wie Herr Lörich zu sagen pflegte.
Während Lejla meine kleine Welt kennenlernte, hatten die Kroaten im Frühjahr 1992 die Schlacht um Dubrovnik für sich entschieden. Uns erreichte die Nachricht, dass niemand aus Lejlas Familie dabei zu Schaden gekommen war, allerdings war ihr Haus größtenteils zerstört und musste wiederaufgebaut werden. Da im Umfeld der Stadt nach wie vor gekämpft wurde, sollte Lejla vorerst bei uns bleiben. Das beruhigte mich, denn ich hatte mich an ihre Anwesenheit gewöhnt, vielleicht sogar mehr als das. Ich blieb morgens länger als sonst vor dem Spiegel stehen, um meine Frisur zu kontrollieren oder nach neuen Pickeln im Gesicht Ausschau zu halten, bevor ich zum Frühstück in die Küche ging. Lejla war stets vor mir da, hockte die Beine angewinkelt vor den Körper gepresst und das Kinn auf die Knie gelegt auf einem Stuhl und schlürfte an einer Tasse mit Kaffee – sie war gerade erst fünfzehn geworden und trank ihn schwarz, was ich extrem sexy fand. Meistens schenkte sie mir zur Begrüßung ein müdes Lächeln und ließ damit mein Herz schneller schlagen. Bevor wir sie aufgenommen hatten, wären mir solche Formulieren albern vorgekommen. Das Herz schlägt schneller, der Atem bleibt einem weg, Schmetterlinge im Bauch, Frühlingsgefühle haben. Lächerlich! Jetzt konnte ich es spüren, es war wirklich so. Sobald ich Lejla sah, tanzte etwas in meinem Magen. Ich konnte in ihrer Anwesenheit kaum essen, bekam feuchte Hände und lachte hysterisch über alles, was sie sagte. Meine Mutter beobachtete meine peinliche Teenagerposse mit einem gutmütigen Grinsen im Gesicht. Problematisch gestaltete sich Lejlas Reaktion auf mein Gebaren. Sie interessierte sich einfach nicht für mich. Zumindest kam es mir so vor. Bestätigt sah ich mich, als ich sie hinter der Turnhalle der Schule ausgerechnet mit meinem Klassenkameraden Axtbrecher beobachtete, einem Vollidioten vor dem Herrn, super Noten, reiche Eltern, ausgefallene Frisuren, große Klappe und arrogant bis in die letzte Haarspitze. Vermutlich hatte er schon mit der Muttermilch die Überzeugung aufgesogen, nahezu allen anderen Menschen des Planeten grundsätzlich überlegen zu sein. Diskutierte man mit ihm, dann hatte er recht, ganz egal, worum es ging, denn sein Argument atmete die Legitimation eines Axtbrechers. Er besaß die Deutungshoheit über die Worte, über das Wesen der Dinge, über den Humor und die Gefühle. Ich war ziemlich weit weg, aber ich glaubte einigermaßen sicher sehen zu können, wie die beiden Händchen hielten und er ihr einen Kuss auf die Wange drückte. In diesem Moment hasste ich Axtbrecher mehr als jeden anderen Menschen zuvor.
Um überhaupt weiterleben zu können, flüchtete ich mich in die innere Emigration. Natürlich begegnete ich Lejla regelmäßig in unserer Wohnung, aber ich stellte jede überflüssige Kommunikation ein und vermied es weitestgehend, mich im selben Raum wie sie aufzuhalten. Meine Mutter bemerkte meine schlechte Stimmung, aber mit ihrem bescheuerten Ansatz der antiautoritären Erziehung ließ sie ihren jugendlichen Sohn Miseren lieber selbst lösen, als sich aktiv einzuschalten. Das war auf der einen Seite gut, denn ich fand es schwierig, mit meiner Mutter über Emotionen zu sprechen, andererseits hätte ich ihre Hilfe in dieser Phase meines Lebens gut gebrauchen können, denn ich haderte allgemein mit mir. Ich war nicht sonderlich beliebt unter Gleichaltrigen, hatte nur oberflächlich gute Freunde. Nach und nach manifestierte sich, dass ich niemals ein herausragender Basketballer werden würde, weil ich nicht anständig wachsen wollte und mir das letzte Quäntchen Talent abging. Zusätzlich fehlte mir jeder Bartwuchs, wie oft ich meine Haut auch mit einem Rasierer malträtierte – ich glaubte an das Märchen, das würde meine Haarwurzeln samt Wuchs stimulieren. Und dann die Sache mit Lejla. Also verbarrikadierte ich mich so gut es ging in meinem Zimmer und tat so, als gäbe es keine Welt außerhalb der dunklen Hallen von Wolfenstein 3D. Meine Noten fielen innerhalb von Wochen ins Bodenlose. Dafür erarbeitete ich erfolgreich Strategien, um erstens in meiner virtuellen Co-Existenz von Wolfenstein möglichst viele Nazis abzuknallen und zweitens in der Realität Lejla auszuweichen. Meine Lehrer bemerkten nichts von meiner Pein. Sie zogen die üblichen Erklärungsversuche für mein Absacken heran: Faulheit, Dummheit, mangelnde Demut, Aufmüpfigkeit, Ignoranz, Desinteresse. Ein zutiefst verunsicherter Zehntklässler wie ich wurde, statt in den metaphorischen Arm genommen zu werden, auseinandergewalzt und anschließend zusammengefaltet. Besonders meine Klassenlehrerin Frau Krone zermalmte mein Ego durch kontinuierliche Hinweise auf meine Inkompetenz in nahezu allen Teilbereichen der menschlichen Existenz. It is now my duty to completely drain you, sang Kurt Cobain von dieser neuen Band namens Nirvana, die ich inzwischen doch leiden konnte. Dabei sah ich Frau Krone vor meinem inneren Auge, wie sie an ihrem Pult saß und diabolisch lächelte.