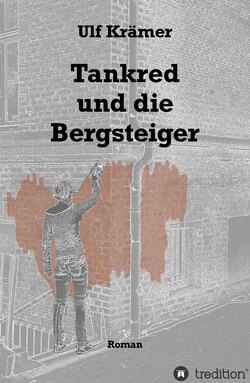Читать книгу Tankred und die Bergsteiger - Ulf Kramer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGeldof
Ihr Vater schenkte ihr das Gewehr zu Weihnachten. So war das Ende der Siebziger in Amerika, da legten Eltern ihren minderjährigen Töchtern eine Flinte unter den Weihnachtsbaum. Heute ist es bestimmt schlimmer. So muss es sein, weil immer alles schlimmer wird, schenkt man den Leuten Glauben. Sie öffnet das Fenster ihres Schlafzimmers, beobachtet die Schüler und Lehrer auf dem Schulhof gegenüber, wie sie es schon oft getan hat. Das alles langweilt sie. Zum Glück hat sie das Gewehr. Schießen hat sie von ihrem Vater gelernt. Gute Erziehung für einen orientierungslosen Teenager. Sie lädt die Waffe. Einatmen, ausatmen, den Puls beruhigen. Sie legt an, zielt, achtet auf den Wind, wie stark sich die Blätter an den Bäumen bewegen, visiert einen Mann auf dem Hof gegenüber an. Sie glaubt, dass es sich um den Hausmeister handelt, aber eigentlich ist ihr das egal. Sie drückt ab. Jemand stirbt. Die Menschen auf dem Hof wirken wie eine Herde Schafe. Jetzt rennen sie in Panik durcheinander. Das sieht lustig aus. Einer nach dem anderen sinkt zu Boden. Sie verbarrikadiert sich in ihrem Zimmer und wartet darauf, dass die Polizei auftaucht, um sie zu erschießen. Doch zuerst ruft die Presse an. Sie weiß nicht, woher der Reporter ihre Nummer hat. Es sei Montag und Montage möge sie nicht, erklärt sie ihm. So einfach kann das sein. Später wird sie verhaftet und wegen Mordes verurteilt.
Was in der jungen Amerikanerin vor sich gegangen ist, weiß ich nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, mit einem Gewehr auf Leute zu ballern oder aus einer Laune heraus mein Leben wegzuwerfen. So etwas machen Durchschnittstypen wie ich nicht. Aber ich kenne Bob Geldofs Lied über die Ereignisse von damals. Es läuft im Autoradio, während ich vom Geburtstag meines Patenkinds Helga flüchte. Ein Dutzend durchgedrehte Kindergartenkinder sind um mich herumgesprungen und haben dabei gelärmt wie eine Horde Schimpansen. Mir tun die Ohren weh, meine Nerven liegen blank, auf meinem Schuh klebt Marmelade von einer Scheibe Toast, die ein besonders renitentes Schimpansenkind in meine Richtung geschleudert hat. Kinder sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Alles wird immer schlimmer! Der Komparativ als Determinismus. Man sollte nach der ersten kleinen Katastrophe nicht erwarten, plötzlich im Wohlbefinden zu baden, sondern klugerweise das Gegenteil annehmen: die zweite größere Katastrophe. Deshalb plagen mich böse Vorahnungen, seitdem mich meine Mutter zu sich gebeten hat. Am Telefon wirkte sie beinahe hysterisch. Ihre Stimme war erst schrill, dann ganz plötzlich brüchig. So kenne ich sie nicht. Melodramatik liegt ihr nicht.
Ich parke im Innenhof der Bonner Straße 42 vor dem alten Atelier, das seit Jahrzehnten von wechselnden Künstlern und Studenten bevölkert wird. Meine Mutter wohnt im ersten Stock in der geräumigen Wohnung, die sie von ihren Schwiegereltern geerbt hat. Ich haste die Stufen hinauf und benutze meinen Schlüssel, um einzutreten. Meistens schelle ich vorher an, aber heute erscheint das überflüssig. Meine Mutter sitzt im Wohnzimmer am Fenster und starrt nach draußen. Ich trete neben sie und nehme sie kurz in den Arm. Von hier kann man den Lieferanteneingang der Bürgerpflicht, unserer kleinen Kneipe im Vorderhaus, sehen. Wahrscheinlich ist Önal dabei, alles für den alltäglichen Betrieb heute Abend vorzubereiten.
Meine Mutter führt mich in ihre Küche. Am Boden liegt in einer Blutlache Laurenz Tillinger. Ich kann mich nicht erinnern, wann mich zum letzten Mal etwas derartig unvorbereitet getroffen hat. Vielleicht als Lejla damals auf der Mine stand – oder als junges Mädchen vor unserer Tür. Aber das ist gefühlt tausend Jahre her. Ich halte mich am Tisch fest und versuche nicht zu schreien. Laurenz ist der beste Freund meiner Mutter. Seit sie ihm in den Achtzigern zur Flucht aus der DDR verholfen hat, verbindet die Familien Tillinger und Deutsch eine feste Bande.
»Warum rufst du keinen Krankenwagen?«, frage ich benommen.
»Ich habe Angst, dass er tot ist.«
Sie ist aschfahl im Gesicht. Ihre Hände zittern. Ich nähere mich dem scheinbar leblosen Körper am Boden. Laurenz blutet aus einer Wunde am Hinterkopf. Neben ihm auf dem Boden liegt die alte gusseiserne Pfanne, die meine Mutter benutzt, seit ich denken kann. Ich gehe neben Laurenz auf die Knie und halte mein Ohr über seinen Mund. Ganz schwach spüre ich seinen Atem. Erleichterung erfasst mich.
»Scheiße, Mama. Was ist passiert?«, flüstere ich leise, als könne meine Stimme Laurenz’ Atem zum Erlöschen bringen.
»Wir haben uns gestritten«, sagt meine Mutter und ich sehe sie weinen, zum ersten Mal in meinem Leben. Vielleicht hat sie geweint, als mein Vater gestorben ist, aber damals war ich noch so jung, ich habe in meinem Schmerz nur mich selbst wahrgenommen.
»Und dann hast du ihn erschlagen?«, frage ich plötzlich nervös.
Sie zuckt zurück, wirkt verschreckt, als habe ich etwas Ungeheuerliches von mir gegeben. Einen Moment hoffe ich zu träumen, dann wähle ich die 112. Viel zu spät.
»Was ist mit Linus und Anna?«, erkundige ich mich nach meinen Geschwistern.
»Anna ist mit ihrer Freundin weg. Die planen etwas wegen ihrer Reise nach Laos. Und Linus geht nicht ans Telefon.«
Das ist nicht weiter überraschend. Arbeitet mein Bruder nicht in unserem gemeinsamen Laden, sitzt er zuhause auf dem Sofa und schaut Fernsehen. Dabei lässt er sich nicht gern ablenken. Am anderen Ende der Notrufnummer meldet sich eine Frau. Ich erkläre ihr, wer und wo ich sei und dass ein schwerverletzter Mann in der Küche meiner Mutter liege.
»Ich raff das nicht, Mama!«, sage ich, nachdem ich aufgelegt habe, und beuge mich erneut zu Laurenz hinunter. Ich kann nicht besonders gut mit Verletzten umgehen und einen Ersthelferkurs habe ich seit der Fahrschule nicht mehr besucht. Das ist schon fast zwanzig Jahre her. Vielleicht sollte man Laurenz in die stabile Seitenlage bringen, aber ich erinnere mich nicht, wie das geht. Ich streiche ihm hilflos über die Wange und halte seine Hand. Er reagiert nicht. Aus der Wunde am Hinterkopf sickert dunkelrotes Blut. Vermutlich wäre es klug, den Fluss zu stoppen. Kann ich auf eine offene Kopfwunde ein Handtuch drücken? Was ist, wenn er einen Schädelbruch hat? Ich schätzte das Gewicht der schweren, alten Pfanne, die neben mir am Boden liegt, auf vier bis fünf Kilo. Ordentlich geschwungen und mit der passenden Hebelwirkung kann man damit einen Knochen knacken.
An der unteren Seite der Pfanne kleben graue Haare und Hautfetzen. Mir wird schlecht, aber ich reiße mich zusammen. In außergewöhnlichen Situationen ist es nicht opportun, gewöhnlich zu reagieren. Mein Blick fällt auf eine Zeitung neben der Pfanne. Sie ist nicht aktuell. Die Headline verkündet den Fund einer Leiche im Bahnhof. Das ist vor einigen Tagen durch die Presse gegangen. Ich kann mich erinnern, diesen Artikel beim Frühstück gelesen zu haben. Alina beschwerte sich darüber, dass ich keine Erdnussbutter gekauft hätte. Das Hirn merkt sich seltsame Details.
Als endlich die Sanitäter und der Notarzt kommen, verschwindet meine Mutter im Wohnzimmer. Die Männer untersuchen Laurenz vorsichtig, verbinden seine Wunde, legen ihm eine Halsmanschette an und verfrachten ihn auf eine Trage. Währenddessen kommt auch die Polizei, die routinemäßig mit dem Notruf vom Krankenhaus verständigt worden ist. Ein dicker Chefbulle befragt mich. Ich mache von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch, um meine Mutter nicht zu belasten. Das übernimmt sie dann selbst, in dem sie gesteht, Laurenz mit einer Pfanne niedergeschlagen zu haben. Mehr sagt sie nicht. Die Polizisten verhaften sie und nehmen sie mit. Einfach so. Keine großen Worte. Kein großes Drama. Kein Widerstand durch meine Mutter. Sie lässt es geschehen. Ich weiß nicht, ob ich vor Wut rasen oder verzweifeln soll. Die Beamten werfen mich aus der Wohnung, die als Tatort gesichert wird. Es handele sich womöglich um versuchten Mord, höre ich eine Polizistin durch ein altmodisches Funkgerät sagen, als ich die Treppe hinunter in den Innenhof gehe. Es sind genau einundzwanzig Stufen, das habe ich während meiner Kindheit hunderte Male gezählt. Immer und immer wieder einundzwanzig. In diesem Moment hätte es mich nicht gewundert, wären es plötzlich mehr oder weniger gewesen.
Ich schaue den beiden Wagen nach, während sie langsam davonrollen. In einem sitzt meine Mutter. Dann wird es still. Die Straße liegt menschenleer vor mir, nicht mal Vogelgezwitscher ist zu hören. Die Zeit scheint stehen zu bleiben. Ich rufe Alina an, die sich nicht meldet. Montags geht sie zum Badminton und danach mit ihrer Freundin etwas trinken. Währenddessen schaltet sie für gewöhnlich das Handy aus. Ich versuche es bei meinem Bruder. Er nimmt nicht ab. Wir verstehen uns nicht besonders, aber in Momenten wie heute halten Brüder zusammen. Dafür gibt es Familie. Solange meine Freundin nicht zu erreichen ist, stellt Linus eine Art natürlichen Ansprechpartner für Notsituationen dar.
Ich gehe die Straße Richtung Norden bis zum Axtbrecher-Komplex, einer modernen Wohnanlage, in die Linus vor einigen Jahren gezogen ist. Ich bin eine ganze Weile nicht mehr hier gewesen, zuletzt zu seinem zweiundvierzigsten Geburtstag. Kaum habe ich geklingelt, springt die Tür zum Hausflur auf. Oben ist die Wohnungstür nur angelehnt. Irgendetwas stimmt nicht. Dass Linus zuhause ist, nicht ans Telefon geht, aber ohne Nachfrage alle Türen öffnet, erscheint verdächtig. Er ist nicht der Typ, der Fremde mit offenen Armen empfängt. Sein erster Gedanke ist für gewöhnlich, was ihm weggenommen werden könnte. Ich weiß nicht, woher er das hat. Sowohl meine Mutter als auch meine Schwester Anna sind ganz anders als er.
»Das ging aber schnell«, ruft Linus aus dem Schlafzimmer. »Ich hole das Geld, kleinen Moment.«
Er erwartet den Lieferservice, denke ich. Linus steht auf chinesische Küche, vielleicht eine Art Ausgleich zu unserem Laden, der RegioCulina, in der wir regionale Feinkost verkaufen.
»Bin gleich da«, singt Linus mit hoher Stimme.
Ich komme ihm zuvor und drücke die Tür zum Schlafzimmer auf. Linus steht im Bademantel vor mir und lässt sein Portemonnaie auf den Boden fallen. Einige Münzen rollen klirrend über den Parkettboden. Ich schaue nach unten und sehe den runden Metallstücken zu, die durch den Raum kullern. Mein Blick wandert zum Fernseher, auf dem tonlos ein Film läuft, in dem eine Frau von zwei Männern gleichzeitig penetriert wird. Auf der Fensterbank darüber stehen ein Dutzend brennende Kerzen, dazwischen ein Kaktus. Im ganzen Schlafzimmer ist es schrecklich heiß und miefig. Die Frau im Film streckt ihren Hintern in Richtung Kamera. Über ihr ist ein riesiger Penis zu sehen. Ich finde Pornos ekelig, allerdings behalte ich das für mich, weil man mit solchen Ansichten unter Männern schnell als verklemmt gilt. Meine Vorstellung von Erotik ist anders, aber ich bin anscheinend seltsam sozialisiert. Viele mögen Pornos, sonst gäbe es sie nicht. Das nennt man Angebot und Nachfrage. Nicht ganz eindeutig ist, zu welcher Seite meine Freundin Alina zählt. Gehört sie zum Angebot oder bestimmt sie die Nachfrage? Mir gegenüber hat sie behauptet, Sex auf dem Bildschirm sei ihr zu unrealistisch. Deshalb haben wir nie zusammen einen Porno geguckt. Jetzt liegt sie nackt auf dem Bett. Ihr Haar ist schweißnass. Auf ihrer Brust klebt Sperma. Im Fernsehen wird gerammelt. In mir keimt der Verdacht, Alina könnte es mit der Ehrlichkeit nicht allzu genau nehmen. Wahrscheinlich spielt sie gar kein Badminton. Einen Schläger habe ich in unserer Wohnung noch nie gesehen. Für Sex braucht man keine Spielgeräte. Und sie trainiert nicht mit ihrer Freundin, sondern mit meinem Bruder. Sicher deponiert er seine Spermien bei Bedarf auch an anderen Orten als auf ihren Brüsten.
Ich starre auf eine Zwei-Euro-Münze vor meinem Fuß, meine Lieblingsmünze, nicht weil sie die wertvollste ist, sondern weil sie gut in der Hand liegt. Deshalb mag ich auch die kleinen, dicken Ein-Pfund-Münzen, mit denen ich in London bezahlt habe, als ich damals Lejla besuchte. Lejla. Ich habe mir eingeredet, in meiner Beziehung zu Alina sei kein Raum für sie – nicht mal in meinen Gedanken. Betrachte ich die Orgie aus Porno, Sperma, kitschigen Kerzen und Kleingeld, könnte das ein Fehler gewesen sein.
»Das ist jetzt schon eine Überraschung«, sage ich und kicke die Münze unter das Bett.
»Fuck …«, sagt Alina hockt sich auf die Knie, was es nicht besser macht, weil ich sie jetzt deutlicher sehen kann. Sie ist schön, aber leider verbraucht – auch wenn das fies klingt.
»Ja, das passt wohl«, bemerke ich lapidar.
»Mann, was machst du …«, brabbelt Linus hilflos.
»Wollte mal vorbeischauen, weil Alina beim Badminton ist.«
Ich wundere mich, wie ruhig ich bleibe. Der Kindergeburtstag am Nachmittag hat mich mehr aus der Fassung gebracht. An meinem Schuh klebt nach wie vor die Marmelade. Erdbeer-Mango. Was ist bloß aus der Welt geworden, dass Kinder so etwas essen? Alina mag keine Marmelade. Aber sie steht angeblich auch nicht auf Pornos und hat sich von mir nie mit Sperma bespritzen lassen. Wahrscheinlich isst sie heimlich Marmelade aus dem Glas. Mit den Fingern. Ich senke den Blick. Auf dem Boden neben einem weiteren Geldstück liegen zwei benutzte Kondome. Addiere ich die Spuren auf Alina, komme ich auf drei.
»Junge, du kommst doch sonst auch nicht unangemeldet. Wir haben doch alle Handys und können …«
»Halt die Fresse, Linus«, sage ich kopfschüttelnd.
Die Redewendung Junge hat er sich innerhalb des letzten Jahres angewöhnt. Mit Sprache hat er es nicht so. Wahrscheinlich denkt er, es wäre cool, wie ein Teenager zu sprechen. So kriegt er Frauen rum. Der Erfolg gibt ihm recht. Junge, Alina zu ficken ist echt töfte. Obwohl töfte heute kaum noch einer sagt und Linus ganz sicher nicht. Der Begriff ficken würde ihm stehen, denn das, was die beiden hier treiben, hat nichts mit Gefühlen zu tun, dafür kenne ich Alina zu gut. Sie empfindet nichts für Linus, ihr geht es um etwas anderes. Aber das ist belanglos. Alina ist Geschichte. Manchmal kann man nicht mehr zurück, so wie meine Mutter mit ihrer Pfanne.
»Jetzt bleib locker. Wir müssen reden, Tankred«, sagt Linus.
Ich habe keine Ahnung, worüber er angesichts dieser perfekt inszenierten Groteske mit mir reden möchte. Alina klettert aus dem Bett, allerdings scheint sie nicht zu wissen, was sie als nächstes tun soll. Verloren steht sie zwischen Linus und mir im Niemandsland und schaut abwechselnd zu ihm, zu mir und auf den Boden. Ich frage mich, warum sie sich nicht etwas überzieht, das könnte ihre Würde ansatzweise erhalten.
»Mama ist verhaftet worden«, sage ich zu Alina. »Und weil du beim Badminton bist, habe ich gehofft, mit Linus darüber sprechen zu können.«
»Wie? Verhaftet?«, fragt er.
»Sie hat Laurenz ins Koma geprügelt.«
Die Worte klingen absurd, passen aber gut in den Raum.
»Was soll das? Spinnst du jetzt? Verhaftet? Koma?«, ruft Linus.
»Sie beschuldigen sie des Totschlags oder Mordes oder was weiß ich.«
»Scheiße, das tut mir leid«, murmelt Alina und nimmt mich unvermittelt in den Arm, was mich einen Augenblick überwältigt, weil ich mit allem Möglichen gerechnet habe, aber ganz sicher nicht damit, dass meine nackte Freundin das Sperma meines Bruders, das sie nach wie vor auf ihrer Brust trägt, an meiner unverhältnismäßig teuren Übergangsjacke abwischt. So sanft wie möglich schubse ich sie weg. Alina taumelt einen Meter nach hinten, Linus springt nach vorn, um sie zu halten, aber sie wehrt ihn ab. Sie ist jung und durchtrainiert – wenn auch nicht vom Badminton –, einen kleinen Stoß kann sie ab.
Die Klingel ertönt.
»Eure Ente ist da«, sage ich. »Süß sauer. Lecker. Lecker. Lasst es euch schmecken.«
Ich verlasse das Schlafzimmer. Im Flur sehe ich Alinas Slip liegen. Die beiden hatten richtig Spaß und dann komme ich und mache alles kaputt. Wie ärgerlich. Im Treppenhaus begegne ich einem Mädchen mit zwei Tüten unter den Arm geklemmt. Anhand der Aufschrift identifiziere ich den Mongolen aus meiner Straße, bei dem Alina und ich jeden Sonntag bestellen. Ein bisschen Vertrautheit scheint sie auch in Linus‘ Armen zu brauchen.