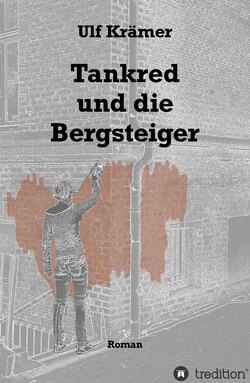Читать книгу Tankred und die Bergsteiger - Ulf Kramer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1984
Meine Kindheit war geprägt von meiner Mama, meinem Bruder Linus und einigen seltsamen Ereignissen, die ich meistens erst Jahre später einordnen konnte. Ich erinnere mich noch gut an das Ehepaar Popp, das in der Wohnung ein Stock über uns wohnte – bis irgendwann Herr Lörich die Wohnung kaufte und die beiden hinauswarf. Herr Popp war bei einer Versicherung angestellt, sie machte auf Hausfrau, obwohl die beiden gar keine Kinder hatten. Die Frau schaute immer freundlich, begegnete sie uns auf der Treppe, aber sie hatte eine Art an sich, die sie unheimlich wirken ließ. Sie nannte mich manchmal den Bastardjungen. Dabei lächelte sie fröhlich, als machte sie mir ein Kompliment, aber so dumm war ich nicht, zu glauben, die Bezeichnung Bastardjunge sei etwas Positives.
In der Schule bezeichnete mich niemand als Bastard, aber ohne Vater und mit einer unverheirateten Mutter aufzuwachsen, schien ungewöhnlich genug zu sein, um es wiederholt herauszustellen – allen voran von meiner Klassenlehrerin Frau Neumann, einer inkompetenten Hexe, der rational denkenden Menschen nicht mal ihren Kanarienvogel anvertraut hätten, wären ihnen der miese Charakter dieser Frau bekannt gewesen. Das Prinzip in meiner Grundschule war nicht Liebe und Vertrauen, wie man es sich von seiner ersten Klassenlehrerin wünscht, sondern blanke Angst. Wir waren fünfundzwanzig fehlbare Kinder im ewigen Kampf gegeneinander, vereint nur durch die panische Furcht vor dem Versagen. Trotzdem haben wir Frau Neumann verehrt, denn als kleiner Hosenscheißer klammert man sich an jeden Strohhalm, um den temporären Verlust der Mutter während der Schulzeit zu kompensieren.
Zum Sommerfest der Grundschule begleitete uns Platten-Andi, einer der besten Freunde meiner Mutter. Er kaufte mir Waffeln und Frau Neumann hinter dem Stand fragte, ob das mein neuer Vater sei. Es würde sie richtig freuen, unsere Familie könnte einen Mann gut vertragen. »Ein echter Junge braucht auch einen echten Kerl als Vaterfigur«, sagte sie lächelnd.
Ich hatte danach keinen Hunger mehr. Ihr Verhalten wirkte auf ein Kind meines Alters verstörend. Meine Mama kaufte mir einen Luftballon, den wir später mit Gas füllten, eine frankierte und mit unserer Adresse versehenen Postkarte daran befestigten und zum Abschluss der Feier zusammen mit Dutzenden anderer Ballons in den Himmel aufsteigen ließen. Am Ende sollte der gewinnen, der die größte Distanz hinter sich brachte – und dessen Karte zurückgeschickt wurde. Seltsamerweise schaffte es meiner mit Abstand am weitesten, nämlich bis in die DDR, die sich in meiner Vorstellung wirklich am Ende der Welt befand. Ich hätte mich freuen sollen, als die Postkarte mit freundlichen Grüßen von unseren sozialistischen Nachbarn zu uns zurückkam und ich einen Lego-Lastwagen als Preis erhielt. Aber ich ahnte, dass hier etwas nicht stimmte, und als meine Mutter etwas später verkündete, die Familie Deutsch würde bald ihre neuen Freunde im Osten besuchen, wusste ich, warum ich misstrauisch gewesen war. Dank meines Luftballons mussten wir in die DDR reisen und das war wahrlich keine verlockende Aussicht.
»Alle Dunkeldeutschen sind Spitzel«, erklärte mir Linus, während unsere Mutter uns in den alten Opel Ascona scheuchte, den sie fuhr, seit ich denken konnte. Damals war unser brüderliches Verhältnis noch in Ordnung. Linus war gerade vierzehn geworden und wusste genau, was abging. Ich schaute zu ihm auf und hing an seinen Lippen, die viel und weise sprachen.
»Was ist ein Spitzel?«, fragte ich wehmütig zurückblickend, als wir die Bonner Straße verließen und am Bahnhof vorbei Richtung Autobahn fuhren.
»Das sind Menschen, die andere ausspionieren, aber nicht wie James Bond, der das für die Freiheit tut, sondern genau umgekehrt, um die Menschen besser einsperren zu können.«
Selbstverständlich gehörte James Bond zu meinen Helden, erst recht nachdem ich heimlich mit Linus Moonraker im Fernsehen geschaut hatte. Tagelang hatte ich an nichts anderes als das hässliche Monster mit den Metallzähnen denken können. Noch mehr Angst hatte ich nur vor den Kommunisten. So absurd es sein mochte, ich war mir sicher, die Welt im Osten hinter der Grenze wäre schwarzweiß statt bunt, die Luft röche modrig und es wäre eiskalt. Linus’ Einflüsterungen funktionierten.
»Bei uns im Westen wird es auch immer schlimmer«, behauptete er, kurz nachdem wir Kassel hinter uns gelassen hatten. »Letztes Jahr sind die Grünen in den Bundestag gewählt worden. Das ist eine Partei voller Durchgeknallter.«
»Red doch nicht so einen Stuss«, sagte meine Mutter und ich wusste, dass sie mit den Augen rollte, obwohl ich das von der Rücksitzbank aus nicht sehen konnte.
»Das sind gefährliche Superspinner«, beharrte Linus auf seinem Standpunkt. »Die wollen, dass wir Männer alle lange Haare tragen wie damals die Hippies, Fleischessen verbieten und Atomkraft auch. Dann steigen die Preise für Elektrizität so stark an, dass normale Menschen wie wir nur noch drei Stunden am Tag Licht machen oder fernsehen können. Das sind Feinde des technischen Fortschritts. Und die wollen sogar Sex mit Kindern erlauben.«
Meine Mutter stöhnte auf, kommentierte die Tiraden meines Bruders aber nicht. Mir wurde ganz übel, weil ich Angst davor hatte, bald nicht mehr fernsehen zu können. Die Sache mit dem Sex fand ich nicht so beunruhigend, da ich mich damit nicht auskannte, aber ich vermutete, es handelte sich um etwas ziemlich Schreckliches. Zum Glück war da noch Helmut Kohl. Dieser massige Mann, der so seltsam sprach, war mein einziger Hoffnungsträger, dass es in unserem Teil Deutschlands niemals so weit kommen würde. Dank Linus’ Unterweisungen wurde er zu meinem persönlichen Supermann Nummer zwei direkt hinter Felix Magath. Und wer weiß, hätte der HSV nicht den Europapokal gegen Juventus gewonnen, vielleicht hätte es Helmut Kohl sogar auf die Nummer eins geschafft. So prangte ein Poster von Magath, dem Siegtorschützen, in meinem Zimmer. Wahrscheinlich war das auch besser so, denn hätte ich den Kohl an meine Wand gehängt, wäre meine Mutter zweifellos ausgerastet. Sie mochte den nicht. Linus meinte, das läge daran, dass sie eine Frau sei und Frauen keine Ahnung von Politik hätten. Das wiederum konnte ich nicht beurteilen, aber da mein Bruder in vielen Dingen recht hatte, widersprach ich ihm nicht.
Linus lamentierte bis zur Grenze, er wolle nicht in das andere Deutschland, weil man die Kommunisten nicht mit unseren Devisen unterstützen dürfe. Am Grenzübergang Herleshausen hielten uns Polizisten auf und untersuchten unsere Klamotten, als seien wir Kriminelle. Anna weinte ohne Pause. Die Stacheldrahtzäune und Wachtürme machten ihr Angst. Sie faselte etwas davon, nicht ins Gefängnis zu wollen. Sie war klein und dumm. Mich traf es wesentlich härter. Ein hässlicher Grenzposten mit einem dicken Schnurrbart, in dem Essensreste klebten, fand meine geliebte He-Man-Figur. Er betrachtete sie eine Weile und steckte sie dann in seine Uniformtasche, da angeblich das Einführen von Kriegsspielzeug in die DDR verboten war. Linus hatte eine Zeitung, die wurde ebenfalls eingezogen, da es sich um DDR-kritische Westpresse handelte. Das war ansatzweise einzusehen. Die wollten nicht lesen, wie doof ihr Land war. Aber meinem kleinen He-Man kriegerische Absichten zu unterstellen, war lächerlich. He-Man kämpfte für Frieden und gegen das Böse. Das wusste jeder. Jeder bis auf den Grenzposten. Oder er wollte meine Figur für sich, um sie abends seinem Sohn zu schenken. Das wäre eine Erklärung, denn in der DDR gab es bestimmt keine Figuren von Mattel zu kaufen. Andererseits war He-Man an einem Ort ohne Skeletor und Teela ein Krieger mit stumpfer Klinge. Was wäre James Bond ohne den Beißer gewesen? Oder Lucky Luke ohne die Daltons?
Nachdem wir unsere Visapapiere gestempelt bekommen hatten, ging es ganz normal weiter. Die Bäume waren grün, der Himmel blau und unser Opel immer noch rot. Allerdings fuhren plötzlich alle anderen Verkehrsteilnehmer dieselben kleinen hässlichen Autos, die Straßen waren rumpelig und es roch zumindest nach meiner Wahrnehmung etwas seltsam.
In Eisenach angekommen wurden wir erstaunlich enthusiastisch empfangen. Laurenz Tillinger, ein schlanker, großer Mann mit einer Halbglatze umarmte meine Mutter überschwänglich und für meinen Geschmack viel zu lange. Sein Sohn Dieter schüttelte uns zur Begrüßung artig die Hand. Meine Mama verschenkte Westkram, wir bekamen selbst gebackenen Kuchen, kurz danach gab es Abendessen. Ich kann mich nur noch an die Nachspeise erinnern. Eingemachte Kirschen, die unheimlich lecker waren. Die DDR war gar nicht so schlecht. Okay, die Menschen durften nicht reisen, nur heimlich West-Fernsehen gucken, bespitzelten sich gegenseitig, aber die Kirschen waren echt in Ordnung. Laurenz und die ebenfalls eingeladenen Nachbarn schienen sogar einigermaßen nett zu sein. Zumindest erwarteten sie von uns keinen abartigen Ostkram wie das Abhören anderer Menschen oder nackt im Garten herumzuspringen. Dieter misstraute ich allerdings sofort, weil er ein bisschen älter war als ich und so tat, als sei er ziemlich schlau, dabei hatte er keine Ahnung, weil er hinter einer Mauer leben musste. Außerdem nervte das Nachbarskind, ein doofes Mädchen namens Katrin, schrecklich.
Am nächsten Tag durfte ich mit dem Trabi der Familie Tillinger fahren. Anna war zusammen mit Dieter bei den Nachbarn geblieben und spielte mit der furchtbaren Katrin. Ich saß auf dem Rücksitz und drückte die Augen so fest zusammen wie möglich. Neben mir hockte Linus und erzählte etwas über die fehlgeleitete Wirtschaftspolitik der DDR.
»Die Straßen sind hier nur so schlecht, weil der Staat die Bürger so stark subventioniert, dass für alles andere kein Geld übrig bleibt«, rief er altklug in das tuckernde Motorgeräusch des Trabants.
»Red nicht so einen Quatsch«, ermahnte ihn meine Mama verärgert, während ich Linus in den Stand eines Gelehrten erhob, denn wer mit vierzehn Jahren schon so sprach, musste einiges auf dem Kasten haben.
»Ich darf also nicht sagen, wie es ist, weil du es nicht hören willst!«, beschwerte er sich und in seiner Stimme klang Triumph mit. »Damit bist du nicht besser als der Herr Honecker und seine kommunistische Bande.«
Linus beeindruckte mich mit seinem Mut. Mein Bruder ließ sich nicht unterkriegen.
»Du darfst bei uns alles sagen, mein Junge«, schaltete sich Laurenz Tillinger mit sanfter Stimme ein. »Aber wir müssen dir nicht zustimmen. Denn das wäre sonst so wie es damals unter dem Herrn Hitler und seiner faschistischen Bande gewesen ist.«
Linus lief rot an und hielt die Klappe. Ich beobachtete fasziniert, wie Herr Tillinger, der offensichtlich etwas Gemeines gesagt hatte, an einem komischen Knüppel, der neben dem Lenkrad angebracht war, herumzupfte.
Wir hielten in einem Wald und gingen wandern. Herr Tillinger und meine Mutter verstanden sich erstaunlich gut. Er machte ihr sogar kindische Komplimente, wie gut sie aussähe und wie jung sie geblieben sei. Ich fand das lächerlich, hielt mich aber klugerweise zurück.
Wir latschten eine halbe Ewigkeit, dabei ging es ständig rauf und runter. Ich fragte mich, warum die Menschen so dumm waren, wenn sie schon mit einem Auto zu einer Wanderung fuhren, ausgerechnet dort zu halten, wo es hügelig war. Ich wäre im Flachland geblieben, wo es sich gemütlich gehen ließ. Irgendwann erreichten wir ein kleines Lokal. Ich bekam eine Cola, die aber keine Cola war, sondern eine schwarze Giftbrühe, die mich um ein Haar hätte auf den Tisch kotzen lassen. Die Ossis wollten mich vergiften, so viel stand fest.
»Das ist Club-Cola aus dem VEB Getränkekombinat Erfurt«, las Linus vom Etikett vor.
Ich schüttelte mich. »Was ist ein Kombinat?«
»Ein Zusammenschluss von Betrieben zur Verbesserung der gesamten Produktion und zur Vermeidung von der Anhäufung von Besitz in den Händen einiger weniger«, erklärte Herr Tillinger. »Die Kombinate gehören dem Volk, also allen Menschen in der DDR. Du magst vielleicht Coca-Cola lieber, aber das ist keine Volksbrause, sondern die Gewinne gehen in die Taschen derer, die ohnehin schon viel haben. Verstehst du?«
Nein, das tat ich nicht.
»Volksbrause klingt ein bisschen wie Volkswagen«, sagte meine Mama und grinste dabei eigenartig verschmitzt.
»Mama …«, maulte ich.
Sie lächelte und fuhr mir mit den Fingern durch die Haare. »Der Laurenz meint das nicht so. Der hätte auch gern Westcola, das gibt er nur nicht zu.«
Wir gingen, meine Club-Cola blieb stehen, dafür bekam ich beim Hinausgehen ein Softeis, das so widerlich schmeckte, dass ich es draußen scheinbar zufällig, aber in Wahrheit absichtlich auf den Boden fallen ließ. Ich weinte ein bisschen, meine Mama sagte, ein weiteres Eis wäre jetzt nicht drin, ich war erleichtert, protestierte verhalten und spielte dann ein paar Minuten den Beleidigten. Ich war ein durchtriebenes Kind, aber erfolgreich. Zurück in Eisenach musste ich mit der nervigen Katrin und Anna im Garten spielen. Das war ein großes Unglück. Wahrscheinlich erschien ich Katrin wie ein Außerirdischer, so normal, gut erzogen und westdeutsch wie ich war. Nachdem sie meinen Namen gelernt hatte, eine erstaunliche Leistung für ein so dummes Mädchen, wurde sie nicht müde, ihn in die Welt zu rufen. Dabei schaffte sie es leider nicht, das T von Tankred wie ein T auszusprechen, stattdessen bevorzugte sie das D. Auch das nachfolgende A klang eher wie ein O.
»Donkred. Donkred. Donkred. Donkred.«
So ging das die ganze Zeit. Katrin kannte kein Ende und hatte offenbar auch keinen Aus-Schalter.
»Donkred. Willst du Kuchen?«, rief sie und hielt mir ein grünes Förmchen mit Sand unter die Nase.
»Nein. Ich hatte schon Eis.«
»Willst du Eis, Donkred?«
Dabei lachte sie die ganze Zeit total hohl, als wäre sie irgendwie gestört.
»Donkred. Backst du auch Kuchen?«
»Ich bin schon acht.«
»Donkred. Ich bin drei«, krähte Katrin.
Sie konnte für ihr Alter schon gut sprechen, auf jeden Fall besser als meine Schwester Anna und die war ein Jahr älter als sie. Dann bewarf ich Katrin aus Spaß mit Sand, aber sie lachte nur, als wäre es das Schönste, was ihr seit langer Zeit widerfahren war. Ich backte einen Kuchen und zwar auf ihrem Kopf. Sie quietschte vor Glück und bewarf mich ihrerseits mit Sand.
»Donkred. Du auch Kuchen auf den Kopf.«
Das ging noch eine ganze Weile so weiter, bis wir endlich wieder zum Essen gerufen wurden. Katrins Oma hatte gekocht und es schmeckte zu meiner Überraschung fast wie bei uns im Westen. Überhaupt haben wir in der DDR unheimlich viel gegessen. Das war schon ein wenig verrückt, denn ich hatte damit gerechnet, in einer schwarzweißen Welt Graubrot mit Wasser vorgesetzt zu bekommen. Abgesehen von der Cola und dem Eis war es aber ganz anders, auch wenn ich auf viele der gewohnten Produkte von zuhause verzichten musste. Mich störte das weniger als Linus, der zum Frühstück sein geliebtes Nutella vermisste. Als Ersatz bot ihm Herr Tillinger Nudossi aus dem Kombinat Elbflorenz an, aber nach den schlechten Erfahrungen mit Club-Cola und dem Softeis – Linus hat es sich im Gegensatz zu mir komplett hinuntergewürgt –, begnügte er sich mit selbst gemachter Zwetschgenmarmelade.
Am nächsten Morgen unternahmen die Erwachsenen, Linus, Dieter und Anna einen Ausflug irgendwohin. Weil ich nicht mehr ins Auto passte, ließen sie mich kaltblütig bei der bekloppten Katrin und ihren Eltern zurück. Einerseits traf mich diese Zurückweisung, andererseits war ich erleichtert, nicht schon wieder zu langweiligen DDR-Sehenswürdigkeiten wie Wälder oder hässliche Städte gefahren zu werden. Da spielte ich lieber mit Katrin.
Wir waren gerade damit beschäftigt, Äste von einem Baum abzubrechen, um daraus Schwerter zu bauen, als eine Frau auf uns zukam. Sie lächelte eigenartig und irgendwie machte mich das nervös, weil ich mich von Fremden fern halten sollte. Auf der anderen Seite hatte mich meine Mutter bei Fremden zurückgelassen, also schien die Regel in der DDR nicht so eng ausgelegt zu werden wie bei uns zuhause.
»Bist du aus dem Westen?«, fragte mich die Frau.
Ich nickte schüchtern. Sie war etwa im Alter meiner Mutter, trug aber eine hässliche Frisur mit einem schiefen Pony und eine graue Jacke, die mich an eine Pferdedecke erinnerte.
»Und ihr seid zu Besuch bei den Tillingers?«
Ich nickte erneut und zog Rinde von dem Ast, den ich in der Hand hielt. Ich traute mich nicht, die Frau anzugucken, während sie mit mir sprach.
»Und was macht ihr da?«
»Wir haben einen Luftballon steigen lassen«, sagte ich leise und ließ Rinde zu Boden fallen. »Deshalb sind wir hier.«
»Wie ist denn dein Name?«
»Das ist Donkred«, rief Katrin.
Die Frau schaute mich von oben herab an. »Und wie heißt du weiter, Donkred?«
»Ich heiße ja gar nicht Donkred. Und mein Nachname ist Deutsch.«
Sie sog die Luft zischend ein. »Dann spielt mal weiter. Kannst ja deinen Freunden im Westen erzählen, wie schön das Kinderleben in der DDR ist.«
Das tat ich nicht, denn allein die Erinnerung an die widerliche Ostcola ließ mich auch Monate nach unserem lebensmüden Ausflug nach Dunkeldeutschland erschaudern. Ich profitierte davon, auf der richtigen Seite der Mauer geboren zu sein, und schwor mir, dankbar zu sein – wem auch immer. Wir hatten hier alles: cooles Fernsehen, schmackhaftes Eis, Pizza, das A-Team, Felix Magath, Demokratie und eine super Partei namens CDU.